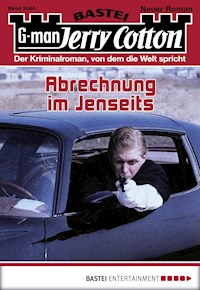1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine unbekannte Frau wachte nach einem Jahr aus dem Koma auf - und verschwand noch in derselben Nacht aus dem Krankenhaus. Aufnahmen der Überwachungskameras deuteten darauf hin, dass sie von einem Mann abgeholt worden war, der sich unbemerkt Zutritt zur Klinik verschafft hatte. Wir vom FBI wurden alarmiert, denn die Existenz der Patientin war damals aus gutem Grund geheim gehalten worden. Neben einer Schusswunde waren in ihrem Körper nämlich Rückstände eines extrem seltenen Nervengifts festgestellt worden. Weltweit gab es nur eine Handvoll Labore, die solch ein Gift herstellen konnten, und fast alle standen im Dienst autoritärer Staaten. War die Fremde auf der Flucht vor einem ausländischen Geheimdienst?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Giftiges Gold
Vorschau
Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen?
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsbeginn
Impressum
Giftiges Gold
Brenda Cho eilte durch den Laderaum des Frachters und hielt erst inne, als sie die strenge Stimme vernahm.
»Hey!«
Langsam drehte sie sich um und blickte in ein grelles Licht, das ihr ins Gesicht gehalten wurde.
»Wer sind Sie?«, fragte der Schatten dahinter auf Koreanisch. »Sie haben hier nichts verloren!«
Brenda sah ihn schweigend an, als würde sie ihn nicht verstehen.
»Öffnen!«, knurrte der Wachmann und leuchtete auf die Sporttasche in Brendas Hand.
Brenda stellte sie ab, kniete sich hin und zog den Reißverschluss auf. Die Elektroschockpistole lag griffbereit.
Zwei nadelförmige Projektile bohrten sich in das Bein des Mannes und setzten ihn in Sekundenschnelle außer Gefecht. Dann verstaute Brenda die Waffe und rannte, als wäre der Teufel hinter ihr her.
Das Rettungsboot war im Schutz der Nacht schnell zu Wasser gelassen. Während der letzten zwanzig Tage auf See hatte Brenda ausreichend Zeit gehabt, sich mit den Gegebenheiten an Bord des koreanischen Containerschiffs vertraut zu machen. Die Sicherung, mit der das Rettungsboot befestigt war, hatte sie bereits am Nachmittag gelöst.
Sanft sank das Boot in die Fluten, und nachdem sie den Heckmotor gestartet hatte, nahm sie Kurs auf die Küste.
Die Lichter der Millionenmetropole New York waren bereits in der Ferne zu sehen. Ein Band aus bunt glitzerndem Strass auf blauschwarzem Samt.
Brenda hielt den Blick starr noch vorne gerichtet. Sie war schon einige Male hier gewesen, seit Jahren allerdings nicht mehr. Eigentlich vermied sie es, sich noch in den Staaten blicken zu lassen, diesmal ging es nicht anders. Der Auftrag, der sie hierhergeführt hatte, war lukrativ genug, dass sie in den nächsten Jahren kürzertreten konnte.
Wenig später zeichnete sich in einiger Entfernung eine aus dem Meer ragende Silhouette vor dem schwarzvioletten Nachthimmel ab. Lady Liberty, mit ihrer gen Himmel gereckten Fackel. Für die meisten ein Fanal der Freiheit. Für Brenda das Zeichen, dass sie ihr Ziel vor Augen hatte.
Sie korrigierte die Richtung etwas, um einen bestimmten Punkt abseits des Harbours anzusteuern. Ab hier wurde es brenzlig, denn sie musste jederzeit damit rechnen, von einem Patrouillenboot der Küstenwache aufgegriffen zu werden. Ihrem Auftraggeber war es jedoch gelungen, deren übliche Routen in Erfahrung zu bringen, sodass es kein Problem werden würde, mit dem unbeleuchteten Rettungsboot durch die Lücken zu schlüpfen.
Die Anspannung der letzten Stunden fiel von ihr ab, als ihr etwas ins Auge stach. Sie nahm ihr Nachtsichtgerät aus der Tasche.
In der grünstichig gefärbten Umgebung sah sie ein anderes Boot, das wie sie unbeleuchtet, aber mit deutlich höherer Geschwindigkeit durch die Wellen pflügte. Und es kam genau auf sie zu!
Brenda drehte ein wenig ab, das Boot folgte dem Kurs.
Das konnte kein Zufall sein. Mit klopfendem Herzen änderte sie erneut den Kurs, doch schnell war klar, dass ihr Fünfzig-PS-Motor gegen den Sportflitzer ihrer Verfolger bei jedem Wettrennen den Kürzeren ziehen würde.
Mit finsterer Miene drosselte sie die Geschwindigkeit, bückte sich in den Fußraum und zog den Reißverschluss ihrer Sporttasche auf.
Die voluminöse, vakuumversiegelte Metallkassette, nach der sie tagelang an Bord des Frachters gesucht hatte, lag schwer in ihrer Hand. Eigentlich war sie mehr eine Art Minitresor, der die Tasche fast vollständig ausfüllte.
Brenda atmete tief durch, dann checkte sie die Koordinaten auf ihrer Multifunktionsuhr. In Sekundenschnelle rief sie die nötigen Informationen ab und fand heraus, dass die Wassertiefe an dieser Stelle rund fünfzig Fuß betrug.
Die Kassette war vermutlich wasserdicht und würde auch dem Druck in dieser noch geringen Tiefe standhalten. Das Restrisiko musste sie eingehen. Denn mittlerweile bestand kein Zweifel mehr daran, dass ihre Verfolger fest entschlossen waren, ihr den Schatz abzunehmen.
Mit beiden Händen wuchtete sie den schweren Minitresor auf die Reling – und ließ ihn einfach fallen. Mit einem Platschen schlug er auf der Wasseroberfläche auf und wurde binnen Sekunden von den Fluten verschluckt.
Brenda hob den Kopf und blickte erneut durch das Nachtsichtgerät.
Das Schnellboot ihrer Verfolger steuerte weiter auf sie zu.
Brenda änderte den Kurs, wendete und fuhr zurück in die Richtung, aus der sie gekommen war. Das große Containerschiff war zwar ein ganzes Stück entfernt, aber sie würde es in jedem Fall schneller erreichen als das amerikanische Festland, zumal ihr der Weg dorthin abgeschnitten wurde. An Bord gab es zahlreiche Versteckmöglichkeiten, wie sie in den letzten beiden Wochen herausgefunden hatte. Dort würde sie also erst einmal sicher sein.
Wie ein Monolith hob sich das große Schiff schon aus weiter Ferne vor dem Nachthimmel ab. Das Boot ihrer Verfolger holte beharrlich auf. Vermutlich verfolgten auch sie ihren Kurs mit Nachtsichtgeräten. Wie sonst hätten sie das unbeleuchtete Rettungsboot inmitten der schwarzen Wellen so genau lokalisieren können?
Brenda brauchte weitere fünf Minuten, um einzusehen, dass ihre Flucht aussichtslos war. Die anderen hatten sie fast erreicht, und der Frachter lag in weiter Ferne. Das war der Moment, in dem sie realisierte, dass Angriff die beste Verteidigung war. Sie schaltete den Motor aus, drehte sich um und ließ das andere Boot herankommen.
Wellen schäumten auf und brachten ihre Nussschale zum Wanken, als das Speedboat sie zweimal umkreiste und dann in einem Abstand von wenigen Yards stoppte.
Auch ohne den Restlichtverstärker entdeckte Brenda zwei Männer an Bord. Asiaten, vermutlich Landsleute von ihr. Tatsächlich sprach einer der beiden sie auf Koreanisch an.
»Die Hände dahin, wo wir sie sehen können!«
Vermutlich zielte er mit einer Waffe auf sie, doch das war in Dunkelheit schwer zu erkennen.
Brenda folgte der Aufforderung und sah dabei zu, wie das Boot tuckernd die letzten Yards überwand, bis es fast bei dem Rettungsboot andockte. Der zweite Mann zog es ganz heran und kletterte zu ihr an Bord.
Brenda klopfte das Herz bis zum Hals. Jetzt kam es darauf an. Wie würde der Mann reagieren, wenn er feststellte, dass sie die Beute nicht hatte?
Gleich würde sie es herausfinden. Der schmächtige Kerl, der eine Cargohose und einen dicken Sweater trug, beugte sich über die Tasche, zog den Reißverschluss auf – und erstarrte.
Erst sah er sie fragend an, dann wandte er sich kopfschüttelnd seinem Partner zu.
»Wo ist es?«, wollte dieser von Brenda wissen. »Was hast du damit gemacht?«
»Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt«, gab Brenda wenig überzeugend auf Koreanisch zurück. »Ihr müsst mich mit jemandem verwechseln.«
Sie glaubte im Dunkeln zu sehen, wie sich die Augen des Mannes verengten. Er richtete seine Waffe auf ihre Brust.
Das war's, dachte Brenda, um sich im nächsten Moment mit einem Satz über die Reling zu schwingen.
Der schallgedämpfte Schuss war durch das Rauschen der Wellen kaum wahrzunehmen. Brenda spürte, wie etwas heiß in ihre Seite schlug. Sie durchbrach die Wasseroberfläche mit ausgestreckten Beinen, und die schwarzen Fluten verschluckten sie wie das Maul eines Untiers.
Sekundenlang fehlte ihr jede Orientierung. Sie wusste nur, dass sie vom Boot wegschwimmen musste, und das so schnell wie möglich. Gleichzeitig bemerkte sie, dass sie Blut verlor. Die Kugel hatte sie erwischt, irgendwo unterhalb der Rippen. Und jetzt pulsierte das Leben in einem blutigen Strom aus ihr heraus, wurde eins mit dem Meer, in dem es vor Urzeiten entstanden war.
Brenda machte noch einige Schwimmbewegungen, mit denen sie tiefer tauchte und sich gleichzeitig von dem Boot entfernte. Dann wurde ihr schwarz vor Augen, und sie spürte, wie die Strömung sie hinfort trieb.
Kate McNamara arbeitete seit fünfzehn Jahren im Mount Sinai Hospital auf der Upper East Side. Und genauso lange ließ sie sich mit Vorliebe für die Nachtschichten einteilen. Vor allem in der Zeit zwischen zwei und drei Uhr kam die ansonsten hektische Welt hinter den hohen Mauern für ein paar Stunden zur Ruhe und gab Kate die Gelegenheit durchzuatmen. Natürlich passierte es, dass ein Notfall eingeliefert wurde, aber die meisten Patienten schliefen tief und fest in ihren Betten, und es geschah selten, dass einer von ihnen nach ihr klingelte.
Umso überraschter war sie, als in dieser Nacht das rote Lämpchen des Notalarms blinkte und sie feststellen musste, dass er in Zimmer 235 ausgelöst worden war. Eilig verließ sie das Schwesternzimmer, wo sie sich gerade einen Kaffee genehmigte, und eilte den leeren langen Gang hinunter.
In Zimmer 235, das sich in einem eigenen Trakt des Gebäudes befand, wurden in der Regel Prominente oder Staatsmänner diskret abgeschottet. Aktuell lag dort eine Patientin, die nicht nur nicht prominent war, sondern gänzlich unbekannt. Und sie war seit ihrer Einlieferung vor gut einem halben Jahr gar nicht in der Lage gewesen, den Alarmknopf zu drücken.
Ein Fischkutter hatte die Asiatin, die bei ihnen unter dem Namen Jane Doe geführt würde, vor der Küste aus dem Wasser gefischt. Die Frau lebte, hatte aber aufgrund einer Schussverletzung sehr viel Blut verloren. Noch während des Transports war sie ins Koma gefallen und seitdem nicht wieder erwacht. Bis heute ...
Und ebenfalls bis heute wusste Kate nicht genau, weshalb man die junge Frau in diesen Gebäudetrakt verlegt hatte. Oder weshalb das Zimmer in den ersten Wochen rund um die Uhr von einem Mitarbeiter des NYPD bewacht worden war.
Angeblich hatte ihre Blutuntersuchung ein Ergebnis erbracht, das die Sicherheitsbehörden so sehr aufgeschreckt hatte, dass sie die Existenz von Jane Doe der Presse gegenüber verheimlichten und das beteiligte Krankenhauspersonal eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen musste. Offiziell existierte die Asiatin nicht, deren Identität bis heute ungeklärt war, was den plötzlich ausgelösten Alarm umso bedeutsamer machte.
Kate hatte genaue Instruktionen erhalten, wie sie sich in einem solchen Fall zu verhalten hatte. Das Klinikleitung musste verständigt werden. Und die würden sich dann an die ihnen zugewiesenen Kontakte beim DHS wenden.
DHS – allein der Klang dieses Akronyms der Homeland Security jagte ihr kalte Schauer über den Rücken. Sollte die Patientin wirklich aus dem Koma erwacht sein, würde das eine Lawine an Ereignissen auslösen und ihrer ruhigen Nachtschicht ein jähes Ende setzen.
Bevor sie diesen Schritt ging, wollte sie einen Fehlalarm jedoch zu einhundert Prozent ausschließen. Noch hielt Kate es für möglich, dass sich einer ihrer Kollegen einen Scherz mit ihr erlaubte. Vor allem Henry, der seit einem Jahr in der Klinik als Pfleger arbeitete, hatte einen etwas abseitigen Humor. Aber was konnte man von einem jungen Mann erwarten, der als Hobby Schlangen und Spinnen züchtete?
Auch Henry ließ sich mit Vorliebe für die Nachtschicht einteilen. Meist spukte er irgendwo in den Gängen herum, sodass Kate ihn die meisten Zeit gar nicht zu Gesicht bekam.
Als Kate Zimmer 235 erreichte, drückte sie die Tür einfach auf.
In dem Einbettzimmer war es dunkel, bis auf das grünliche Leuchten der Gerätschaften, die die Körperfunktionen der Patientin überwachten. Überwachen sollten.
Von der Patientin selbst war nichts zu sehen. Sie lag nicht in ihrem Bett!
Kate erschrak und wollte auf dem Absatz kehrtmachen, als sie im Augenwinkel einen Schatten bemerkte. Mit klopfendem Herzen wirbelte sie herum, und ihr Blick fiel auf die Umrisse einer Gestalt, die im grünlichen Licht wie eine Geistererscheinung wirkte. Die langen schwarzen Haare, die das bleiche Gesicht umrahmten, und der weiße Krankenhauskittel trugen ihren Teil dazu bei.
Kate stieß einen kieksenden Schrei aus und schalt sich im nächsten Moment selbst. Bei der Gestalt handelte es sich offensichtlich um Jane Doe. Sie musste nach ihrem Aufwachen orientierungslos die Schläuche aus den Venen gerissen haben und aufgestanden sein.
Wie eine Untote, die sie im Grunde auch war, taumelte sie auf Kate zu, knickte ein und drohte zu Boden zu fallen.
Schnell trat Kate auf sie zu, fasste sie unter den Armen und führte sie zurück zum Bett.
»Sie dürfen doch noch nicht aufstehen, Miss ...«
»Brenda«, entgegnete die Frau atemlos und fügte in leicht gebrochenem Englisch hinzu: »Mein Name ist Brenda ...«
Kate nickte und drückte sie sanft auf die Matratze zurück. Nach mehr als einem halben Jahr in liegender Position waren ihre Muskeln geschwächt. Sie würde einige Zeit brauchen, um wieder zu Kräften zu kommen. Doch im Moment waren andere Dinge wichtiger.
»Brenda, Sie hatten einen Unfall«, sagte Kate so ruhig und betont, wie man mit einem Kind sprach.
Die Asiatin sah sie aus großen Augen an, ein Schleier vernebelte ihren Blick. Sie sah aus, als würde sie vergeblich versuchen, sich einen Reim auf ihre Situation zu machen.
Kate tätschelte ihre Schulter und beugte sich über sie. »Bitte bleiben Sie liegen. Versprechen Sie mir das? In hole jemanden, der Ihnen hilft.«
Sie wollte gerade aufstehen, als die Tür aufgerissen wurde und ein junger Mann in einem grünen Pflegerkittel den Raum betrat.
Kate atmete scharf aus.
»Henry, da bist du ja! Brenda, das ist Henry.« Umgehend fügte sie hinzu: »Hol Doktor Parker. Beeil dich!«
Aaron Ryders Kieferknochen mahlten, als er mit dem Aufzug in den zweiten Stock des Mount Sinai Hospital fuhr. Der Anruf vor einer knappen Stunde hatte ihn aus tiefstem Schlaf gerissen. Aber als er gehört hatte, wer ihn da anrief und worum es ging, war er auf der Stelle so wach gewesen, als hätte man ihn mit einem Eimer eiskaltem Wasser geweckt.
Die Angelegenheit duldete keinen Aufschub. Vor gut einem halben Jahr waren er und die Behörde, für die er arbeitete, zu den Ermittlungen im Fall einer nicht identifizierten Asiatin hinzugezogen worden, die in New Yorks Lower Bay von einem Fischkutter halbtot aus dem Wasser gefischt worden war.
Doch nicht ihre Schussverletzung hatte die örtlichen Ermittler in Alarmbereitschaft versetzt, sondern die Rückstände von Thirin, einem extrem gefährlichen Nervengift, das in ihrem Blutkreislauf festgestellt worden war.
Dieser Giftstoff war der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Erst vor ein paar Jahren war er auf dem Radar der internationalen Geheimdienste aufgetaucht. Nach aktuellem Wissensstand gab es nur wenige Labore auf der Welt, die Thirin herstellten. Die meisten standen im Dienst autoritärer Staaten, für die es eine einfache und schnelle Methode war, um sich Regimegegnern elegant zu entledigen.
Hautkontakt reichte aus, um die Vitalsysteme eines Menschen in kürzester Zeit auszuschalten, vorausgesetzt, die Dosis stimmte. Der Nachteil war, dass sich Thirin an der Luft relativ schnell verflüchtigte und nach kurzer Zeit nur noch Spuren zurückblieben, die höchstens für ein stärkeres Unwohlsein sorgten.
Mit solchen Restspuren war die Unbekannte offenbar in Berührung gekommen, denn die Dosis war bei ihr keinesfalls lebensbedrohlich gewesen. Sonst hätte sie heute nicht in einem Krankenhausbett im Mount Sinai gelegen, sondern in sechs Fuß Tiefe unter der Erde.
Wer war die Frau, diese Jane Doe? Kam sie von einem der zahlreichen Frachtschiffe, die den Hafen von New York täglich ansteuerten? Warum war sie vergiftet worden? Und wer hatte auf sie geschossen?
Und war sie Opfer oder Täterin?
Aaron Ryder und seine Vorgesetzten hielten es durchaus für denkbar, dass sie eine potenzielle Attentäterin war, die mit dem Ziel, einen Anschlag zu begehen, in den Big Apple reisen wollte. Die schwachen Thirin-Rückstände konnten darauf hindeuten, dass sie sich beim Umgang mit dem Gift aus Versehen kontaminiert hatte.
Viele interessante Fragen und Aaron Ryder vom Department Homeland Security, kurz DHS, wartete seit gut einem halben Jahr darauf, sie dieser Frau stellen zu können.
Als der Aufzug hielt und sich die Tür öffnete, wurde er von einem jungen Mann in der Tracht eines Krankenpflegers in Empfang genommen. Seine blonde Haaren waren militärisch kurz geschoren, und der Ausläufer eines Tribaltattoos, das sich aus seinem Kragen den Hals bis zum Ohr hinaufwand, war vermutlich nur die Spitze des Eisbergs. Ryder rümpfte die Nase. Zu seiner Zeit hatten Krankenschwestern, auch männliche, anders ausgesehen.
»Aaron Ryder?«, fragte der junge Mann.
Ryder nickte nur knapp und ließ sich den Gang hinunter, bis zu einer angelehnten Tür mit der Aufschrift Personal führen.
Der Pfleger klopfte an und zog die Tür auf.
Dahinter befand sich ein Aufenthaltsraum mit zwei Ärzten und einer Schwester, die sofort verstummten, als ihr Blick auf den Neuankömmling fiel. Ryder war das gewohnt. Der Hauch von Autorität, den er mit jeder Faser verströmte, ließ viele verstummen.
Er zückte seinen Ausweis und hielt ihn den Anwesenden entgegen. Die beiden Männer und die Frau nickten knapp. Auch wenn er länger nicht hier gewesen war, konnten sie sich bestimmt gut an ihn erinnern. Ryder hatte ein Gesicht, das man so schnell nicht vergaß. Für einen Geheimagenten eine eher ungünstige Eigenschaft.
»Kommen Sie mit«, sagte einer der Ärzte, ein grau melierter älterer Gentleman mit einem leichten Bauchansatz. »Die Patientin liegt in Zimmer 235.« Er runzelte die Stirn, dann fügte er hinzu: »Aber das wissen Sie ja.«
Tatsächlich war Ryder kurz nach Einlieferung der Asiatin häufig persönlich hier gewesen, um sich über den Zustand der Patientin zu informieren. Mit der Zeit waren seine Besuche seltener geworden, und der letzte lag über einen Monat zurück.
Dennoch erinnerte er sich daran, dass der ältere Arzt Holebrook hieß und der jüngere Macintosh. Der Namen der Schwester, die für ihn nur eine Randfigur war, hatte er sich nicht gemerkt.
»Sagen Sie nicht, dass Sie die Frau allein gelassen haben«, meinte Ryder mit finsterem Blick, als er Holebrook durch den Gang folgte.
»Natürlich nicht«, gab der Arzt mit rauer, übermüdet klingender Stimme zurück. »Schwester Kate ist bei ihr. Sie war die Erste, die nach ihrem Erwachen mit der Patientin gesprochen hat.«