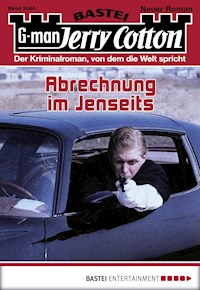1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jerry Cotton
- Sprache: Deutsch
Man nannte sie la Isla del Muerte - die Insel des Todes! Dereinst war sie das Hauptquartier des High-Tech-Terroristen Jon Bent gewesen, und überall waren noch die Selbstschussanlagen, die Minenstreifen und jede Menge automatischer Fallen nicht geräumt. Deshalb war die Insel zum militärischen Sperrgebiet erklärt worden. Nun aber schien sich dort wieder jemand eingenistet zu haben... Phil und ich wurden hingeschickt, um nach dem Rechten zu sehen. In unserer Begleitung befand sich unser Freund Norton Branner von den 'Spezialisten', der als Einziger jemals von einem Besuch der Isla del Muerte lebend zurückgekommen war. Es wurde ein Trip in die Hölle, und zum Schluss erlebten wir noch eine grausame Überraschung ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Wir – gefangen auf der Todesinsel
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Johnny Cris
E-Book-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-8387-0161-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Wir – gefangen auf der Todesinsel
Sie wollten Spaß. Nur deshalb waren sie gekommen. Sie wollten etwas erleben, wollten die Spring-Break-Ferien nutzen, um ihre Jugend zu feiern und das Leben.
Nach monatelanger Maloche in den Hörsälen der Universität und in der staubigen Uni-Bibliothek wollten sie jetzt endlich wieder das Leben aus freien Stücken genießen.
Doch die sieben jungen Männer und Frauen, die sich an Bord der Yacht befanden, ahnten nicht, dass sie in tödlicher Gefahr schwebten …
»Na, wie ist das?«, fragte Julian Styles versonnen, während er auf dem Vorderdeck der ›Magnolia‹ lag und in die karibische Sonne blinzelte. »Ich meine, viele dieser unterprivilegierten Idioten aus unseren Kursen sind nach Daytona Beach oder nach Palm Springs gefahren. Ganz ehrlich, Leute – jeder dahergelaufene Prolet fährt dorthin! Aber das, was wir hier haben, das ist das wahre Studentenleben!«
»Ja, wenn man Styles heißt und Sohn eines stinkreichen Reeders ist, schon«, meinte Brian Devaney, der lässig auf der Reling saß, den Cocktail in der Hand, den er sich gemixt hatte.
Julian schnitt eine Grimasse. Jeden anderen hätte er für eine Bemerkung wie diese über Bord geworfen. Aber Brian war sein bester Freund. Wenn überhaupt jemand solche Kommentare ablassen durfte, dann er. Außerdem waren seine Eltern nicht viel weniger vermögend als Julians. Geld blieb gerne unter sich, wie Julians Vater zu sagen pflegte.
Die ›Magnolia‹ gehörte eigentlich der Firma, wurde hin und wieder genutzt, um Geschäftsfreunde aus Europa zu beeindrucken. Aber während der Frühlingsferien pflegte Julian sie für sich in Anspruch zu nehmen. Sein Vater hatte dafür Verständnis. Auch er hatte in seiner Studentenzeit wilde Touren gen Süden unternommen und dabei reihenweise Mädchen flachgelegt.
Was das betraf, stand Julian seinem Vater in nichts nach. Barbie, Sally, Jennifer und Laurie waren nicht irgendwelche Studentinnen. Sie waren handverlesen, die hübschesten jungen Frauen, die an der Columbia studierten.
Zuerst hatten alle vier Julian und seinen Freunden einen Korb gegeben. Als er ihnen aber vorgeschwärmt hatte von den Sonnenuntergängen der Karibik und von dem Spaß, den sie alle haben würden, da hatten sie doch eingewilligt, sehr zur Freude Brians und Trevors, die Julian hatten hoch leben lassen.
Seit knapp zwei Wochen kreuzten die Freunde nun quer durch die karibische See. Von Miami aus waren sie Richtung Süden aufgebrochen, hatten einige kleine Inseln angesteuert und an einsamen Stränden ausschweifende Partys gefeiert. Es war ein Leben, wie die meisten ihrer Kommilitonen es sich nur erträumen konnten, aber die hatten ja auch weniger reiche Eltern.
»Na, ihr Süßen? Wie geht es euch?«, fragte Julian die beiden jungen Frauen, die sich neben ihm in der Sonne räkelten. Barbie und Laurie waren beide sonnengebräunt, und die Bikinis, die sie trugen, waren verdammt knapp, sodass man ihre wohlgerundeten Formen deutlich bestaunen konnte.
»Rate mal«, meinte Barbie, setzte sich auf und schob ihre Sonnenbrille auf die Stirn. »Das ist der beste Spring Break, den wir je hatten, Julian. Und das verdanken wir nur dir.«
»Das will ich meinen«, erwiderte Julian grinsend. »Ich bin der große Flaschengeist. Nennt mir nur eure Wünsche und ich werde sie euch erfüllen!«
»Also, am liebsten hätten wir zwei Pinacoladas«, sagte Laurie kichernd – und als hätte jemand ihre Gedanken gelesen, tauchte das sonnengebräunte Gesicht von Trevor McCabe aus der Luke auf, die unter Deck führte. In Händen hielt er ein Tablett mit zwei Cocktails darauf.
»Schon unterwegs«, verkündete er grinsend. »Zwei Pinacoladas, wie von den Ladys bestellt – bitte sehr.«
»Du solltest die Chicks nicht zu sehr verwöhnen«, meinte Julian tadelnd. »Die sind imstande und bleiben an Bord.«
»Und?«, fragte Barbie mit großen Augen, nachdem sie an ihrem Strohhalm gesogen hatte. »Wäre das denn so schlimm?«
»Kommt ganz drauf an«, sagte Julian grinsend. »Wenn wir uns später ein paar karibische Schönheiten an Bord holen wollen, dann …«
Weiter kam er nicht – ein Handtuch flog heran und traf ihn ins Gesicht.
Brian hatte es geworfen. »Hört nicht auf ihn!«, rief er grinsend. »Die Sonne hat sein Gehirn angekokelt!«
»Genau so ist es«, versicherte Julian und grinste zurück. »Ich bin unzurechnungsfähig. Das werde ich übrigens auch der Navy sagen, wenn sie uns schnappen.«
»Du meinst, sie werden nach uns suchen?« Trevors Gesicht verriet ein wenig Sorge. »Du weißt, ich hielt es für keine besonders gute Idee, in das Sperrgebiet einzudringen.«
»Sperrgebiet? Ach Quatsch!« Julian schüttelte den Kopf. »Was haben wir schon groß gesehen? Eine Boje mit der Aufschrift ›Militärische Sperrzone, Durchfahrt verboten‹. Das verdammte Ding war so klein, dass wir es auch leicht hätten übersehen können.«
»Wir haben es aber nicht übersehen!«, wandte Trevor ein.
»So what?«, fragte Julian grinsend. »Hast du Schiss? Möchtest du lieber umkehren? Und all das hier zurücklassen?« Er machte eine ausladende Handbewegung, die nicht nur die Yacht und die Mädchen, sondern auch die Bucht mit einschloss, in der sie ankerten, das türkisfarbene Wasser und die Palmen, die sich sanft am weißen Strand der Insel wogen, vor der die ›Magnolia‹ lag.
»Nein!«, riefen Barbie und Laurie aus wie kleine Kinder. »Bitte nicht! Wir wollen hier bleiben! Es ist hier so wunderbar!«
»Da hörst du’s!«, rief Julian grinsend. »Du bist überstimmt, Trevor.«
»Na schön. Aber ich habe kein sehr gutes Gefühl dabei.«
»Unsinn. Vermutlich haben die Militärs hier irgendwann mal ein paar Schießübungen abgehalten und vergessen, die Boje zu entfernen. Ist doch gut für uns – so haben wir diese ganze paradiesische Insel für uns allein.«
»Wenn du meinst, Julian.«
»Ganz bestimmt. Hey, Mädels – warum bringt ihr den guten Trevor nicht auf andere Gedanken? Er macht sich zu viele Sorgen und könnte ein wenig Ablenkung gebrauchen.«
»Wenn’s weiter nichts ist«, meinte Barbie – und sie und Laurie standen auf, gingen hinüber zur Reling und setzten sich darauf. »Hi, Trevy!«, riefen sie lächelnd herüber – und streiften kurzerhand die Oberteile ihrer Bikinis ab. Dann ließen sie sich kichernd nach hinten ins herrlich warme Wasser fallen und schwammen zum Strand hinüber.
»Also, ich weiß nicht, wie’s dir geht, Trevor«, meinte Julian, »aber ich würde mir eine Gelegenheit wie diese nicht entgehen lassen.«
»Mach ich auch nicht«, versicherte Trevor schnell. In aller Eile streifte er sein Hawaiihemd und seine Bootsschuhe ab, setzte dann mit einem eleganten Hechtsprung ins Wasser und schwamm hinter den beiden Mädchen her.
Barbie und Laurie kicherten, während sie so schnell schwammen, wie sie konnten. Sie liebten es beide, mit Jungs zu spielen – bisweilen benahmen sich die ›Herren der Schöpfung‹ in ihrer Nähe wie Idioten, was beiden sehr gefiel.
Sie erreichten den Strand und verließen das Wasser.
»Komm doch!«, riefen sie Trevor zu und winkten. »Wir warten auf dich!«
Ihre wippenden Brüste und ihre blonden, nassglänzenden Haare raubten Trevor den Atem. Er schwamm so schnell er konnte und erreichte ebenfalls das Ufer. Barbie und Laurie ergriffen kichernd die Flucht, rannten quer über den Strand zum nächsten Gebüsch.
»Na wartet!«, rief Trevor und begann ebenfalls zu laufen. Er war sich sicher, dass er die beiden bald eingeholt haben würde.
Eine spaßige Jagd quer durch den Dschungel entbrannte, bei der die beiden jungen Frauen keine Gelegenheit ausließen, ihren Verfolger zu necken. Im Laufschritt folgte Trevor ihnen durch das Dickicht. Hier und dort konnte er einen Blick auf ihre sonnengebräunten Leiber erheischen, fluchte, wenn er mit seinen nackten Füßen auf etwas Spitzes oder Stacheliges trat.
Dann, plötzlich, hielten die Mädchen in ihrer wilden Flucht inne. Auf einer Lichtung blieben sie stehen und verharrten.
»Endlich«, keuchte Trevor – als er plötzlich hörte, wie die beiden aus Leibeskräften schrieen.
Einen Herzschlag später erreichte auch er die Lichtung und sah, was die beiden so in Panik versetzte.
Auch Trevor McCabes Mund öffnete sich zu einem Schrei – doch er verließ nie seine Kehle.
***
Es klang wie ein Gewitter.
Murmelnder Donner, der von der Insel herüberdrang und vom Wind davongetragen wurde.
»Was war denn das?«, fragte Julian und blickte zur Insel hinüber.
»Wer weiß«, erwiderte Brian leichthin, der noch immer auf der Reling saß und an seinem Drink nippte. »Vielleicht hat Trevor in der Aufregung einen fahren lassen.«
Die jungen Männer und Frauen an Bord lachten ausgelassen über den Scherz – doch sie verstummten jäh, als sich das Geräusch wiederholte.
Jennifer Cassle, die vom Achterdeck nach vorn gekommen war, wurde blass im Gesicht. »Das sind Schüsse«, stellte sie fest.
»Was?« Julian schaute die junge Frau, die in ihrem hautengen Badeanzug zum Anbeißen aussah, zweifelnd an.
»Ich kenne dieses Geräusch. Mein Vater hat mich früher oft zur Jagd mitgenommen. Das sind Schüsse!«
»Quatsch«, sagte Julian, aber es klang nicht sehr überzeugt. Als sich das Geräusch erneut wiederholte und dazu ein langer, durchdringender Schrei zu hören war, waren seine Zweifel allerdings dahin.
»Scheiße!«, rief Brian. »Das war Trevors Stimme! Auf der Insel scheint es Schwierigkeiten zu geben!«
Und erneut fielen Schüsse, diesmal jedoch nicht einzeln, sondern eine ganze Garbe, ein lautes, heiseres Stakkato.
»Das ist ein Maschinengewehr«, stellte Jennifer entsetzt fest.
»Verdammter Mist!« Julian sprang auf, wollte hinauf zur Brücke.
»Wo willst du hin?«, fragte Brian.
»Blöde Frage – abhauen natürlich!«
»Und was ist mit Trevor und den Mädchen? Wir können sie doch nicht im Stich lassen!«
»Was heißt da im Stich lassen?«, blaffte Julian. »Auf der Insel gibt es vielleicht Piraten oder noch was Schlimmeres! Willst du, dass wir ihretwegen alle ins Gras beißen?«
»Nein!«, schrie Jennifer. »Bitte nicht! Lasst uns so schnell wie möglich von hier verschwinden.«
»Was sagst du, Sally?«, wandte sich Brian Hilfe suchend an die vierte junge Frau.
»Ich habe Angst«, gestand die hübsche Rothaarige. »Ich will weg von hier.«
»Verdammt, macht doch, was ihr wollt!«, fauchte Brian. »Aber gib wenigstens einen Funkspruch ab, dass Freunde von uns auf der Insel sind und angegriffen werden!«
»Okay«, bestätigte Julian und verschwand eilig unter Deck. »Achtung«, hörte Brian ihn von unten rufen, »an alle, die uns hören können. Hier ist die Hochseeyacht ›Magnolia‹. Wir liegen vor einer Insel vor Anker und können von Land Schüsse hören. Einige unserer Freunde befinden sich in Gefahr, ich wiederhole: in Gefahr! Unsere Koordinaten sind …«
Brian, Jennifer und Sally waren kreidebleich geworden. Alle drei blickten sie betroffen zu der Insel hinüber, von der jetzt kein einziger Laut mehr zu hören war.
Es war unheimlich still geworden, was beinahe noch schlimmer war als die Schüsse von vorhin.
»Was dort drüben wohl geschehen ist?«, fragte Jennifer leise.
»Ich weiß es nicht.« Brian schüttelte den Kopf. Fieberhaft schaute er zum Strand hinüber in der Hoffnung, Trevor und die beiden Mädchen könnten unvermittelt dort wieder auftauchen, aber sie waren weit und breit nicht zu sehen.
Brian merkte, wie ihn eine Gänsehaut beschlich. Offenbar war die Insel nicht so unbewohnt, wie sie gedacht hatten. Ob es mit der Warnung zusammenhing, die sie missachtet hatten?
»Dort drüben! Was ist das?«
Sally war zur anderen Seite der Yacht gegangen und deutete hinaus aufs offene Meer.
Brian und Jennifer gesellten sich zu ihr, blickten in die Richtung, die sie ihnen bedeutete und sahen in einiger Entfernung etwas unter Wasser. Etwas, das aussah wie ein großer Fisch, ein Hai vielleicht – mit dem Unterschied, dass es sich sehr viel schneller bewegte.
Und dass es geradewegs auf die Yacht zukam!
Mit einem Mal wurde Brian klar, was das für ein Ding war! Im Kino und im Fernsehen hatte er so etwas schon oft gesehen, aber noch niemals in der Realität. Doch als er den länglichen schwarzen Schatten unter Wasser heranschießen sah, wusste er, es war …
»Ein Torpedo!«, rief er entsetzt.
Die jungen Frauen an seiner Seite verfielen in panisches Kreischen.
Vor entsetzen wie gelähmt blieben sie an der Reling stehen, sahen, wie das heimtückische Geschoss heranzuckte, um dann mit Urgewalt auf den Schiffsrumpf zu treffen.
Im nächsten Moment wurde die ›Magnolia‹ von einer entsetzlichen Explosion zerrissen!
***
Es war sechs Uhr morgens, als mich Mr. Highs Anruf erreichte.
Ich war bereits aufgestanden und gerade aus der Dusche gestiegen, als das Telefon aufdringlich zu schrillen begann. Eines jener Geräusche, die am frühen Morgen nicht sehr verträglich sind.
Rasch trocknete ich mich ab, schlang mir ein Handtuch um die Hüften, ging dann hinaus in den Wohnraum und nahm den Hörer ab.
»Ja, hier Cotton!«
»Guten Morgen, Jerry«, drang die Stimme meines Chefs aus dem Hörer. »Haben Sie gut geschlafen?«
»Es geht, Sir«, gab ich zu, »danke der Nachfrage – aber ich gehe nicht davon aus, dass das der Grund für Ihren Anruf ist?«
»Allerdings nicht, Jerry«, sagte Mr. High. »Ich muss Sie bitten, sich schleunigst zusammen mit Phil in meinem Office einzufinden. In zwanzig Minuten. Ist das zu schaffen?«
»Keine Frage, Sir«, erwiderte ich. »G-men sind immer im Dienst!«
***
Was meine Feststellung bezüglich der G-men und ihres Verhältnisses zum Dienst betraf, hatte ich leider nicht ganz Recht. Mein Anruf bei meinem Freund und Partner Phil Decker bewies mir, dass auch G-men des FBI ein Privatleben haben und dass es sehr wohl Stunden gibt, in denen sie gerne ungestört wären.
Nachdem ich Phils Nummer gewählt hatte, meldete sich zuerst die aufgekratzte Stimme einer jungen Frau am Telefon, die auf mich einen Eindruck machte, als würde sie hoch über Manhattan auf Wolke sieben schweben. Dann erst bequemte sich mein Partner ans Telefon.
»Decker hier – was gibt’s?« Phils Stimme klang krächzend und ziemlich mitgenommen, geradezu erschöpft.
»Hier ist Jerry. Tut mir Leid, dich zu stören, Alter, aber die Pflicht ruft!«
»O nein«, stöhnte Phil. »Bitte nicht jetzt. Nicht ausgerechnet jetzt!«
»Sorry, Alter. Mr. High will, dass wir in zwanzig Minuten auf der Matte stehen. Die Blondine wird sich ein wenig gedulden müssen.«
»Verdammter Mist.« Ich konnte hören, wie wütend mein Partner war. Offenbar hatte er sich diesen Samstag Morgen ein wenig romantischer vorgestellt. »Also gut«, sagte er schließlich. »Hol mich in zehn Minuten an unserer Ecke ab.«
»Gemacht, Alter.«
»Und – Jerry?«
»Ja?«
»Woher weißt du, dass sie blond ist?«
»Ich hab es an der Stimme erkannt.«
»An ihrer Stimme? Wow!« Phil schien beeindruckt.
»Nein, Alter«, widersprach ich grinsend. »An deiner Stimme …«
***
Zehn Minuten später stand Phil tatsächlich an ›unserer‹ Ecke parat, und weitere zehn Minuten später standen wir in Mr. Highs Büro.
Da es Samstag war, war das Field Office an der Federal Plaza nur mit einer Kernmannschaft besetzt. Neben den Kollegen, die Bereitschaft hatten, waren nur die Zentrale und einige wichtige Abteilungen belegt. Auch Helen, Mr. Highs Sekretärin und nach Phils und meiner Meinung die beste Kaffeeköchin der Welt, hatte frei, sodass wir leider nicht mal einen Kaffee bekamen, um die letzten Reste von Müdigkeit zu vertreiben.
Mr. High wirkte hellwach wie immer. Es gab Kollegen, die vermuteten, dass unser SAC nach Dienstschluss überhaupt nicht nach Hause fuhr, sondern unter seinem großen Eichenholzschreibtisch übernachtete …
»Setzen Sie sich, meine Herren«, forderte unser Chef uns auf, und Phil und ich nahmen in den beiden Besuchersesseln Platz, gespannt darauf, was uns den freien Tag gekostet hatte.
»Ist Ihnen der Name Jonathan Styles ein Begriff?«, kam Mr. High ohne weitere Umschweife auf den Punkt, denn in seiner direkten, geradlinigen Art mochte er es nicht, lange um den heißen Brei herumzureden.
»Jonathan Styles?«, fragte ich. »Sie meinen den Reeder?«
»Genau den.«
»Nun – Styles ist das, was die alteingesessene New Yorker Gesellschaft einen Neureichen nennen würde. Mitte der 80er Jahre kam er durch einige erfolgreiche Börsenspekulationen zu einem beträchtlichen Vermögen, das er in eine eigene Schifffahrtslinie investierte. Styline Cruises. Veranstaltet vornehmlich Luxuskreuzfahrten, so viel ich weiß.«
»Alle Achtung, Jerry. Ich hätte es nicht besser ausführen können – mit dem Unterschied, dass ich dafür nachschlagen musste. Seit wann interessieren Sie sich für den New Yorker Jet-Set?«
»Überhaupt nicht«, gestand ich. »Aber ich gehe hin und wieder zum Friseur.«
»Dann wissen Sie auch, dass die Boulevardblätter Styles ein wenig schmeichelhaften Kosenamen verpasst haben. Sie nennen ihn den ›Möchtegern-Onassis von Manhattan‹.«
»Schön und gut, Sir«, meinte Phil, der noch immer ein wenig erledigt aussah – die Nacht mit der Blondine schien meinen Partner geschafft zu haben. »Aber was hat das mit uns zu tun? Ich meine, ermittelt der FBI jetzt schon gegen die Regenbogenpresse?«
»Nein, das nicht, Phil. Der Grund, warum ich Sie beide herbestellt habe, ist der, dass Styles’ Sohn Julian seit einer Woche vermisst wird.«
»Vermisst?«
»Er befand sich mit Freunden von der Columbia University auf einem Yachtausflug in der Karibik. Die jungen Leute wollten dort die Frühlingsferien feiern.«
»Donnerwetter«, meinte Phil. »Wir haben unsere Spring Breaks damals am nächstbesten See verbracht!«
»Die Zeiten haben sich geändert«, meinte Mr. High mit verständnisvollem Lächeln. »Heutzutage fahren die jungen Leute in die Karibik – jedenfalls dann, wenn der Vater zu den fünfzig reichsten Menschen in New York gehört.«
»Und dieser Junge ist spurlos verschwunden?«, fragte ich.