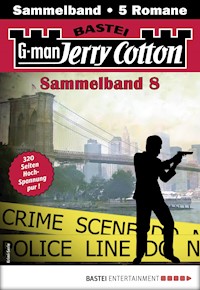
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jerry Cotton Sammelbände
- Sprache: Deutsch
Sammelband 8: Fünf actiongeladene Fälle und über 300 Seiten Spannung zum Sparpreis!
G-Man Jerry Cotton hat dem organisierten Verbrechen den Krieg erklärt! Von New York aus jagt der sympathische FBI-Agent Gangster und das organisierte Verbrechen, und schreckt dabei vor nichts zurück!
Damit ist er überaus erfolgreich: Mit über 3000 gelösten Fällen und einer Gesamtauflage von über 850 Millionen Exemplaren zählt er unbestritten zu den erfolgreichsten und bekanntesten internationalen Krimihelden überhaupt! Und er hat noch längst nicht vor, in Rente zu gehen!
In diesem Sammelband sind 5 Krimis um den "besten Mann beim FBI" enthalten:
2815: Das Beten und das Sterben
2816: Der Freund meines Feindes
2817: Nimm das Geld und flieh!
2818: Kap ohne Hoffnung
2819: Der Tod macht kleine Schritte
Jerry Cotton ist Kult - und das nicht nur wegen seines roten Jaguars E-Type.
Jetzt herunterladen und garantiert nicht langweilen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 670
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Impressum
BASTEI ENTERTAINMENT Vollständige eBook-Ausgaben der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgaben Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG Für die Originalausgaben: Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller Verantwortlich für den Inhalt Für diese Ausgabe: Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln Covermotive von © shutterstock: Flik47 | Black creator ISBN 978-3-7325-7018-8Jerry Cotton
Jerry Cotton Sammelband 8 - Krimi-Serie
Inhalt
Inhalt
Cover
Impressum
Das Beten und das Sterben
Vorschau
Das Beten und das Sterben
Der Teufel verirrte sich selten in die Holy Trinity Church. Und doch spürte Father Timothy seine Gegenwart, als er um Mitternacht seine Kirche betrat. Es roch weder nach Feuer und Schwefel, noch waren seine Spuren auf dem Boden zu sehen. Es war mehr ein Gefühl, das den Pater misstrauisch machte: das untrügliche Gefühl, das man in einer dunklen Höhle empfindet, wenn man plötzlich ein leises Fauchen hört.
Father Timothy kniete vor dem langen Gang zum Altar nieder und bekreuzigte sich rasch. Nervös blickte er sich nach allen Seiten um. Das einzige Licht kam von den brennenden Kerzen vor dem Marienaltar und dem Licht des vollen Mondes, der die bunten Fenster zum Leuchten brachte. Um diese Zeit war niemand mehr in der Kirche, nicht mal die alte Emily, die alle paar Stunden auftauchte, seit ihr Mann überraschend an Lungenkrebs gestorben war.
Den Teufel sah der Pater nicht. Und wenn, hätte er seine bösen Absichten nicht erkannt. Satan tauchte in vielen Gestalten auf und tarnte sich mit den harmlosesten Gesichtern. Sogar als schöne Frau sollte er sein Unwesen treiben. In der Holy Trinity Church war er als Biedermann aufgetaucht. Mehr als fünfzig Jahre war das her. Er hatte sich in der Gruft versteckt und mit einem Messer in der Hand auf den damaligen Pater gewartet. Er hatte es ihm zweimal in die Brust gestoßen und anschließend in den Hals gerammt. Das Markenzeichen eines Serienkillers. Jeder sollte wissen, dass er den Pater ins Jenseits geschickt hatte. Er ganz allein.
Father Timothy ging durch die leeren Reihen zum Altar vor. Ein düsteres Lächeln zog über sein Gesicht, als er an den schrecklichen Vorfall dachte. Man hatte ihm den grausamen Mord oft genug geschildert. Seit jener Nacht spukte es in der Holy Trinity Church gleich doppelt. Der Geist des Mörders, der auf dem Elektrischen Stuhl gestorben war, geisterte angeblich noch immer durch die Kirche und suchte nach neuen Opfern. Und der Geist des ermordeten Paters läutete die Glocken, um seine Nachfolger vor dem Mörder zu warnen.
Vor dem Altar kniete Father Timothy nieder. Mit gesenktem Kopf murmelte er ein Gebet und bekreuzigte sich. Er wusste selbst, dass ihn nur eine baldige Beichte vor der ewigen Verdammnis retten konnte, und doch schreckte er schon seit Wochen davor zurück, sich einem Priester zu erklären. Nur für einen Augenblick hatte er in Erwägung gezogen, sich vor einer weltlichen Institution zu erklären, die Idee aber gleich wieder verworfen. Dort hätte er mit seinen Worten erst recht eine Lawine losgetreten. Weltliche Stellen kannten kein Beichtgeheimnis, und man würde seine Erklärung in allen Medien breittreten. »Gib mir Kraft, o Herr!«, betete er. »Gib mir Kraft und die Ausdauer, im Kampf gegen das Böse zu bestehen! Hilf mir!«
Doch von Gott kam keine Antwort. Es blieb totenstill in der Kirche, und da er die Luft angehalten hatte, waren nicht mal seine raschen Atemzüge zu hören.
Er stand enttäuscht auf und setzte seinen nächtlichen Rundgang fort. Eine Routine, bei der er sich mit Father William abwechselte. Jeden Tag um Mitternacht inspizierten sie die Kirche und alle anderen Räume im Gotteshaus. Der Rundgang endete in der Gruft unter der Eingangshalle, einer durch mehrere schmale Gänge verbundenen Grabstätte, in der die Reliquie eines Heiligen und der ermordete Pater begraben lagen. Vor dem Grab des Paters, das mit einer verzierten Marmorplatte versiegelt war, blieb Father Timothy jeden Abend stehen und sprach ein Gebet.
Eine schwache Lampe an der nackten Wand erhellte die steile Wendeltreppe in die Gruft. Obwohl der Kirchendiener die Birne erst vor wenigen Tagen ausgewechselt hatte, flackerte sie nervös. Der Geist des toten Paters, der noch immer keine Ruhe findet, behaupteten einige. Für alle Fälle hatte der Pater eine Taschenlampe eingesteckt. Es kam schon mal vor, dass sich ein Obdachloser oder ein Junkie in dem Gewölbe versteckte. Die Pater schickten sie nicht fort, ließen sie meist in einem Zimmer der Pfarrei schlafen und boten ihnen Hilfe an. Doch am nächsten Morgen waren sie meist verschwunden.
***
Father Timothy hatte die Gruft erreicht. Seine Schritte hallten unheilvoll durch das Gewölbe. Die Decke war so niedrig, dass er beinahe mit dem Kopf dagegenstieß. Er lief geduckt durch die kaum beleuchteten Räume und leuchtete mit seiner Taschenlampe in die Ecken. Manchmal versteckten sich auch Hunde oder Katzen in der Gruft.
Der Lichtkegel seiner Taschenlampe wanderte über die verputzten Wände und eine massive Holztür. Father Timothy hatte sie nie geöffnet, wusste aber, dass sich dahinter ein schmaler Tunnel aus dem Bürgerkrieg verbarg. Damals hatten die Pater flüchtige Sklaven aus dem Süden in dem Gewölbe versteckt und durch den Tunnel geschleust. Angeblich war er auf halbem Weg verschüttet. Die Legende wollte wissen, dass Alkoholschmuggler den Tunnel während der Prohibition benutzt hatten.
Bis vor einigen Jahren hatte es noch einen zweiten Tunnel gegeben, doch der war eingestürzt, und man hatte die Tür entfernt und die Öffnungen mit Backsteinen zugemauert. Dort hielt sich angeblich der Geist des Mörders versteckt. Obwohl man ihn damals hingerichtet hatte, sei er zurückgekommen, um in der Kirche auch weiterhin sein Unwesen treiben zu können. Bei dem Gedanken an die vielen Legenden und Spukgeschichten, die sich um seine Kirche rankten, musste Father Timothy lachen. Immerhin trieben sie Menschen in die Kirche, die sonst vielleicht nicht gekommen wären. Sogar Reisegruppen hatten sich schon in der Holy Trinity Church in Brooklyn sehen lassen. Ein Trick Gottes, um Gläubige anzulocken?
Father Timothy kehrte in die Hauptkammer der Gruft zurück und blieb vor der Grabstätte des ermordeten Priesters stehen. Hier ruht Father John S. Sutherland, stand in Goldbuchstaben auf dem weißen Marmor. Möge seine Seele in Frieden ruhen. Kein Hinweis auf das abscheuliche Verbrechen, das seinem Leben auf so furchtbare Weise ein Ende bereitet hatte. Die Kirche war nicht daran interessiert, mit der Tat eines Serienkillers für die Gemeinde zu werben. Lediglich in der Broschüre der Kirche wies ein Nebensatz darauf hin, wie Father John gestorben war.
Mit gefalteten Händen und gesenktem Kopf sprach Father Timothy ein Gebet. Wie jeden Abend bat er Gott, sich der Seele des ermordeten Priesters anzunehmen.
Die Lampe im Flur flackerte und erlosch, anscheinend ein Wackelkontakt. Er würde Karl Berger, den Kirchendiener, bitten, mal genauer nachzusehen. Oder steckte der Geist des Mörders dahinter? Father Timothy lächelte bei dem Gedanken.
Doch als eine Tür quietschte und plötzlich die Glocken in den beiden Türmen der Holy Trinity Church zu läuten begannen, wurde er doch nervös und blickte sich ängstlich um. Es war kurz nach Mitternacht, da läuteten die Glocken sonst nie. Er bekreuzigte sich und murmelte ein leises »Gelobt sei Jesus Christus!«, als könnte er damit die bösen Dämonen vertreiben.
Aus dem Nebenraum, in dem die Tür zu dem geheimnisvollen Fluchttunnel lag, klangen schlurfende Schritte. Im flackernden Licht der wenigen Lampen tanzte der Schatten eines Mannes über die Wände und die Decke. Das Läuten der Glocken klang plötzlich so laut und bedrohlich, dass er sich am liebsten die Ohren zugehalten hätten. Stattdessen starrte er wie gebannt auf den Schatten, der aus dem Nebenraum in die Hauptkammer gewandert kam. Ein Obdachloser, der in einem der Nebenräume geschlafen hatte? Ein Junkie? Er spürte, wie ihm Schweiß auf die Stirn trat.
Mit klopfendem Herzen beobachtete er, wie eine dunkle Gestalt in der Grabkammer erschien. Ein Mann. Mehr konnte er in dem Halbdunkel nicht erkennen. Vor Schreck ließ er die Taschenlampe fallen. Sie polterte über den Steinboden und blieb liegen.
»Was … was haben Sie vor?«, stammelte er, als er das Jagdmesser in der Hand des Mannes erkannte. »Was soll das? Le-Legen Sie das Messer weg!«
Der Mann dachte nicht daran. In dem Wissen, dass ihm Father Timothy auf keinen Fall entwischen konnte, ging er weiter auf ihn zu. Die scharfe Klinge des Messers glänzte im trüben Licht.
Father Timothy wich ängstlich zurück, bis er mit dem Rücken gegen die Grabplatte aus weißem Marmor stieß. Ihm fiel ein, dass Pater John auf genau diese Weise gestorben war, mit einem Messer in der Kehle und genau an dieser Stelle. Mit dem einzigen Unterschied, dass es damals noch kein Grab gegeben hatte. »Ge-gehen Sie!«, rief er in aufkommender Panik. »Gehen Sie weg!«
Doch die Gestalt war kein Geist, das erkannte Father Timothy schon wenige Augenblicke später, als der Mann direkt vor ihm stand. Es war Satan. Der Teufel war gekommen, um ihn für seine Sünden zu bestrafen. Er erkannte ihn selbst in seiner biederen Verkleidung.
»Bitte … bitte nicht!«, flehte er.
Vergeblich, denn schon im nächsten Augenblick holte der Mann aus und stach zweimal auf ihn ein. Beide Stiche trafen ihn ins Herz und ließen ihn tot zu Boden sinken. Ihm blieb nicht einmal Zeit für ein letztes Gebet. Aus beiden Wunden blutend stürzte er auf den Steinboden und rührte sich nicht mehr.
Der Mörder betrachtete den Toten eine Weile und brummte unzufrieden. Mit wenigen Handgriffen veränderte er die Lage des Paters, zog sein rechtes Bein etwas nach unten, legte den linken Arm so, dass der Handrücken den Boden berührte, und rückte den Kopf zurecht, sodass die leeren Augen zur Decke starrten. Erst dann holte er ein weiteres Mal aus und rammte dem Toten die blutige Messerklinge in den Hals.
Zufrieden tauchte er seine behandschuhte Rechte in das Blut und drückte sie gegen die weiß getünchte Wand. Mit einem sanften Lächeln im Gesicht verließ er die düstere Grabkammer.
***
Endlich mal wieder ein Morgen nach meinem Geschmack. Ich saß mit Phil in einem Coffee Shop beim Frühstück. Statt Kaffee und Toast gab es zwei Rühreier mit Speck, ein halbes Dutzend Pfannkuchen mit Sirup und ehrlichen Kaffee ohne Schnickschnack.
Mein Handy klingelte. Der Chef, wer sonst? Ich brauchte nicht mal aufs Display zu blicken, um das zu wissen. Ich erkannte ihn am Klingeln. »Guten Morgen, Chef. Wir sind gleich bei Ihnen.«
»Nicht nötig«, erwiderte er. »Ich möchte, dass Sie nach Brooklyn fahren. Am besten sofort. Lieutenant Cameron hat gerade angerufen.«
»Shelby Cameron? Die mit den vielen Auszeichnungen? Die letztes Jahr den Drogenboss verhaftet hat und zur Polizistin des Jahres gewählt wurde?«
»Genau die. Ein Mord in der Holy Trinity Church in der Montrose Avenue. Ein katholischer Priester. Eine heikle Sache, wie Sie sich denken können.«
»Und deshalb soll das FBI ran?« Mit der freien Hand kramte ich bereits ein paar Dollarscheine aus der Jackentasche und legte sie neben meinen Teller. Phil ahnte, was uns erwartete, und hatte ebenfalls schon gezahlt. Er hatte sowieso keinen großen Hunger gehabt.
»Deshalb auch.« Mr High wirkte äußerst ungedulig. »Sie können sich ja denken, wie heikel ein solcher Fall nach den Missbrauchsskandalen der letzten Jahre ist. Die Kirche, die Medien, der Bürgermeister … was meinen Sie, was hier los ist, wenn die Sache an die Öffentlichkeit dringt. Aber das ist nicht alles.« Ich hörte, wie er einen von Helens leckeren Schokokeksen zerkaute. »In der Kirche soll es angeblich spuken …«
Einen solchen Satz hätte ich von unserem Chef am allerwenigsten erwartet. »Es soll spuken?«, fragte ich nach einer längeren Schrecksekunde. »Sie meinen, in der Kirche treiben sich Geister rum? Sie wollen mir doch nicht sagen, dass wir es hier mit einem dieser übersinnlichen Fälle zu tun haben, wie man sie neuerdings im Fernsehen sieht?«
»Natürlich nicht.« Mr High räusperte sich verlegen. »Aber die Tat entspricht bis in die kleinste Einzelheit einem Mord, der vor fünfzig Jahren in der Kirche geschah. Damals ermittelte der Großvater von Lieutenant Cameron. Der gleiche Modus operandi, die gleiche Tatwaffe, der gleiche blutige Handabdruck an der Wand. Als wäre der Geist des Serienkillers, der für den damaligen Mord verantwortlich war, zurückgekehrt, um auch diesen Mord zu begehen. In derselben Kirche, am selben Ort in der Gruft im Untergeschoss.«
»Lebt der Mörder von damals noch?«, wollte ich wissen. »Hat man ihn gefasst? Sie glauben doch nicht, dass …«
»Nein, natürlich nicht«, schnitt er mir das Wort ab. »Obwohl er nicht der erste Siebzigjährige wäre, dem wir einen Mord nachweisen. Aber George Atkinson ist tot. Er wurde wegen vierfachen Mordes zum Tode verurteilt und starb auf dem Elektrischen Stuhl. Ich lasse Ihnen alle Einzelheiten auf den Computer schicken.« Über dem Scharren der Stühle überhörte ich eine Bemerkung des Chefs. »Ich wiederhole«, fuhr er fort. »Der Fall genießt allerhöchste Priorität.«
Wir griffen nach unseren Mänteln und verließen den Coffee Shop. Mein Jaguar stand direkt vor dem Lokal neben einem Hydranten. Der Uniformierte, der gerade seinen Block zückte und mir einen Strafzettel ausschreiben wollte, lächelte nachsichtig, als wir ihm unsere Ausweise zeigten. Wir stiegen in den Wagen, und Phil gab die Adresse der Holy Trinity Church in das Navi ein. So fromm, dass wir alle Kirchen in Brooklyn kannten, war keiner von uns.
Ich schaltete in den ersten Gang und lenkte den Jaguar nach Süden zum Battery Tunnel. Die Rühreier und Pfannkuchen lagen mir plötzlich schwer im Magen, und meine gute Laune war fast dahin. Heikle Fälle, die mit der katholischen Kirche zu tun hatten, überließ ich lieber den Cops.
»Wenn wir es mit einem Nachahmungstäter zu tun haben, aus welchem Grund auch immer, könnte er auch in New Jersey und Pennsylvania zuschlagen«, erklärte Mister High, »und dann hätten wir den Fall sowieso auf dem Tisch. Geben Sie sich Mühe, Jerry! Ich möchte die Sache so schnell wie möglich vom Tisch haben. Am liebsten wäre mir, wir könnten den Mord tatsächlich einem Geist in die Schuhe schieben.«
»Wer weiß«, erwiderte ich. »Die Welt steckt voller Überraschungen, besonders hier in New York.« Ich schaltete die Scheinwerfer ein und fuhr in den Tunnel. »Ich melde mich bei Ihnen, Chef.«
Nachdem ich aufgelegt hatte, blickte ich Phil an. »Special Agents Jerry Cotton und Phil Decker, die Geisterjäger.«
»Mir wird angst und bange«, sagte er.
***
Lieutenant Shelby Cameron war eine leicht übergewichtige Frau in Jeans, Anorak und Turnschuhen und wahrscheinlich jünger, als sie aussah. Ich schätzte sie auf Anfang vierzig. Sie trug ihre Haare wie Katie Couric, die Nachrichtensprecherin, hatte knallrote Lippen und gab sich betont mürrisch, als wir am Tatort auftauchten. »Sie sehen wie Feds aus«, begrüßte sie uns.
»Special Agents Jerry Cotton und Phil Decker vom FBI«, stellte ich uns vor. »Lieutenant Shelby Cameron?«
»In voller Größe.« Sie führte uns in die Gruft hinab und zeigte uns den Toten, der vor dem Grab eines Priesters auf dem Boden lag. Im Licht einiger greller Scheinwerfer arbeiteten die Cops der Crime Scene Unit und der Medical Examiner, ein junger Mann, der gerade seine Untersuchung beendet hatte und uns mit einem Nicken begrüßte.
»Der Tod muss gegen Mitternacht eingetreten sein«, sagte er. »Zwei Stiche ins Herz, beide tödlich. Die Tatwaffe steckt im Hals des Toten. Ein Jagdmesser. Das Opfer hat sich nicht gewehrt. Entweder kannte der Pater seinen Mörder, oder der Angriff kam zu überraschend. Wie von Geisterhand.«
Cameron blieb mürrisch. »Jetzt fangen Sie auch noch mit dem Blödsinn an.« Sie wandte sich mit einem Kopfnicken von dem Mediziner ab und sagte zu mir: »Hier soll es nämlich spuken. Der böse Geist von Bloody George Atkinson, der den Mord vor fünfzig Jahren beging. Er erstach Father John S. Sutherland auf die gleiche Weise wie der Bursche, der Father Timothy auf dem Gewissen hat.«
Sie deutete auf die Marmorplatte mit dem Namen des toten Paters.
»Und der Geist von Father John, dem man nachsagt, dass er zu den unmöglichsten Zeiten die Glocken läutet, um vor Bloody George zu warnen. Heute Nacht sollen sie auch geläutet haben, sagt Father William. Father William Medlow, der zweite Pater der Gemeinde. Er hat den Toten gefunden. Im Augenblick ist er bei den Sanitätern. Er sagt, dass Father Timothy gestern mit dem nächtlichen Kontrollgang dran war. Sie wechseln sich ab. Sie gehen meist um Mitternacht. Das bestätigt auch die Tatzeit, die uns der Arzt genannt hat.« Sie blickte uns forschend an. »Wie ich sehe, reißen sich die Feds um diesen schönen Fall.«
Ich deutete ein Lächeln an. »Fragen Sie mal unseren Chef, der sagt Ihnen was ganz anderes.« Ich betrachtete den Toten, einen ebenfalls jungen Priester mit einem markanten Gesicht, das im Tod seltsam entspannt aussah. »Ein Copy Kill der Tat vor fünfzig Jahren?«
»So ist es, Agent.« Lieutenant Cameron wirkte sehr besorgt. »Ich kenne den Fall ziemlich genau. Mein Großvater leitete die Task Force, die ihn damals bearbeitete. Lieutenant James W. Cameron, der Stolz des Reviers. Sie nannten ihn Jimmy C.« Jetzt rang sie sich doch ein flüchtiges Lächeln ab. »Bloody George Atkinson hinterließ den Tatort genauso, wie Sie ihn hier sehen. Nur die Grabstätte von Father John müssen Sie sich wegdenken. Zwei Stiche ins Herz, beide tödlich, die Tatwaffe steckte im Hals. Ein Jagdmesser wie dieses hier. An der Wand hinterließ er einen blutigen Handabdruck.« Sie führte uns zu dem Abdruck an der Wand. »Das ist der einzige Unterschied. Bloody George hinterließ einige Fingerabdrücke, die ihm später zum Verhängnis wurden. Leider erst, nachdem er noch drei weitere Morde begangen hatte. Unser Mörder benutzte Handschuhe.«
»Und warum der Abdruck?« Ich starrte die blutige Hand an. »Ohne ihn wäre Bloody George vielleicht entkommen.«
Cameron zuckte die Achseln. »Muss im Eifer des Gefechts passiert sein. Vielleicht ist er ausgerutscht. Wenn ich mich recht erinnere, war der Kirchendiener hinter ihm her. Aber Bloody George Atkinson besaß einen Nachschlüssel zu der Tür im Nachbarraum und floh rechtzeitig durch den Fluchttunnel.«
Sie führte uns nach nebenan, und wir blickten staunend auf die offene Holztür und den dunklen Tunnel, der sich dahinter auftat. Ein Überbleibsel aus dem Bürgerkrieg, der auch in New York seine Spuren hinterlassen hatte.
»Und so ist anscheinend auch unser Killer entkommen«, kombinierte ich. Ich blickte Cameron an. »Gab es einen bestimmten Grund, warum Bloody George ausgerechnet einen Priester umbrachte? Hatte er was gegen ihn? Oder die Kirche? Warum griff er sich nicht einen einsamen Spaziergänger im Park? Das wäre doch einfacher gewesen, wenn er unbedingt jemand ermorden wollte.«
»Keine Ahnung.« Shelby Cameron blieb vor dem Tunnel stehen. »Vielleicht suchte er die Herausforderung. Ein Motiv gab es nicht. In den Verhörprotokollen meines Großvaters steht, dass es ihm Spaß machte, angesehene und verletzbare Menschen wie Priester und Frauen umzulegen. Wenn Sie mich fragen, war er krank. Er hatte eine gewaltige Meise, das war alles. Und bei dem Dreckskerl, der Father Timothy umgebracht hat, ist es sicher nicht anders. Ich hoffe nur, dass er lebenslänglich in den Knast wandert oder die Nadel bekommt und nicht von einem superschlauen Anwalt für unzurechnungsfähig erklärt und in eine Klinik geschickt wird. Großvater sagte: Wer einen unschuldigen Menschen umbringt, sollte für alle Zeiten in der Hölle schmoren.«
»Ein Mann ohne Kompromisse.«
Cameron lächelte wieder. »Die Worte meiner Großmutter. Leider sind beide schon gestorben. Gott hab sie selig.«
Ich kniff die Augen gegen das grelle Scheinwerferlicht zusammen und blickte mich nach Phil um. Er war zurückgeblieben und sprach mit den Cops der Crime Scene Unit. Besonders zufrieden sahen weder er noch die Cops aus.
»Nichts«, sagte er, nachdem er uns eingeholt hatte. »Keine Fußspuren, keine Fingerabdrücke, kein Blut. Nichts, was uns einen Hinweis auf die DNA des Täters geben könnte. Und das Jagdmesser ist ein gängiges Modell, das gibt’s in jedem Walmart zu kaufen.«
Cameron hatte wieder ihre ernste Miene aufgesetzt. »Was anderes hatte ich nicht erwartet. Er kopiert Bloody George bis ins letzte Detail, nur seine Fehler wiederholt er nicht, sonst hätte er sich die Handschuhe gespart und seine Fingerabdrücke an der Wand und auf dem Messergriff hinterlassen.« Sie machte Anstalten, zu ihren Kollegen zurückzukehren. »Falls wir wider Erwarten doch noch was finden sollten, rufe ich Sie an.« Sie rang sich noch einmal zu einem Lächeln durch. »Ich nehme an, Sie überlassen es dem NYPD, die Angehörigen des Toten zu informieren.«
»Großzügig, wie wir sind«, ergänzte ich mit einem ebenso falschen Lächeln.
»Dachte ich mir.« Sie verabschiedete sich mit einer Handbewegung und kehrte zur Leiche des Priesters zurück.
***
Der Tunnel war so eng, dass wir uns im Gänsemarsch hindurchquälen mussten. Ich vornweg, die Taschenlampe in der rechten Hand, Phil hinter mir, ebenfalls mit einer Taschenlampe ausgerüstet.
Die Lichtkegel tanzten über die grob behauenen und mit Brettern abgesicherten Wände. Einige Ratten huschten über den nassen Boden. Bestialischer Gestank schlug uns entgegen. Es stank nach Abfall, Kot und Urin. Eigentlich hätten wir eine Gesichtsmaske für unseren Tunnelgang gebraucht, so wie die Helfer in den Katastrophengebieten.
»Und das an einem sonnigen Frühlingsmorgen«, lästerte Phil.
Ich blieb stehen und leuchtete mit der Taschenlampe nach vorn. Die wenigen Fußspuren waren so undeutlich, dass selbst die Cops der Crime Scene Unit nichts gefunden hätten. Die Abdrücke konnten genauso gut von einem Obdachlosen oder einem Junkie stammen.
»Und du bist sicher, dass er den Tunnel genommen hat?«, fragte Phil. »Über den Vorderausgang hätte er sich leichter getan … und wir auch. Wieso tut er sich das an? Nur weil er den Mord von Bloody George nachstellen will?«
»Alle anderen Details stimmen. Die Messerstiche, das Messer, der Handabdruck … warum sollte er ausgerechnet beim Tunnel einen Rückzieher machen? Der Kerl ist besessen. Ein Verrückter, der sich Bloody George zum Vorbild genommen hat. Der uns glauben machen will, dass George Atkinson von den Toten auferstanden ist und seine Morde von damals wiederholt.«
»Oder ein ganz raffinierter Dreckskerl, der das ganze Theater nur veranstaltet, um uns auf eine falsche Spur zu locken. Wäre nicht das erste Mal, dass ein Verbrecher so was versucht.«
Wir gingen langsam weiter und erreichten wenige Minuten später das Ende des Tunnels. Auch dort versperrte eine schwere Holztür den Ausgang. Sie war seltsamerweise unverschlossen.
Dahinter lag ein dunkler Kellerraum, in dem seit hundert Jahren niemand mehr gewesen zu sein schien. Außer unserem Killer, wenn ich mit meinem Verdacht richtig lag, und der hatte auch hier keine Spuren hinterlassen. Lediglich das mit Gerümpel gefüllte Regal, das den Ausgang versperrt hatte, war verrückt worden. Wir stiegen über einige Kisten mit verstaubten Flaschen hinweg und blieben abwartend stehen.
Kein Laut außer dem leisen Summen einer Heizung war zu hören. Als wir die Lichtkegel unserer Taschenlampen durch den Raum wandern ließen, sahen wir mit Gerümpel vollgestopfte Regale, alte Autoreifen, Blechteile und einen mit getrockneten Farbflecken verschmierten Plastikeimer. Unter einem der Regale lugte eine Ratte hervor und starrte wie hypnotisiert ins Licht.
Auch die Kellertür aus festem Metall war nicht verriegelt. Wir landeten in einem dunklen Flur mit kahlen Wänden und entdeckten einen Treppenaufgang, der von einem schwach glimmenden Notlicht beleuchtet war. Die nackten Stufen lagen wenig einladend vor uns.
Ich steckte die Taschenlampe weg und zog meine Pistole. »Falls der Mörder noch in der Nähe ist«, flüsterte ich. »Bei diesen Verrückten weiß man nie.«
Phil ging ebenfalls auf Nummer sicher und vertauschte seine Taschenlampe mit der SIG. Die Pistolen schussbereit in den Händen, stiegen wir so leise wie möglich die Treppe hinauf. Es gab keine Fenster, das einzige Licht kam von den trüben Notlampen.
Im Parterre wartete eine weitere Metalltür. Ich zog sie vorsichtig auf und blickte in einen langen Flur, der mich an ein schmuddeliges Hotel erinnerte. Der Boden war mit einem schmutzigen Teppich von undefinierbarer Farbe bedeckt. An den Decken leuchteten fahle Lampen. Zu beiden Seiten gingen nummerierte Türen ab. Zu sehen war niemand.
Wir traten in den Flur und schlossen vorsichtig die Metalltür hinter uns. Ein schäbiges Hotel, sagten mir die nummerierten Türen, oder eines der Seniorenheime, die ihr Geld nicht wert sind, der auffälligen Stille nach zu urteilen.
Wenige Sekunden später wurden wir eines anderen belehrt. Ein verzweifelter Schrei drang aus einem der Zimmer. Der Schrei eines Mannes, der sich in höchster Gefahr zu befinden schien.
Der Killer? Hatte er sich in einem der Zimmer verkrochen und den Bewohner in der Mangel? Ich hatte keine Ahnung, was vor fünfzig Jahren in diesem Gebäude gewesen war, vielleicht ein Hotel, in dem Bloody George einen Gast in die Mangel genommen oder gezwungen hatte, ihm bei der Flucht zu helfen. Wir hätten uns die Akte des Killers genauer ansehen sollen, bevor wir in den Fluchttunnel gekrochen waren.
»Nummer 7«, erkannte Phil.
Die Zimmertüren waren älter als fünfzig Jahre und lange nicht so massiv wie heute. Kein Problem, sie einzutreten, ohne sich dabei den Fuß zu brechen.
»Wie im Kino«, triumphierte Phil, während er den rechten Fuß hob. »Endlich mal.« Er trat mit voller Wucht gegen die Tür von Zimmer 7 und rief: »FBI! Hände hoch!« Die Tür schlug mit voller Wucht gegen die Wand, löste sich von den Angeln und knallte vor dem breiten Bett auf den schmutzigen Veloursteppich.
Wir stürmten mit angelegten Pistolen in das Zimmer und richteten sie auf den Mann und die Frau auf dem Bett. Der Mann lag mit Handschellen gefesselt auf dem schwarzen Laken, die Frau, von Kopf bis Fuß in ebenso schwarzes Leder gekleidet, kniete mit einer mehrschwänzigen Peitsche über ihm und war wohl gerade dabei, ihn zu züchtigen. Beide starrten uns entsetzt an.
Man brauchte kein Hellseher zu sein, um zu erkennen, wo wir gelandet waren. Das Gebäude, in dem der Tunnel endete, war ein Stundenhotel! Und in Zimmer 7 vergnügte sich ein Sado-Maso-Anhänger mit einer Leder-Lady.
»Und für so was zahlen Sie Geld?«, fragte Phil den entsetzten Freier. »Um sich von einer schwarzen Katze den Hintern versohlen zu lassen? Und ich dachte immer, Sex wäre was Schönes.«
»Nicht zu fassen«, stimmte ich Phil zu, »wie viel haben Sie dafür bezahlt?«
Die Leder-Lady deutete mit ihrer Peitsche auf uns. »Seid ihr tatsächlich vom FBI oder zieht ihr hier nur ’ne schräge Nummer ab? Wenn ihr glaubt, ich mach’s euch umsonst, weil ihr mir wie zwei Fernsehcops die Tür eintretet, habt ihr euch nämlich geschnitten.«
Wir steckten die Waffen weg und zeigten ihr unsere Ausweise. Unser betretenes Lächeln war echt. Mit dem Auftritt hätten wir in jeder Comedy mitmachen können. So lächerlich hatten wir uns schon lange nicht mehr gemacht.
Um die Situation wenigstens einigermaßen zu retten, sagte ich: »Keine Angst, wir sind nicht von der Sitte. Wenn der Herr so großen Wert darauf legt, von Ihnen gezüchtigt zu werden, ist das sein Problem. Vorausgesetzt, die Sache geschieht im gegenseitigen Einvernehmen. Wir suchen einen Mörder.«
Sie grinste schelmisch. »Hier ist keiner vorbeigekommen.« Sie hob die Peitsche. »Darf ich jetzt weitermachen?«
»Meinetwegen«, antwortete ich.
***
Wir machten, dass wir wegkamen, und liefen zur Rezeption. Hinter dem L-förmigen Tresen saß ein weißhaariger Mann auf einen Stock gestützt und starrte auf den kleinen Fernseher auf dem Schreibtisch. Eine Game Show, bei der man die Preise bestimmter Waren erraten musste. »Haben Sie das gesehen?«, fragte er, ohne uns anzublicken. »Zu meiner Zeit kostete die Dosensuppe keine zwanzig Cent. Heute zahle ich dafür ein halbes Vermögen.«
Wir verzichteten darauf, dem Alten unsere Ausweise zu zeigen. So dicht, wie er trotz seiner Brille vor dem Fernseher saß, hätte er sie sowieso nicht lesen können. »Wie lange machen Sie den Job schon?«, wollte ich wissen.
»Zwanzig Jahre, Mister. Als der Laden noch vornehm war, saßen hier hübsche Frauen, aber das ist lange her.« Erst jetzt bequemte er sich, uns anzusehen. »Cops, hab ich recht? Für Typen wie euch hab ich einen Riecher.«
»FBI«, verbesserte ich. »Sie vermieten die Zimmer stundenweise, was?«
»Ist das verboten?«
»Unter gewissen Umständen schon. Aber deswegen sind wir nicht hier. War das Gebäude schon immer ein Hotel?«
»Seit vierzig Jahren und ein paar zerquetschten.« Er kicherte leise in sich hinein, als der Moderator den wahren Preis der Dosensuppe nannte. »Damals war das Palace ein ehrenwertes Haus.«
Was nur bedeuten konnte, dass sich inzwischen leichte Mädchen im Palace eingenistet hatten und dort ihre anspruchsvollen Kunden bedienten. Nicht gerade legal, wenn man es mit den Gesetzen genau nahm, aber für solche Spitzfindigkeiten hatten wir keine Zeit.
»Und was war vorher hier drin?«
Er hatte sich wieder dem Fernseher zugewandt und drehte sich noch einmal um. Aus dem Kichern war ein Grinsen geworden. »Sie werden lachen, das Palace war so eine Art Kloster. Hier wohnten jede Menge Pfaffen, die lasen ständig in der Bibel und beteten rund um die Uhr. Ein Scheißleben, was?«
Wie man’s nimmt, dachte ich. Zwanzig Jahre am Empfang eines Stundenhotels zu sitzen war auch nicht gerade prickelnd. »Wer war heute Nacht hier?«
»An der Rezeption? Na, wer wohl? Ich sitze Tag und Nacht hier, Mister. Wenn ich müde bin, mach ich ein kleines Nickerchen, und dann geht’s weiter. Nur nachmittags von zwei bis sechs, da gehe ich auf mein Zimmer.«
»Heute Nacht um kurz nach Mitternacht«, fragte ich ihn, »haben Sie da jemand aus dem Hotel kommen sehen, einen Mann, der nicht hierhergehörte?«
»Um kurz nach Mitternacht?« Er kicherte verstohlen. »Um die Zeit geht’s hier zu wie in einem Taubenschlag. Da geben sich die Mädels und ihre Freier die Klinke in die Hand. Wie soll ich da jemand erkennen? Die Typen, die hier aufkreuzen, wollen doch alle nicht dazugehören. Nee, ich kann mich nicht erinnern. Suchen Sie den Kerl, der Father Timothy abgemurkst hat? Kam gerade im Fernsehen, vor der Game Show. Nee, der war bestimmt nicht hier. Warum auch? Meinen Sie, der lässt sich von einer Lady verprügeln, bevor er das Weite sucht? Mann, ihr habt Nerven!«
Anscheinend wusste er nichts von dem Fluchttunnel, oder er hatte ihn aus seinem Gedächtnis verbannt. »Danke, Mister. Sie haben uns sehr geholfen.«
Was eine dreiste Lüge war, denn er hatte uns keinen Schritt weitergebracht.
Ganz im Gegensatz zu Phil, der vor dem Hotel gegen eine Mülltonne stolperte, sich die Ohren zuhielt, als der Deckel zu Boden schepperte, und beim Anblick des Inhalts einen Pfiff ausstieß.
»Eine Ratte?«, wunderte ich mich.
»Die Handschuhe des Killers.« Er hielt grinsend ein Paar blutverschmierte Latex-Handschuhe hoch und ließ sie in einen Plastikbeutel gleiten. »Das beweist zumindest, dass der Täter tatsächlich den Tunnel genommen hat.«
Ich betrachtete die Beweisstücke mit einem lachenden und einem weinenden Auge. »Nur schade, dass an den Dingern keine Fingerabdrücke haften bleiben. Die nützen uns überhaupt nichts.«
***
Zum Lunch begnügten wir uns mit Sandwiches und Kaffee. Beides nahmen wir im Stehen in einer trendigen Bäckerei ein, die sich Baker’s Bistro nannte und mit dem Namen wohl auch die Preise nach oben korrigiert hatte.
Während ich einen Bissen mit heißem Kaffee runterspülte, klingelte mein Handy, und Lieutenant Shelby Cameron überraschte mich mit der Neuigkeit, dass Bloody Georges Sohn und dessen Frau schon vor einigen Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren, sein Enkel aber am Leben war. Er hieß ebenfalls George und wurde vom Einbruchsdezernat des NYPD verdächtigt, an mehreren Raubzügen in Brooklyn teilgenommen zu haben. Bisher hatte man ihm aber nichts beweisen können. »George Atkinson Jr.«, sagte sie. Sie gab mir seine Adresse und seinen Arbeitgeber durch, eine Möbelfabrik im Südwesten von Brooklyn. »Ich hab mit den Kollegen vom Einbruch gesprochen, er müsste auf der Arbeit sein.«
Ich bedankte mich, klärte Phil auf und trank meinen Kaffee aus. Wenig später saßen wir im Jaguar und fuhren ins Hafenviertel. Watkins Furniture bestand aus einer Bürobaracke, einer Werkshalle und einer Lagerhalle, die jeden Frachter in der Bucht überragte.
Vor dem Bürogebäude stiegen wir aus. Wir hatten nicht vor, den Enkel des Serienkillers in Sippenhaft zu nehmen, wollten ihn lediglich befragen. Vielleicht hatte er eine Ahnung, welcher Irre die Taten seines Großvaters nachstellte.
In der Baracke, die aus einem umgebauten Container bestand, erwartete uns eine beleibte Schwarze mit einer altmodischen Dauerwelle und knallroten Fingernägeln. Sie schenkte uns ein übertriebenes Lächeln. »Sie müssen die Herren von der Kaufhauskette sein …«
»FBI, Special Agents Decker und Cotton«, musste ich sie enttäuschen. Wir zückten unsere Ausweise. »Wir suchen einen gewissen George Atkinson.«
Sie wusste, von wem wir redeten. »Ja, der arbeitet bei uns. Einer unserer Lagerarbeiter. Die große Lagerhalle gegenüber. Er fährt einen Gabelstapler.«
Wir waren bereits an der Tür, als sie fragte: »Die Cops waren auch schon hier. Er hat doch nichts ausgefressen?«
»Wir haben nur ein paar Fragen, Miss«, speiste ich sie mit einer unserer Standardausreden ab. »Da drüben?«
»Ja, Sir, die große Halle.«
Wir überquerten den kiesbedeckten Hof und genossen für einen Augenblick den ungewohnt blauen Himmel und die frühlingshafte Sonne. Wäre die Lagerhalle nicht gewesen, hätten wir die Skyline von Manhattan im strahlenden Sonnenschein sehen können – auch für Einheimische kein alltäglicher Anblick.
In der Halle sahen wir uns einem riesigen Holz- und Teilelager gegenüber. Bis zum hohen Giebeldach ragten die Regale mit Kleinmöbeln und Brettern in allen Größen und Längen empor. Zwischen den Regalen schwirrten die Gabelstapler wie geschäftige Ameisen umher. Ein ständiges Rattern und Summen hing in der Luft, kam vor allem von der Hydraulik, welche die beweglichen Regale nach oben oder unten gleiten ließ. Eine elektronische Anzeigetafel verriet, welche Teile jeweils für die Möbelfertigung gebraucht wurden.
»Wir suchen George Atkinson«, rief ich einem Arbeiter zu. »Wissen Sie, wo er ist?« Ich zeigte ihm meinen Ausweis.
»FBI?«, erschrak er vor den ominösen drei Buchstaben. »Sagen Sie bloß, er hat was auf dem Kerbholz? Würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, so wie der sich manchmal benimmt. Der ist nervöser als meine Grandma.«
»Wir haben nur ein paar Fragen.« Wieder diese blöde Ausrede, die einem kaum einer glaubte. »Er ist doch hier?«
Der Arbeiter nickte. »Reihe F, ganz am Ende. Der mit der Baseballkappe.«
Wir bedankten uns bei dem Mann und gingen zur Reihe F. Dort lagen vor allem Kleinmöbel, meist Kommoden und kleine Schränke. George saß auf seinem Gabelstapler und schickte sich gerade an, eine Kommode zu laden.
»George Atkinson?«, rief ich laut.
Ich hatte eigentlich gedacht, der Bursche würde sich umdrehen und seelenruhig darauf warten, bis wir ihn erreicht hatten, doch weit gefehlt. Kaum hatten wir unsere Ausweise gezückt und setzten zu einem freundschaftlichen Spruch an, gab er Gas und bretterte mit seinem Gabelstapler auf uns zu. Als wollte er uns mit den eisernen Gabeln wie lästige Käfer aufspießen und gegen einen Schrank oder eine Kommode drücken.
Wir sprangen wie vor einem angreifenden Rhinozeros zur Seite und entgingen dem unerwarteten Angriff um Haaresbreite. Phil stieß mit dem Kopf gegen einen Bretterstapel, stürzte und blieb benommen liegen. Ich hatte mehr Glück, war sofort wieder auf den Beinen und musste zähneknirschend mit ansehen, wie George Jr. verschwand.
Ich zog meine Pistole und rannte hinter ihm her. »FBI! Bleiben Sie stehen!«, rief ich wütend. »So kommen Sie sowieso nicht weit! Bleiben Sie stehen!«
Er dachte gar nicht daran, lenkte seinen Gabelstapler in die Hauptgasse und hielt auf die Ladebuchten an der Südseite zu. Dort dockten die Trucks zum Beladen an. Als ich die Hauptgasse erreicht hatte, war er schon beinahe am Ziel. »Anhalten! Halten Sie an!« Ich wurde langsam wütend.
Ich sprang auf einen der vorbeifahrenden Gabelstapler, stieß den verwunderten Fahrer vom Sitz und ergriff selbst das Steuer. »Tut mir leid!«, rief ich, als ich sah, wie der Fahrer auf seinem Hintern landete. »Ich bin vom FBI.«
Als ob ihn das die Bohne interessierte. Ich hatte jedoch andere Sorgen, als ihn zu bedauern, trat das Gaspedal bis zum Anschlag durch, ohne dass die Kiste nur einen Deut schneller wurde.
George erreichte weit vor mir die Ladebuchten, sprang vom Stapler und durch die offene Ladeluke ins Freie. Einige der Männer, die bei den Trucks arbeiteten, blickten ihm verwundert nach. Zwei Arbeiter lachten höhnisch.
Wenige Sekunden später galt ihr Lachen mir. Ich geriet dicht vor der Luke mit dem ungewohnten Gefährt ins Schleudern, raste gegen einen Bretterstapel und fiel im hohen Bogen vom Sitz. Ich hatte so viel Schwung, dass ich über den glatten Boden rutschte und durch die Luke ins Freie stürzte.
Zum Glück fiel ich nicht besonders tief, keine fünf Fuß, und landete auf einem Stapel zerrissener Kartons und zerpflückter Holzwolle. Schmerzhaft war es trotzdem. Ich stemmte mich ächzend vom Boden hoch und sah die beiden lachenden Arbeiter in der Luke stehen.
»Gar nicht so einfach, einen Gabelstapler zu fahren, was?« Die Typen amüsierten sich köstlich. »Was fahren Sie denn sonst? Oder lassen Sie fahren? Eine von diesen teuren Limousinen?«
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. »Was Offizielles«, antwortete ich. »Und wenn Sie nicht sofort zu kichern aufhören, lasse ich Sie einsperren!« Ich zog grinsend meinen Ausweis. »Wo ist George hin?«
»FBI?«, staunte der eine. »Wow!«
Der andere zeigte mehr Verständnis für mich. »An der Bürobaracke vorbei und zur Straße rauf. Mehr kann ich auch nicht sagen. Was meinst du, Chris?« Er blickte seinen Kumpel an.
»Ich weiß nicht. Keine Ahnung.«
***
Ich war bereits unterwegs und rannte an der Bürobaracke vorbei. Mein linker Unterarm schmerzte höllisch. Wahrscheinlich eine Prellung vom Sturz. Ein paar zerrissene Kartons und etwas Holzwolle ersetzten kein Sprungnetz.
Auf der Straße oberhalb der Möbelfabrik war wenig los. Ein Lieferwagen und zwei Personenwagen fuhren zur Hauptstraße und bogen nach Norden ab, auf dem Gehsteig unterhielten sich zwei Männer, die keinerlei Ähnlichkeit mit George hatten. Ein struppiger Hund, der an einer Hauswand stehen blieb, hob ungeniert das Bein und lief weiter.
Ich nahm an, dass George zur Hauptstraße gelaufen war, und rannte den halben Block hinter dem Lieferwagen und den beiden Personenwagen her. An der Ampel blieb ich stehen und blickte die Straße hinauf. Auch hier herrschte wenig Verkehr. Von George war weit und breit nichts zu sehen. Er musste sich irgendwo versteckt haben.
An seiner Stelle hätte ich mich in einen der Hausflure verkrochen. In den meisten dieser alten Häuser gab es Hintertüren, die ihm zur problemlosen Flucht verhelfen würden. Nur hinter welcher der zahlreichen Türen war er verschwunden? Ich fing mit dem Haus gegenüber an. Dort sah ich einige Bewohner an den Fenstern. Wenn er irgendwo reinkommen wollte, brauchte er jemand, der ihm die Haustür öffnete.
Ich tat das, was er getan haben musste, und drückte auf ein paar Klingeln gleichzeitig. Statt des erhofften Summers ertönte die wütende Stimme einer älteren Frau. Ich blickte am Haus empor und sah sie im dritten Stock aus dem Fenster lehnen. »Was fällt Ihnen ein, das ganze Haus mit Ihrem blöden Geklingel aufzuscheuchen? Wir kaufen nichts, und einer bescheuerten Sekte trete ich auch nicht bei. Lassen Sie uns gefälligst in Ruhe! Verschwinden Sie!«
»Tut mir leid, Ma’am. Ich wollte …«
Das Fenster knallte zu, und ich stand weiter vor verschlossener Tür. Die anderen Mieter hatten erst gar nicht reagiert. Dies war nicht die beste Gegend, und man spähte erst mal aus dem Fenster, bevor man auf den Knopf drückte. Wenn man jemand nicht kannte, blieb die Tür zu. Das war meistens gesünder.
Wenn es George ähnlich gegangen war, musste er sich irgendwo anders versteckt haben. Bis zur nächsten Kreuzung konnte er es in der kurzen Zeit nicht geschafft haben, und ein Taxi verirrte sich selten in die Hafengegend.
Mein Blick fiel auf ein kleines Pornokino. Es gab sich so unscheinbar, dass ich es beinahe übersehen hätte. Ein Schaukasten mit dem Foto einer Pornodarstellerin, die heiklen Stellen mit schwarzen Balken verdeckt, und das obligatorische XXX … Die heißesten Filme der Stadt … Ständig Einlass … Rabatt für Seeleute und Marinesoldaten, mehr war nicht. Die Kasse lag versteckt in dem dunklen Hauseingang.
Hinter der Glasscheibe saß eine ältere Lady und strickte an einem Pullover. Dabei starrte sie ähnlich konzentriert auf ihren kleinen Fernseher wie der alte Mann in der Absteige. Vielleicht waren die beiden verheiratet. »Sieben Dollar«, verlangte sie, ohne mich anzublicken.
Ich zog meinen Ausweis. »FBI. Ist hier gerade ein Mann reingegangen?«
»Hier gehen nur Männer rein.«
»Um die vierzig, dunkle Haare, braune Augen, abstehende Ohren … er trug einen blauen Overall der Möbelfabrik.«
Sie hielt den Blick auf den Fernseher gerichtet. »Keine Ahnung. Ich seh mir die Typen, die hier reingehen, selten an. Solange sie zahlen, ist alles gut.«
»Dann sehe ich mal nach …«
»Macht sieben Dollar, Sir.«
»FBI, Special Agent Jerry Cotton …«
»Und wenn Sie der Präsident höchstpersönlich wären … ohne Eintritt kommen Sie nicht rein. Seit es DVDs gibt, geht kaum noch jemand ins Kino, und ich bin auf jeden Dollar angewiesen.«
Ich zahlte widerwillig, verzichtete auf eine Quittung, die Mr High sowieso nicht abgezeichnet hätte, und betrat das Kino. Im Gang blieb ich stehen, bis sich meine Augen an das Halbdunkel gewöhnt hatten. Auf der Leinwand mühte sich ein Kerl mit zwei heißen Bräuten ab, im Zuschauerraum saßen zehn Gestalten und träumten davon, bei dem flotten Dreier mitzumachen.
George erkannte ich an seinen abstehenden Ohren, die sich deutlich gegen die helle Leinwand abzeichneten. Ich setzte mich hinter ihn, zog ihm die Hände auf den Rücken und legte ihm Handschellen an. Nachdem ich mein Sprüchlein aufgesagt hatte, stand ich auf und zog ihn zum Ausgang. Auf der Leinwand stöhnte der Kerl mit seinen Bräuten um die Wette, als wir das Kino verließen. Wir sahen beide nicht hin.
***
»Hey, was soll das?«, beschwerte er sich auf der Straße. »Ich hab nichts getan.«
»Und warum laufen Sie dann weg? Sie haben ein schlechtes Gewissen, George, hab ich recht? Weil Sie Angst haben, dass Ihnen die Kollegen vom Einbruch auf die Schliche kommen.«
»Ich bin unschuldig.«
»Den Spruch kenne ich, George. Dabei habe ich nur ein paar Fragen an Sie. Ich bin vom FBI, nicht vom Einbruchsdezernat. War also vollkommen überflüssig, vor mir wegzurennen. Jetzt muss ich Sie wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt festnehmen, und Ihren Job in der Möbelfabrik sind Sie wahrscheinlich auch los. Warum haben Sie nicht auf uns gewartet? Wir hätten Ihnen ein paar Fragen gestellt und wären wieder weg gewesen.« Ich schob ihn die Straße hinunter und zur Fabrik zurück.
»Sie sind vom FBI?«, dämmerte es ihm erst jetzt. Er blickte mich aus großen Augen an. »Was denn für Fragen?«
»Sie haben von dem Mord gehört? An dem Priester in der Holy Trinity Church? Zwei Messerstiche ins Herz, das Messer in der Kehle, ein blutiger Handabdruck an der Wand … kommt Ihnen das nicht bekannt vor, George?«
Er blieb abrupt stehen. Seine Überraschung war nicht gespielt. »Mein Großvater … so hat mein Großvater diesen Priester ermordet. Aber das ist fünfzig Jahre her. Da will ihn einer kopieren.« Er stutzte. »Hey, Sie glauben doch nicht etwa … nur weil ich sein Enkel bin, komm ich noch lange nicht auf die Idee, einen Priester umzubringen.«
»Das hat ja auch niemand behauptet«, beruhigte ich ihn. »Trotzdem muss ich Sie fragen: Wo waren Sie gestern Nacht zwischen 23 und 1 Uhr? Haben Sie ein Alibi, George?«
»Ich war unterwegs.«
Ich konnte mir denken, was er damit meinte. »Auf Diebestour? Und jetzt sagen Sie bloß, Sie haben Zeugen dafür.«
»Ich war spazieren, Mann! Das mache ich oft, wenn ich nicht schlafen kann. Ich bringe keine Menschen um.«
»Können Sie sich denn vorstellen, wer es getan haben könnte? Hat Sie jemand in letzter Zeit auf die Tat Ihres Großvaters angesprochen? Ist der Mord sonst wie zur Sprache gekommen? In der Möbelfabrik? In einer Bar?«
Er schüttelte den Kopf. »Nee. Die jungen Leute wissen nichts von dem Mord, und die alten können sich nicht mehr daran erinnern. So ein toller Hecht war Grandpa nun auch wieder nicht. Al Capone, Dillinger, Machine Gun Kelly … an die erinnert man sich.«
»Gehen Sie in die Kirche, George?«
»Um einen Priester umzubringen?« Er lachte. »Ich gehe nicht mal sonntags in die Kirche. Hab ich keinen Bock drauf. Mir reicht’s, wenn ich einen dieser Prediger im Fernsehen sehe.«
Wir hatten die Möbelfabrik erreicht und sahen zwei Polizeiwagen vor der Bürobaracke stehen, einen zivilen und einen Streifenwagen. Zwei Uniformierte und zwei Detectives warteten auf uns.
Phil hatte sich von seinem Sturz erholt und trug ein Pflaster auf der Stirn. Er hielt eine Schachtel mit Schmuck in den Händen. »Hab ich in seinem Spind gefunden. Er dachte wohl, hier läge sie sicher. Die Detectives Snyder und Ross sind vom Einbruchsdezernat und warten schon seit einigen Wochen darauf, ihn endlich festnehmen zu können.«
Ich wandte mich an den entsetzten George. »Pech gehabt, George. Wegen der Einlage vorhin hätten wir Sie vielleicht laufen lassen, aber das ist wohl ein bisschen zu viel.« Ich schob ihn den beiden Detectives zu. »Er gehört Ihnen. Mit freundlicher Empfehlung des FBI …«
***
Es dämmerte bereits, als wir die Holy Trinity Church erreichten. Lieutenant Cameron und ihre Leute hatten den Tatort verlassen, und nichts erinnerte mehr an den Trubel vom frühen Morgen. Wir parkten direkt vor der Kirche.
Niemand hätte etwas dagegen gehabt, wenn wir um diese Zeit beim Abendessen in einem Coffee Shop gesessen hätten und anschließend um die Häuser gezogen wären, auch FBI Agents stand der Feierabend zu. Doch ich hätte nicht Mr Highs Gesicht sehen wollen, wenn wir es tatsächlich getan hätten. Und was er dann zu uns gesagt hätte, wollte ich noch weniger hören.
Denn besonders weit waren wir bei unseren Ermittlungen noch nicht gekommen. Wir hatten dem NYPD die Arbeit abgenommen und einen kleinen Dieb festgenommen, hatten aber keine Ahnung, wer hinter dem Mord an Father Timothy steckte. Father William, der zweite Pater der Kirche, sollte uns weiterhelfen.
Ein Wegweiser mit der Aufschrift Pfarrhaus wies auf einen bogenförmigen Durchgang neben der Kirche. Gerade als ich klingeln wollte, ging die Tür auf, und eine Dame mittleren Alters trat uns entgegen. Sie trug einen roten Hut mit Feder wie die Ladys in den Fifties.
»Oh«, erschrak sie. »Sie wollen sicher zu Father William. Ich weiß nicht, ob er Zeit hat. Er bekommt gleich Besuch von einem der zukünftigen Ministranten …«
»Sind Sie die Haushälterin?«
»Rosa Parker«, stellte sie sich vor. »Ja, ich arbeite schon seit einigen Jahren bei Father William und Father Timothy … Gott sei ihm gnädig. Sie haben von dem furchtbaren Mord gehört?«
»Deshalb sind wir hier, Ma’am. Wir sind vom FBI.« Wir zeigten ihr unsere Ausweise. »Special Agents Decker und Cotton. Wir haben noch ein paar Fragen an Father William. Er will doch sicher auch, dass wir den Mörder finden.«
Sie lächelte. »Natürlich, Sir, wir alle wollen das. Brauchen Sie mich dazu?«
»Nein, Ma’am. Wir kommen schon zurecht.« Ich erwiderte ihr Lächeln. »Sie haben heute wohl Ihren freien Abend?«
»Jeden Mittwoch«, erwiderte sie, »da treffe ich mich mit meinen Freundinnen. Heute wollte ich eigentlich hierbleiben, wegen des Mordes, Sie wissen schon, aber Father William bestand darauf, dass ich meinen freien Abend einhalte. Er ist ein netter Mann.«
Ich sah, dass sie es eilig hatte, wollte sie aber nicht ohne ein paar Fragen gehen lassen. Als Haushälterin wusste sie sicher am besten über die Situation in der Holy Trinity Church Bescheid. »Haben Sie eine Ahnung, wer Father Timothy ermordet haben könnte, Ma’am? Hatte er Feinde? Wurde er bedroht? Gab es böse Briefe, weil irgendjemand seine Predigt nicht gefallen hat? Wissen Sie irgendetwas, das uns weiterhelfen könnte, Ma’am?«
Sie schüttelte bedächtig den Kopf. »Father Timothy hatte keine Feinde. Warum auch? Er war ein so lieber und anständiger Mensch. Sicher waren nicht alle Gemeindemitglieder mit jeder Predigt einverstanden, aber Feinde? Ein Priester, der wie kein anderer das Wort Gottes achtet und nach den Idealen des Christentums lebt, hat doch keine Feinde. Er verstand sich wunderbar mit den Menschen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, warum ihn jemand umbringen wollte. Das muss ein Irrer gewesen sein, ein Psychopath.«
»Und Father William?«, fragte ich vorsichtig. »Ist er genauso … untadelig?«
Sie bemerkte wohl den zweifelnden Unterton in meiner Stimme und brauste auf: »Sie glauben doch nicht, dass er etwas mit dem Mord zu tun hatte? Father William ist ein gottesfürchtiger Mensch und verstand sich großartig mit Father Timothy. Für ihn würde ich die Hand ins Feuer legen. Ich lasse nicht zu, dass Sie ihn auf diese Weise …«
»So war es doch gar nicht gemeint«, bremste ich sie mit einer kleinen Notlüge. »Ich wollte Sie nur nach Ihrer Meinung über Father William befragen. Ich hatte keinesfalls die Absicht, ihn zu beschuldigen. Aber wir müssen uns bei jeder Ermittlung ein Bild vom Umfeld des Opfers machen. Oft helfen uns bereits Kleinigkeiten weiter.« Ich lächelte aufmunternd. »Er ist ein gottesfürchtiger Mensch, sagen Sie. Hatte er Feinde?«
»Alles, was ich über Father Timothy gesagt habe, gilt auch für Father William«, erwiderte sie wieder etwas ruhiger. »Er sieht sein Priesteramt als echte Berufung und versteht sich ganz hervorragend mit der Gemeinde, außer …«
»Außer?«, hakte ich nach.
»Nun ja, einmal gab es einen riesigen Krach mit den Eltern eines Ministranten. Ist schon einige Wochen her. Ich hörte, wie Father William sich heftig mit ihnen stritt. So kannte ich ihn gar nicht.«
»Um was ging es denn?«
»Keine Ahnung. Ich verstand kein Wort, und als ich den Raum betrat, gingen die Eltern wieder. Mister und Mistress Johnston. Sie halten sich gerade in Europa auf. Sie wollen ihren Sohn in einem Schweizer Internat unterbringen.«
»Den Ministranten?«
»Joey«, bestätigte sie. »Seine Eltern sind sehr wohlhabend. Er ist Arzt. Sonst könnten sie sich so ein teures Internat im Ausland gar nicht leisten. Ich nehme an, darum ging es auch bei dem Streit. Father William setzt sich seit vielen Jahren für die intakte Familie ein. Er fand es sicher nicht gut, dass die Johnstons ihren Sohn in ein Internat stecken wollen. Er möchte, dass eine Familie zusammenbleibt.« Sie blickte auf ihre Uhr. »So, jetzt muss ich aber gehen, sonst komme ich noch zu spät.«
»Vielen Dank, Ma’am«, erwiderte ich. »Sie haben uns wirklich sehr geholfen.« Diesmal stimmte es tatsächlich.
***
Die Sonne ging gerade unter, als wir durch den Torbogen gingen und den durch die benachbarte Schule, das Pfarrhaus und eine hohe Mauer begrenzten Hof hinter der Kirche betraten. Zwei mächtige Eichen wuchsen auf der Wiese neben der Mauer, und vor dem zweistöckigen Pfarrhaus erstreckten sich die Beete eines Gemüsegartens. Einige Büsche mit üppigen Blüten gediehen im Schatten der Kirchtürme.
Im Parterre des Pfarrhauses brannte Licht. Wir erkannten Father William, der bis auf den Priesterkragen zivil gekleidet war und unruhig auf und ab lief. Der Mord machte ihm wohl zu schaffen. Oder war er nur nervös, weil er einen angehenden Ministranten erwartete?
»Vielleicht bin ich ungerecht«, sagte Phil, »aber irgendwie werde ich nervös, wenn mir jemand sagt, dass ein Priester einen jungen Ministranten erwartet.«
Ich blieb zögernd stehen. »Mir geht’s genauso. Die Haushälterin schöpft anscheinend keinen Verdacht, aber was heißt das schon? Sie würde nicht mal zugeben, dass einer ihrer Pater eine Sünde begangen hat, wenn sie es mit eigenen Augen sehen würde. Was dagegen, wenn wir Räuber und Gendarm spielen und hinter dem Gebüsch warten? Der Junge muss gleich kommen.«
Tatsächlich dauerte es noch eine halbe Stunde, bis der angehende Ministrant erschien. Hinter dem Gebüsch war es nicht besonders bequem, aber ein anderes Versteck gab es nicht, und uns taten alle Knochen weh, als es im Pfarrhaus klingelte. Inzwischen war es dunkel geworden, und über der Eingangstür des Pfarrheims brannte eine altmodische Laterne. Ein kühler Wind fegte über die Mauer hinweg und verfing sich in den verwinkelten Ecken des Hofes.
Wir sahen, wie Father William das erleuchtete Zimmer verließ. Wenig später summte es an der Hoftür, und ein ungefähr zwölfjähriger Junge kam herein. Er trug Jeans, Sweatshirt und Laufschuhe und hatte blondes halblanges Haar. Father William stand bereits in der offenen Tür und begrüßte ihn.
»Jonathan! Schön, dass du kommst. Ich habe schon auf dich gewartet. Komm doch rein! Wie wär’s mit ’ner Cola und einem Stück Apfelkuchen?«
Der Junge verschwand mit dem Pater in der Wohnung und tauchte wenig später hinter dem hellen Fenster auf.
Wir schlichen geduckt zum Haus und postierten uns unter dem leicht geöffneten Fenster. Durch den Spalt drangen die Stimmen der beiden nach draußen.
»Setz dich, Jonathan.« Ich später vorsichtig über das Fenstersims und beobachtete, wie Father William verschwand und mit einer Dose Cola zurückkehrte. Auf den Kuchen verzichtete der Junge wohl. »Bevor du trinkst, wollen wir für den auf so grausame Weise zu Tode gekommenen Father Timothy beten.«
»Du weißt, was dich erwartet«, sagte Father William nach dem Gebet, als Jonathan die Cola-Dose öffnete. »Als Ministrant beginnst du einen neuen und sehr wichtigen Abschnitt deines Lebens. Denn du dienst nicht nur der Kirche, sondern vor allem Gott. In dem liturgischen Gewand, das du als Ministrant tragen wirst, bist du ein Diener Christi. Mit jeder Arbeit, die du verrichtest, rückst du Gott ein wenig näher. Ich war auch einmal Ministrant.«
Jonathan trank von seiner Coke. Er wirkte schüchterner und ängstlicher als andere Jungen in seinem Alter und in der Gegenwart des Paters gehemmt.
Father William beugte sich nach vorn und strich dem Jungen zärtlich über den Kopf. »Du bist ein guter Junge, Jonathan, das weiß ich. Komm, setz dich neben mich. Ich möchte dich in den Arm nehmen. Du hast doch nichts dagegen? Das tut man, wenn man sich mag, und du magst mich doch, oder?«
Der Junge nickte nur. Nur sehr zögernd stand er auf und setzte sich neben den Pater. Father William legte einen Arm um seine Schultern und drückte ihn an sich. »So ist es gut, Jonathan.«
***
Phil und ich verstanden uns auch ohne Worte. Der Pater rückte dem Jungen viel zu nah auf die Pelle, und es lag an uns, Schlimmeres zu verhindern.
Ich klopfte an die Haustür und rief etwas barscher als sonst: »Father William! Wir sind vom FBI! Machen Sie auf!«
Ich konnte mir gut vorstellen, wie er zusammenzuckte und rasch von dem Jungen ließ. Bleich wie ein Laken öffnete er die Tür. »Was wollen Sie von mir?«
»Nur ein paar Fragen, Father William. Dürfen wir reinkommen?« Bevor er etwas sagen konnte, drängte ich mich an ihm vorbei und betrat das Wohnzimmer. »Oh, Sie haben Besuch!«, tat ich verwundert. »Einer Ihrer Ministranten?«
Father William ahnte wohl, was ich beim Anblick eines Jungen in seiner Wohnung dachte, und erwiderte nervös: »Ja … ja … das ist Jonathan. Aber es ist ganz anders, als Sie vielleicht denken. Ich bereite ihn auf seine Ministrantenzeit vor. Ich weiß, zurzeit wird viel …«
Er blickte den Jungen an. »Ich glaube, du gehst jetzt besser nach Hause, Jonathan. Ich habe noch etwas Wichtiges mit diesen Herren zu besprechen. Die Coke kannst du mitnehmen, okay?«
Er wartete ungeduldig, bis der Junge gegangen war, und setzte noch einmal an: »Ich weiß, zurzeit wird viel über katholische Priester und ihr Verhältnis zu Ministranten gesprochen, aber ich kann Ihnen versichern, es handelt sich dabei nur um bedauerliche Einzelfälle. Ich liebe Kinder. Ich würde einem Jungen wie Jonathan nie etwas antun. Gerade ihm nicht. Er kommt aus einem gestörten Elternhaus und erfährt dort nicht die Liebe, die er eigentlich verdient. Ich versuche, sie ihm zu geben. In Gesprächen und Zuwendung.« Er hielt in seinem Vortrag inne, merkte erst jetzt, dass wir ihn gar nicht beschuldigt hatten. »Sie sind vom FBI, sagen Sie?«
Wir zeigten unsere Ausweise und stellten uns vor. »Wir sind nicht hier, um Sie über Ihr Verhältnis zu kleinen Jungen auszufragen. Obwohl Sie sicher allen Grund haben, sich deswegen Sorgen zu machen. Jonathans Eltern werden sicher nicht begeistert sein, wenn wir ihnen verraten, wo sich ihr Sohn um diese Zeit aufhält. Oder hat er seinen Eltern gesagt, dass er bei Ihnen ist?«
»Nein … doch …«, stammelte er. »Das heißt … Sie sagen ihnen doch nichts?«
»Nein«, beruhigte ich ihn, »aber ich sage der Polizei, dass sie ein Auge auf Sie werfen soll. Wenn sie noch einmal einen Jungen hier reingehen sehen, kommen Sie nicht so glimpflich davon.«
»Ich habe nichts getan.« Er zog ein Taschentuch aus seiner Hosentasche und tupfte sich den Schweiß von der Stirn. »Ich … ich meine es doch nur gut.«
Ich glaubte ihm weder das eine noch das andere. »Wo waren Sie eigentlich gestern Nacht, als der Mord geschah?«
»In meinem Bett.« Er blickte mich verstört an. »Sie glauben doch nicht …«
»Ich glaube gar nichts«, schnitt ich ihm das Wort ab. »Wir müssen das jeden fragen, der mit dem Toten in irgendeiner Weise zu tun hatte. Ich nehme an, Sie schlafen allein. Oder gibt es einen Zeugen? Schläft Ihre Haushälterin auch hier im Pfarrhaus?«
»Im ersten Stock oben.« Er fühlte sich nicht besonders wohl in unserer Gegenwart, das war ihm deutlich anzusehen. »Aber sie kann nichts bezeugen.«
»Haben Sie denn einen Verdacht, wer ihn umgebracht haben könnte?«
»Ein Geistesgestörter, wer sonst? Man liest doch jeden Tag in der Zeitung von solchen Gestörten. Psychokiller, die im Wahn unschuldige Menschen umbringen. Wer sonst käme auf die Idee, einen Mord nachzuahmen, der fünfzig Jahre zurückliegt? Genauso gut hätte es mich treffen können. Nein, Father Timothy war ein guter Mann. Ich kenne keinen, der ihm Böses wollte.«
»Okay, mehr wollten wir eigentlich gar nicht wissen.« Ich wandte mich zum Gehen und drehte mich noch einmal um. »Wo war eigentlich Father Timothy, wenn sich Ihre Haushälterin mit ihren Freundinnen traf? Ging er dann auch aus dem Haus?« Ich sah seine ungläubige Miene und erklärte: »Wir haben mit Mistress Parker vor dem Haus gesprochen.«
»Father Timothy half jeden Mittwoch in der Suppenküche am Prospect Park«, sagte er. »Ich war donnerstags dort.«
Und hatte jeden Mittwoch sturmfreie Bude, wurde ich mir klar. Aber anstatt ihn ohne einen handfesten Beweis zu beschuldigen und eine Klage zu riskieren, sagte ich: »Das war schon alles, Father William. Rufen Sie uns an, wenn Ihnen noch etwas einfällt.« Ich gab ihm meine Karte und folgte Phil, der bereits an der Tür stand und auf mich wartete.
Kaum waren wir draußen, sagte er: »Der hat was mit dem Jungen. Und nicht nur mit dem. Der steht auf Jungs, oder ich fange morgen beim NYPD an.«
»In Uniform würde ich dich gern mal sehen.« Ich grinste, wurde aber gleich wieder ernst. »Nehmen wir mal an, du hast recht, und er macht sich wirklich an Ministranten wie Jonathan ran. Und nehmen wir weiterhin an, Father Timothy war ihm auf die Schliche gekommen und drohte, die Polizei zu informieren.«
»Dann hätte Father William auch einen guten Grund gehabt, seinen Kollegen aus dem Weg zu räumen«, ergänzte Phil. »Nichts leichter als das. Man gräbt die alte Geschichte von Bloody George aus und führt die ahnungslosen Agents vom FBI in die Irre. Und während wir nach einem irren Psychokiller suchen, lacht er sich ins Fäustchen.«
Wir traten durch den Torbogen auf den Gehsteig und sahen eine dunkle Gestalt in der Kirchentür stehen. Ein Mann. Er winkte uns zu sich heran und rief mit gedämpfter Stimme: »Agents? Kann ich Sie kurz sprechen?« Und als wir näher kamen: »Ich bin Karl Berger, der Kirchendiener.« Er war ein hagerer Bursche mit kantigem Gesicht und stechenden Augen. »Kommen Sie rein. Ich hab Ihnen was zu sagen.«
Wir folgten ihm in die Kirche und blieben im Vorraum stehen. Eine trübe Notlampe brannte. Der Innenraum lag im Dunkeln, lediglich die bunten Fenster leuchteten schwach im Mondlicht.
»Woher wissen Sie, wer wir sind?«, fragte ich. »Sieht man uns das FBI an?«





























