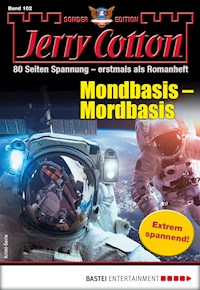
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jerry Cotton Sonder-Edition
- Sprache: Deutsch
Mondbasis - Mordbasis
Ich bin G-man, von Berufs wegen an außergewöhnliche Situationen gewöhnt.
Aber die Todesart, die sich meine Gegenspieler diesmal für mich ausgedacht hatten, war auch für hartgesottene Kerle höchst makaber.
Sie wollten mich zum Mond schießen - nur so, ohne Training, ohne Raumanzug. Und, zum Teufel, sie taten es auch!
Pech für sie - ich überlebte. Aber immerhin ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Mondbasis – Mordbasis
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelfoto: Vadim Sadovski/shutterstock
Datenkonvertierung eBook: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-7954-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Mondbasis – Mordbasis
Ich bin G-man, von Berufs wegen an außergewöhnliche Situationen gewöhnt.
Aber die Todesart, die sich meine Gegenspieler diesmal für mich ausgedacht hatten, war auch für hartgesottene Kerle höchst makaber.
Sie wollten mich zum Mond schießen – nur so, ohne Training, ohne Raumanzug. Und, zum Teufel, sie taten es auch!
Pech für sie – ich überlebte …
Die Jerry Cotton Sonder-Edition bringt die Romane der Taschenbücher alle zwei Wochen in einer exklusiven Heftromanausgabe. Es ist eine Reise durch die Zeit der frühen Sechziger bis in das neue Jahrtausend.
Mr. High, der Chef unseres New Yorker Office, ist ein feiner Kerl. Wenn ich ihn in dieser Nacht verfluchte, so lag das in erster Linie am Wetter. Ein hartnäckig andauernder Nieselregen hatte es geschafft, bis in meinen Kragen vorzudringen, und der neblige Smog über dem Hudson begann sich mir auf die Brust zu legen.
Ich stand ziemlich weit draußen auf dem Wellenbrecher des Erie Basin, eines kleineren Hafenbeckens unten in South Brooklyn. Mir gegenüber und rechts befanden sich Kais. An einigen davon lagen Schiffe. Links erstreckte sich die weite Fläche des Hudson.
Dort hinüber war es so dunkel, als ginge es direkt hinaus auf den Atlantik. Voraus und rechts konnte ich Lichter unterscheiden, die auf den Kais und den angrenzenden Straßen brannten.
Eigentlich stand ich hier wegen der Matrosen Reginald Poole und Hugh Walters. Nicht, um sie zu empfangen. Das hatte bereits ein anderer besorgt, falls es eine Hölle und ihren Boss gibt. Die beiden stammten aus Galveston und waren verdächtig gewesen, Rauschgift zu schmuggeln. Ihr Schiff, die unter liberianischer Flagge fahrende Nairobi Star, hatte am Nachmittag im Erie Basin festgemacht.
Allerdings ohne die beiden. Sie lagen seit zwei Tagen in Kühlfächern der Küstenwache von Miami. Man hatte sie mit ziemlich sauberen Kopfschüssen unweit der Florida Keys aus dem Meer gefischt.
Sicher lag das nicht im Interesse der Hintermänner, die wir in den Reihen eines der großen Rauschgiftsyndikate vermuteten. Wahrscheinlich waren die Männer an Bord der Nairobi Star ermordet und von einem Motorboot in Küstennähe übernommen worden. Bei einem Riff hatte man die Leichen, ordentlich mit Eisenstücken beschwert, ins Wasser geworfen.
Einem Festschmaus der kleinen bunten Fische und Krebse hätte nichts im Wege gestanden, wenn nicht zufällig am nächsten Morgen Sporttaucher an eben jener Stelle erschienen wären. Die Leichen verdarben ihnen den Tag, denn sie mussten notgedrungen der Küstenwache gemeldet werden. Danach kamen die Formalitäten, und die sind selbst für völlig Unbeteiligte mitunter verdammt langwierig.
Daraufhin war mir die zweifelhafte Freude zuteil geworden, die Nairobi Star in der ersten Nacht nach ihrem Einlaufen in New York zu beobachten. Wir wollten herausbekommen, ob Bekannte aus der hiesigen Unterwelt das Schiff besuchten oder ob man heiße Ware in die Siebenmillionenstadt einschmuggeln wollte.
Ich ging auf dem Wellenbrecher auf und ab und überlegte zum wiederholten Mal, wieso im August solches Dreckwetter herrschen konnte. Im Wetterbericht war von irgendwelchen Tiefs gefaselt worden, die von Labrador nach Süden ziehen und unser Wetter in den nächsten Tagen unbeständig gestalten würden. So oder so, an einem solchen Abend wäre ich gerne zu Hause geblieben.
Vom Hudson her hörte ich das leise Brummen eines schnell laufenden Bootsmotors. Dem Geräusch nach musste es ein Inboarder sein, der sich von Osten her langsam der Einfahrt zum Erie Basin näherte.
Ich ging die zwanzig Yard bis zur Spitze des Wellenbrechers.
Aus dem dünnen Nebel schälten sich langsam die undeutlichen Umrisse eines weißen Kajütbootes. Ziemlich verdächtig erschien der Umstand, dass es ohne Positionslampen fuhr. Zudem war es eine Art von Fahrzeug, wie sie in den ölverschmierten Hafenbecken höchst selten anzutreffen ist.
Ich ging in Deckung hinter einigen Fendern, die normalerweise an der Kaimauer hingen. Die gut zwei Kubikyard großen Holzbalkenbündel stanken nach allgemeiner Fäulnis und ich gab acht, sie nicht zu berühren.
Das Boot fuhr ins Erie Basin ein. Ich hörte den bereits langsame Fahrt laufenden Motor auf Leerlaufdrehzahl gehen. Das helle Kielwasser wurde unsichtbar.
Wollten die Leute auf dem Boot zur Nairobi Star? Ich nahm es an. Der rostige Frachter aus Liberia lag mit dem Heck weit weg vom Kai. Die Gangster konnten dort anlegen, ohne aufzufallen. Die vorsichtige Art, mit der das Boot gefahren wurde, sprach dafür. Langsam glitt es mit der restlichen Fahrt weiter. Schon nahm ich als sicher an, dass das Heck der Nairobi Star angesteuert werde. Doch dann legte der für mich unsichtbare Mann im Cockpit das Ruder nach Steuerbord und kam genau auf den Punkt los, an dem ich stand.
Ich ging hinter den Fendern in die Hocke. Der Griff nach dem 38er geschah automatisch. Er ist für mich ein Zeichen dafür, dass mein Instinkt Gefahr wittert. Vom Verstand her konnte ich das nicht bestätigen. Noch nicht. Ein sich verdächtig benehmender Bootsführer kann alles Mögliche ankündigen, aber auch harmlos sein.
Ebenso konnte es sich mit dem Wagen verhalten, dessen Scheinwerfer eben auf der Fahrbahn des Wellenbrechers erschienen.
Die gedämpfte, vielfältige Geräuschsymphonie des nächtlichen Hafens bekam etwas Bedrohliches, als ich registrierte, dass der Wagen mit Standlicht fuhr und schon viel näher war als zunächst geschätzt. Wer hier auf der schmierigen, schmalen Straße nur mit Standlicht fuhr, musste etwas zu verbergen haben.
Boot und Wagen schienen sich treffen zu wollen. Mir kamen Zweifel, ob das Ganze etwas mit der Nairobi Star und dem Rauschgift zu tun hatte. Gerne hätte ich jetzt meinen Kollegen George Baker bei mir gehabt, den ich drüben postiert wusste, wo die Columbia Street bei den Kais endet. Ich fragte mich, ob Baker sich die Nummer des Wagens gemerkt hatte. Wahrscheinlich aber nicht. Bei Baker kamen im Lauf der Nacht öfter Autos vorbei. Er konnte nicht wissen, dass dieses so verdächtig weit gefahren war.
Der Wagen, ein dunkler Buick Wildcat, stoppte keine zehn Yard von meinem Versteck entfernt. Ich musste die Seite wechseln, um nicht von dort oder vom Boot aus gesehen zu werden. Nun stand ich mit dem Rücken zur Straße. Dahinter lag der Hudson, hier an der Upper Bay gut zwei Meilen breit. Ich hörte kleine Wellen an die Steine der Kaimauer klatschen. Oder waren es Ruderschläge?
Zeit zum Nachsehen oder auch nur zum Überlegen bekam ich nicht. Aus dem Wagen war ein Mann ausgestiegen. Er sah sich prüfend um und gab dann zum Motorboot hin mehrmals Zeichen mit der Taschenlampe. Sie wurden erwidert.
Die ganze Angelegenheit stank, so viel war mir klar. Es fragte sich nur, worum es ging. Ich hatte mich inzwischen mit den Reinigungskosten für Hosen und Trenchcoat abgefunden und kniete hinter den Fendern, fest an das schmierige Holz gedrückt.
Das Boot nahm nochmals kurz Fahrt auf, kam endgültig an die Mole und stoppte mit dem Rückwärtsgang. Ich hörte das Wasser unter seinem Heck aufbrodeln und vernahm den leicht knirschenden Stoß des Bugs. Der Fahrer verstand sein Geschäft.
Ein vorsichtiger Blick nach der anderen Seite zum Wagen ließ mich zusammenzucken. Drei weitere Männer hatten ihn verlassen. Der Mittlere von ihnen war an den Händen gefesselt. Polizisten aber hatte ich ganz sicher nicht vor mir.
Spontan wollte ich die Kerle stellen, denn es handelte sich offenbar um die Entführung eines Mannes. Das Aufleuchten eines Feuerzeugs im Wagen zeigte mir indessen einen weiteren Mann am Steuer. Ohne die Leute auf dem Boot, die mir ganz sicher nicht helfen würden, standen vier gegen mich. Gangster, da ging ich jede Wette ein.
Vorsicht ist der bessere Teil der Tapferkeit, sagte ich mir, als ich mich flach hinlegte. Allein vermochte ich gegen die Übermacht nichts auszurichten. Wenn ich sofort nach Verschwinden der reizenden Versammlung die Küstenwache alarmierte, war das bedeutend effektvoller. Ich wartete ab, den Revolver in der Faust. Mein Herz klopfte.
Das Boot trieb langsam an der Kaimauer entlang in Richtung Beckeneinfahrt. Einer der Männer aus dem Wagen versuchte es an der Bugleine zu halten, aber ganz schaffte er es nicht. Die Strömung, die der Ebbestrom im Hudson verursachte, war stärker. Er und das Boot kamen immer weiter auf mich zu. Ich kroch um die Fender herum, um in Deckung zu bleiben.
»Habt ihr ihn?«, fragte eine Stimme vom Boot.
»Klar«, sagte ein anderer.
»Verdammt, ich will jetzt endlich wissen, wohin Sie mich bringen«, schrie ein dritter. In seiner Stimme schwang deutlich Angst. Er musste der Gefangene sein.
»Schnauze!«, war die Antwort.
Hinter mir, auf der anderen Seite des Wellenbrechers, hörte ich etwas anschlagen und dann scharren und kratzen. Es mochte ein Stück Treibholz oder eine der zahlreichen Kisten sein, die den Fluss hinabtrieben.
»Ich habe mit Mister Wishau vereinbart, ihn hier zu treffen«, begehrte der Gefangene auf. »Statt seiner kommen Sie und verschleppen mich. Ich werde mich …«
»… beschweren, natürlich«, fiel eine hämische Stimme ein. »Alles, wie es sich gehört. Auf dem Dienstweg, wie?«
»Wenn es sein muss, auch da… aahhh!«
Der letzte Laut war ein Schrei. Ich riskierte es, vorzukriechen und um die Ecke meiner Deckung zu spähen. Auf wenige Yard hatte ich nun die Szene vor mir.
Der Gefangene lag am Boden, offenbar bewusstlos. Er musste einen schweren Schlag erhalten haben. Ein Mann stand dabei, die anderen zwei hielten das Boot. Auf dem Bug des Fahrzeugs befanden sich zwei weitere Männer. Das Deck lag etwa in Höhe der Mole.
»Von mir aus könnt ihr ihn auch da gleich fertigmachen«, sagte einer dieser beiden geschäftsmäßig. »Wir schaffen ihn nur weg, ob lebend oder nicht, ist uns egal.«
»Okay, bringen wir’s hinter uns«, versetzte der neben dem Gefangenen.
Dieser schien in den letzten Sekunden wieder zu sich gekommen zu sein. Er regte sich, versuchte sich aufzurichten und brüllte plötzlich erstaunlich laut. »Hiilfee!«
Dieser Schrei löste zwei Dinge aus. Der Gangster neben dem Gefangenen bückte sich rasch nieder, holte dabei weit aus und schlug dem Schreienden etwas auf den Kopf, wahrscheinlich einen Revolver. Und ich sprang auf, feuerte einen Schuss in die Luft und schrie: »FBI, Hände hoch, keine Bewegung.«
Fast gleichzeitig hörte ich hinter mir schnelle Schritte. Bevor ich mich umdrehen konnte, bohrte sich etwas Hartes in meine Nierengegend, und ein Schlag traf meinen rechten Arm. Mein Revolver klirrte auf das Pflaster.
Die Gangster beim Boot fuhren herum und rissen Waffen aus den Jacketts.
***
»Keine Sorge, ich hab ihn«, sagte eine ruhige Stimme hinter mir. Und leiser: »Ganz ruhig, Sportsfreund, sonst ist’s gleich zu Ende.«
Ich hob die Hände, mehr war im Moment nicht zu tun. An der Situation konnte kein Zweifel bestehen. Sie war dafür gut, als treibende Leiche in der Hudsonmündung aufgefischt zu werden, wenn überhaupt.
Der Mann mit der Kanone hinter mir gehörte höchstwahrscheinlich zum Motorboot. Er hatte es vor dem Einlaufen ins Erie Basin verlassen und war vom Hudson her mit dem Dingi an die Mole gerudert. Als Rückendeckung. Das Geräusch eben war also doch nicht von Treibholz verursacht worden.
»Was is’n das für’n Vogel?«
Während zwei Mann den reglosen Gefangenen auf das Boot verluden, kam der dritte heran und starrte mir ins Gesicht. Wortlos griff er mir ins Jackett und holte meine ID-Card heraus.
»’n Bulle?«, fragte der hinter mir. Der andere nickte.
»Da«, er hielt meinen Ausweis hoch. »’n waschechter FBI-Greifer. Cotton heißt er. Stimmt doch, wie?« Er holte aus und schlug mir die ID-Card rechts und links ins Gesicht.
Ich konnte nichts tun. Hätte ich mich bewegt, hätte ich postwendend eine Kugel im Bauch gehabt. Wer wie ich schon bei Obduktionen gesehen hat, welche Zerstörungen Geschosse in den inneren Organen anrichten, wird mich verstehen. Zunächst war Schweigen das Beste.
»Was, Cotton?« Der hinter mir schien verwundert.
»Von dem hab ich schon gehört. Is’n besonders Scharfer. Dass ausgerechnet ich gerade den aufs Kreuz …«
»Was soll das lange Gequatsche – der Kerl hat zu viel gesehen, er muss weg!«
Der Gangster, der eben schon den Gefangenen niedergeschlagen und ihm dabei vermutlich den Schädel zertrümmert hatte, holte wieder aus.
Ich wandte einen oft geübten Trick an, der kaum auffällt, aber solchen Schlägen einen guten Teil ihrer Wucht nimmt. Trotzdem wurden meine Knie sofort schwammig, ich sah den Boden auf mich zukommen und schmeckte gleich danach ein Gemisch von Blut und fauligem Schlamm. Beim Fall war meine Unterlippe aufgeplatzt.
Ich wandte alle Energie auf, um bei Besinnung zu bleiben. Darin lag die einzige Chance, lebend davonzukommen. Darin und in dem Warnschuss. George musste ihn gehört haben. Wahrscheinlich war er bereits auf dem Weg hierher.
»Ob der Kerl auf uns gewartet hat?«, fragte der Schläger.
»Ist wahrscheinlich Zufall«, gab der andere zurück.
Ich konnte beide nur undeutlich sehen. Die nächste Leuchte stand ein Stück entfernt, und es herrschte Halbdunkel. Außerdem rann mir der Nieselregen in die Augen.
Irgendwo auf dem Hudson tutete ein Schlepper. Langsam glitten die Lichter eines Schiffes flussab.
»Ihr nehmt den da auch mit«, befahl jetzt einer der Gangster, die mit dem Wagen gekommen waren.
»Übernimmst du die Verantwortung?«, fragte einer vom Boot zurück.
»Klar. Weg mit ihm. Genau wie mit dem anderen.«
»Dann her mit dem Kerl. Wir wollen verschwinden. Der Schuss kann gehört worden sein.«
Zwei der Gangster packten mich an den Armen, schleiften mich zum Boot und übergaben mich den anderen beiden. Ich gab mir die größte Mühe, mich nicht zu rühren. Wenn die Kerle merkten, dass ich nicht weggetreten war, würden sie mir mit Sicherheit gleich den Rest geben.
Vielleicht würde mich der Schuss retten, denn er trieb die Gangster sichtlich zur Eile. Jedenfalls setzte ich darauf meine ganze Hoffnung.
Man schleppte mich nach hinten auf das Deck und ließ mich neben dem Gefangenen liegen. Vorher leuchtete mir einer mit der Lampe ins Gesicht und beobachtete mich ein paar Sekunden lang genau. Ich hielt Mund und Augen halb geöffnet und bemühte mich, nicht zu atmen.
»Der hat genug«, bemerkte der Gangster und wandte sich ab. Er nahm eine Stange und drückte gegen die Mole. Gleichzeitig sprang der Motor an. Der andere Mann, der am Ruder saß, wendete das Boot und fuhr langsam aus dem Erie Basin hinaus in die Upper Bay.
Ich bemühte mich, wieder zu Kräften zu kommen. Bald würde ich jedes bisschen Energie brauchen, denn dass ich um mein Leben schwimmen musste, daran zweifelte ich keine Sekunde. Vorsichtig bewegte ich Arme und Beine. Alle Muskeln gehorchten, und abgesehen von meinem Kopf schmerzte nichts.
Je weiter sich das Boot vom Land entfernte, desto geringer wurde meine Chance, zu entkommen. Trotzdem durfte ich nicht voreilig handeln. Zunächst musste ich abwarten, ob der dritte Mann mit dem Dingi wieder erschien.
Er kam. Das Boot stoppte, und am Heck ertönten rasche Ruderschläge. Der eine Gangster kam nach hinten, fing die geworfene Leine auf und half dem dritten an Bord. Noch während er das Dingi festmachte, steigerte die Maschine ihre Umdrehungen.
Der dritte betrachtete mich eine Weile im Dunkeln. Ich lag mit der linken Wange in einer eklig riechenden Blutlache, die von dem Gefangenen stammen musste. Bestimmt war er bereits tot. Nun sollte ich mit ihm zusammen versenkt werden.
Die Gangster würden dazu sicher einige Meilen in die Hudson-Mündung hinausfahren. Außerdem mussten sie uns beide noch beschweren. Soweit durfte ich es nicht kommen lassen.
Vorhin war der Schein der Lampe auf einen Rettungsring gefallen. Darauf stand der Name Nirwana. Wenn das Boot so hieß, dann passte die Bezeichnung genau. Allerdings war ich nicht gesonnen, mich sang- und klanglos dorthin verschicken zu lassen.
Ganz langsam richtete ich mich in kniende Stellung auf, wälzte mich auf das flache Heckbord, das keine Reling besaß, und ließ mich in das gurgelnde Kielwasser fallen. Der Schraubenstrahl wirbelte mich hin und her, aber ich blieb oben. Krampfhaft vermied ich es, an die letzten gesundheitspolizeilichen Untersuchungen des Hudson-Wassers zu denken, die eine sagenhafte Verschmutzung ergeben hatten.
Ich zog mich bis auf die Unterwäsche aus. Dann versuchte ich mich zu orientieren. Rechts von mir musste das Hafenbecken liegen, das an das Erie Basin angrenzt und Gowanus Bay heißt. Wenn ich mir die Stärke des Ebbestromes vergegenwärtigte, musste dort hinein eine kräftige Strömung gehen. Ich musste unbedingt in jene Richtung halten.
Glücklicherweise war es August und das Wasser nicht kalt. Ich begann auf die schwach sichtbaren Lichter zuzuschwimmen. Das Flusswasser brannte in der Kopfwunde, die der Schlag mit dem Revolver verursacht hatte.
Meine Berechnungen hinsichtlich der Strömung erwiesen sich als richtig. Der in den Fluss vorspringende Bezirk Red Hook erzeugte eine kreisende Strömung, die sich in der Gowanus Bay stellenweise sogar flussaufwärts fortsetzte. Zunächst allerdings schien das Land nicht näher zu kommen. Zeitweise verschwanden die Lichter sogar in Nebelschwaden. Ich musste mich mit aller Energie der Verzweiflung erwehren, die mich zu befallen drohte.
Schließlich geriet ich in eine Strömung, die mich ziemlich rasch ans Ufer zog. Ich trieb genau auf jenen Wellenbrecher des Erie Basins zu, auf dem ich vorhin gestanden hatte. Vorhin, wie lange lag das zurück? Zehn Minuten, eine Viertelstunde? Oder mehr?
Ich erreichte das Ufer nahe der Spitze des Wellenbrechers, erklärlich durch die kreisende Strömung in der Gowanus Bay. Erschöpft kletterte ich über die schlammigen Steinblöcke der Mole und sah einen Mann dort oben herumsuchen. Ich erkannte ihn und stolperte auf ihn zu.
»Hallo, George«, sagte ich so unbefangen wie möglich. »Du kannst mir zum Geburtstag gratulieren.«
»Eh, Jerry, war es dir zu warm?« Baker steckte den Revolver weg, den er bei meinem unvermuteten Auftauchen aus dem Wasser gezogen hatte.
Erst jetzt wurde mir richtig klar, wie verdammt klein meine Chance gewesen war, mit dem Leben davonzukommen. Hastig berichtete ich.
»Mir kam der Wagen gleich verdächtig vor, aber das hier ist ’ne öffentliche Straße«, kommentierte Baker. Er fasste mich an der Schulter und besah sich meinen Hinterkopf. »Die Schädeldecke scheint noch ganz zu sein«, versuchte er zu scherzen.
»Sonst wäre ja Wasser reingelaufen.« Meine Erleichterung über das knappe Entkommen hielt immer noch an. »Aber jetzt nichts wie hin zum Wagen. Vielleicht erwischen die Jungs von der Küstenwache das Boot noch.«
***
Wir rannten den Wellenbrecher entlang. Er verläuft in Form eines großen U, und wir mussten fast eine Meile zurücklegen, ehe wir unseren Wagen erreichten.
Ich riss das Mikrofon aus der Halterung. Die Nairobi Star war für den Augenblick vergessen. Nachdem ich unsere Zentrale informiert hatte, schaltete ich auf einen der Kanäle, die die Wasserpolizei benutzt. Knapp fünf Minuten später lief eine umfassende Aktion an.
Wir fuhren zum Office zurück, und der Arzt vom Nachtdienst versorgte meine Kopfwunde. Dank meinem Trick bestand sie nur aus einem Riss in der Kopfhaut und einer mächtigen Beule. Anderenfalls hätte mir der Gangster den Schädel eingeschlagen.
Inzwischen war Mr. High verständigt worden. Er schien den Fall für wichtig zu halten, denn er kam eine halbe Stunde später persönlich. Ich hatte mir inzwischen einen Anzug geliehen.
»Einen Mister Wishau wollte der Ermordete treffen, Jerry? Haben Sie das genau gehört?« Mr. High beugte sich vor. Wieder einmal ertappte ich mich dabei, dass er mich in seiner Erscheinung an einen Künstler oder Literaten erinnerte.
»Ja, er sagte Wishau, so viel ist sicher, Chef. Den sollte er dort treffen. Zweifellos ist dieser Mann eine Schlüsselfigur bei dem Mord.«
»Es muss sich um eine Angelegenheit von großer Tragweite handeln.« Mr. High warf mir und den drei anderen Kollegen, die an der Besprechung teilnahmen, einen kurzen Blick zu. »Normalerweise hätten die Gangster einen zufällig dazwischengekommenen G-man gefesselt liegen gelassen. Wenn man Sie kurzerhand ermorden wollte, Jerry, steckt ein dickes Ding dahinter.«
»Bestimmt nicht das bisschen Koks, das wahrscheinlich mit der Nairobi Star gekommen ist«, bekräftigte George Baker.
Mr. High nickte und legte meinen Bericht weg, den ich in aller Eile zusammengetippt hatte. Er deutete auf das Telefon.
»Jerry, fragen Sie bei der Küstenwache nach, was die Kollegen erreicht haben.«
Ich nickte und ließ mich mit der entsprechenden Dienststelle verbinden. Von dort bekam ich eine Funkschaltung mit dem Polizeikreuzer Talkowsky, der nach meiner Meldung die Suche nach der Nirwana aufgenommen hatte.
»Hallo, Cotton, hier spricht Lieutenant Andrews«, hörte ich, vermischt mit dem charakteristischen UKW-Rauschen und dem Knistern von Störungen. »Wir haben etwas für Sie.«
»Was denn, Lieutenant? Haben Sie das Boot gefunden?«
»Den Kahn leider nicht, aber eine männliche Leiche, gefesselt und mit eingeschlagenem Schädel. Könnte das der Gefangene sein, dessen Ermordung Sie gesehen haben?«
»Durchaus, Andrews. Wie haben Sie sie gefunden?«
»Wir standen in Höhe von Fort Hamilton, als wir den Einsatzbefehl bekamen. Zunächst fuhren wir flussaufwärts. Natürlich war bei dem Dunst nicht viel zu sehen. Bald danach kam uns ein Fahrzeug entgegen, auf das Ihre Beschreibung passte. Wir wendeten und nahmen die Verfolgung auf. Als wir den Scheinwerfer einschalteten, gab der andere Vollgas. Gleichzeitig wurde vom Heck etwas ins Wasser geworfen. Nachdem das fremde Boot eindeutig schneller war, gab ich die Verfolgung auf und fischte auf, was die anderen über Bord geschmissen hatten. Es war die Leiche. Die Kerle hatten noch keine Zeit gefunden, sie zu beschweren.«
»Immerhin etwas«, sagte ich und nickte Mr. High und Baker zu. »Wir lassen den Körper gleich abholen. Übrigens, gibt es ein Boot namens Nirwana?«
»Ja, aber das ist ’ne Segeljacht«, sagte Andrews. »Wahrscheinlich war der Rettungsring geklaut, den Sie gesehen haben, um ’ne falsche Spur zu legen.«
»Dachte ich mir. Jedenfalls vielen Dank. Und bringen Sie unsere Leiche bald an Land.«
»Wird besorgt, Ende.« Die Verbindung brach ab.
Mr. High rief unsere Fahrbereitschaft an und schickte den Transportwagen zur Hauptstation der Flusspolizei, wohin die Talkowsky unterwegs war.
***
Ich verzichtete darauf, nach Hause zu fahren und legte mich im Ruheraum aufs Ohr. Drei Stunden später weckte mich George.
»Sieht aus, als hätten wir Glück …«
Ich fuhr auf und brauchte einige Sekunden, um in die Wirklichkeit zurückzufinden.
»Weiß man schon, wer der Ermordete ist?«
»Du hast den Burschen anscheinend gründlich das Konzept verdorben«, erklärte mir George auf dem Weg zum Leichenschauraum im Keller. »Der Ermordete hatte noch sämtliche Ausweise bei sich.«
»Was …?« Ich begann unwillkürlich zu rennen. Als ich im zweiten Kellergeschoss den Lift verließ und in den weißgekachelten Raum stürzte, fand ich den Chef und eine Anzahl von Kollegen vor.
»Ah, Jerry.« Mr. High wandte sich kurz um. »Wieder auf dem Damm?«
»Leidlich, Chef.« Ich wies auf den Körper, der im grellen Licht reglos auf der Bahre lag. »Wer ist er denn? Ich meine, wer war er«, korrigierte ich mich.
»Er hieß Warren Delgado«, verkündete Mr. High. »Ich habe bei der Zentrale in Washington anfragen lassen, weil ich sichergehen wollte, dass wir nicht einer zufälligen Namensgleichheit aufsitzen«, sagte er bedeutungsvoll. »Das wäre mir lieber gewesen, aber meine Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Meine Herren«, unser Chef wies auf die Leiche, »das hier war der Leiter des Besucherzentrums von Cape Kennedy. Ich habe vom Cape erfahren, dass Warren Delgado seit mehreren Tagen spurlos verschwunden war.«1)
»Er ist hier von Florida hierhergebracht worden«, warf George Baker ein. »Damit sind wir zuständig.«
»Außerdem fehlt noch ein Ingenieur, Achille Bourne«, fuhr Mr. High fort. »Wir wissen noch nicht, ob sein Fehlen mit dem Mord an Delgado zusammenhängt, aber es kann nicht ausgeschlossen werden. Das wäre die Lage für den Augenblick, Gentlemen.« Er wandte sich zum Gehen und gab mir einen Wink, mitzukommen.





























