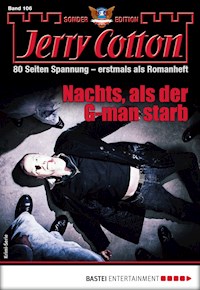
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jerry Cotton Sonder-Edition
- Sprache: Deutsch
Nachts, als der G-man starb
Sie hatten Jeff McBride erschossen. Einen von uns. G-man wie wir. Einen Kollegen, den wir alle ins Herz geschlossen hatten. Alle, ohne jede Ausnahme.
Sie hatten ihn einfach abgeknallt, gekillt. Auf eine besonders üble, raffinierte Tour. Fast ein perfekter Mord.
Fast - denn da war noch unser Zorn, unser eiserner Wille, jenen Mörder und seine Hintermänner zu stellen. Phil und ich übernahmen diese Aufgabe. Es wurde eine Jagd ohne Gnade ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Nachts, als der G-man starb
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelfoto: AZemdega /iStockphoto
Datenkonvertierung eBook: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-8169-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Nachts, als der G-man starb
Sie hatten Jeff McBride erschossen. Einen von uns. G-man wie wir. Einen Kollegen, den wir alle ins Herz geschlossen hatten. Alle, ohne jede Ausnahme.
Sie hatten ihn einfach abgeknallt, gekillt. Auf eine besonders üble, raffinierte Tour. Fast ein perfekter Mord.
Fast – denn da war noch unser Zorn, unser eiserner Wille, jenen Mörder und seine Hintermänner zu stellen. Phil und ich übernahmen diese Aufgabe. Es wurde eine Jagd ohne Gnade …
Die Jerry Cotton Sonder-Edition bringt die Romane der Taschenbücher alle zwei Wochen in einer exklusiven Heftromanausgabe. Es ist eine Reise durch die Zeit der frühen Sechziger bis in das neue Jahrtausend.
Mein erster Mord, dachte er. Mein erster Mord! Er wiederholte diese Worte in Gedanken immer wieder. Sie erschreckten ihn nicht. Im Gegenteil: Sie machten ihn stolz.
Er brannte darauf, sich zu bewähren. Es war ja nicht so, dass das Syndikat irgendeinen tumben Killer gesucht und gefunden hatte. Das gab es nur in schlechten Romanen. Wenn die Organisation einen Henker brauchte, traf sie ihre Wahl nach sorgfältigster Überlegung. Man benötigte gute Nerven, einen wachen Verstand und absolutes Vertrauen, um auf diese Weise ausgezeichnet zu werden.
Er schaute auf die Uhr. Beim Heben des Armes spürte er die harten Konturen seiner Schulterhalfter. Eigentlich war es blöd, mit der Kanone herumzulaufen. Er wusste, dass er sie nicht brauchen würde, aber er betrachtete sie gleichsam als Statussymbol, als eine Demonstration seiner Bedeutung. Das Gewehr lag unter einer schmutzigen Wolldecke im Kofferraum seines Wagens.
In dem schräg gegenüberliegenden Haus öffnete sich die Tür, und Jeff McBride trat auf die Straße. McBride hatte einen kleinen Handkoffer bei sich. Seinen Trenchcoat hatte er zusammengelegt über die Schulter gehängt. McBride sah recht vergnügt aus. Kein Wunder, denn schließlich blickte er einem Wochenende mit Lydia Kersh entgegen.
Ein Bulle. Ein verdammter FBI-Agent!
Es war gut, zu wissen, dass dieser Bursche nur noch zehn oder bestenfalls zwölf Stunden zu leben hatte.
Jeff McBride zog beim Gehen den linken Fuß ein wenig nach. Vor fünf Jahren hatte er bei einer Schießerei mit Syndikatsgangstern eine Hüftverletzung davongetragen. Seitdem war er im Innendienst beschäftigt. Er sah noch immer recht gut und durchtrainiert aus. Aber diesmal würden ihn weder seine Kräfte, seine Erfahrungen noch seine geistige Beweglichkeit vor dem Tode retten.
Jeff McBride verschwand pfeifend in der kleinen Gasse, die zu seiner Garage führte. Minuten später bog er mit seinem alten, mausgrauen Dodge auf die Straße ein und brummte in nördlicher Richtung davon.
Der Killer schlenderte zufrieden die Straße hinab. Er hatte es nicht eilig. Er war eigentlich nur hergekommen, um sich zu versichern, dass McBride tatsächlich reisen würde.
Eine halbe Stunde später rollte der Gangster mit seinem Ford über die George Washington Bridge nach New Jersey. Er hatte das Autoradio angestellt und sang – ein wenig falsch – die Hits mit, die gespielt wurden.
Es war ein warmer, sonniger Sonntag, und der Verkehr war geradezu beängstigend dicht. Alles strebte hinaus ins Grüne, erpicht darauf, der Sommerhitze der City zu entfliehen. Nun, bis New Spookenham würden die meisten nicht kommen, das war für einen Weekendausflug einfach zu weit.
Jeff McBride hatte sich eine Woche Urlaub genommen. Vielleicht würde es tatsächlich eine volle Woche dauern, ehe er nach New York zurückkehrte – starr und steif, mit einer Kugel in seinem Körper. Vielleicht würden aber auch Monate vergehen, ehe sie McBrides Leiche fanden.
Der Killer stellte das Radio ab, als er bei einem Überholmanöver nur knapp einer Kollision entging. Verdammt, er musste achtgeben. Ein Unfall konnte den Auftrag und seine neue Karriere ruinieren. Man wusste doch, was an solchen Wochenenden auf den Straßen passierte! Viele reagierten sich an einem solchen Wochenende am Steuer ab.
Der Killer lachte leise, als ihm aufging, wie absurd seine Gedanken waren. Er, der unterwegs war, um einen Menschen zu töten, regte sich über Leute auf, die einfach nur leichtsinnig oder dumm waren.
Er rechnete nach. Er hatte sieben Jahre, nein, sieben Jahre und drei Monate gebraucht, um von dem Boss für würdig befunden zu werden, den Job des Star-Killers zu übernehmen. Damit hatte er innerhalb des Syndikates eine Spitzenstellung bezogen.
Jetzt war er nicht mehr der wohlgelittene Sammy Mather, dem jedermann jovial auf die Schultern klopfen konnte, jetzt hatte er einen besonderen Status erreicht. Den Status des Henkers.
Das Syndikat – oder vielmehr der Boss – hatten in diesem Zusammenhang ein merkwürdiges, aber durchaus logisches Schema entwickelt: Keinem der zum Killer bestimmten Mitglieder der Organisation wurde gestattet, mehr als fünf Menschen zu töten. Fünf Morde – danach war man ein gemachter Mann.
Sicher war das eine kluge Entscheidung, denn nach fünf Morden lief jeder Gefahr, ein Opfer seiner Nerven zu werden. Hinzu kam, dass die Bullen ihre Verdächtigungen nicht über einen längeren Zeitraum auf einen bestimmten Mann konzentrieren sollten.
Er, Sammy Mather, war entschlossen, seine Chance zu nutzen.
»McBride«, murmelte er, »ich komme!«
***
Es war Abendbrotzeit, als der Henker in einem weiten Bogen um New Spookenham herumfuhr, und auf dem Parkplatz stoppte, den die Angler benutzten, die unten am Fluss kampierten. Er zählte neun Wagen, sieben davon aus New York, die meisten davon große Stationcars.
Er stieg aus und machte einige Freiübungen, um seine steif gewordenen Glieder zu lockern. Er hatte seinen Wagen mit gestohlenen Nummernschildern ausgerüstet und brauchte deshalb nicht zu befürchten, dass man ihn auf diese Weise überführen konnte. Außerdem: Wer interessierte sich hier draußen schon für einen dunkelgrünen Allerwelts-Ford?
Trotzdem hatte er vorsichtshalber darauf verzichtet, in der näheren Umgebung zu tanken. Es war nicht notwendig, dass jemand sich an sein Gesicht erinnerte. Er holte sich sein Baseballcap und die Kamera aus dem Wagenfond und bummelte hinab zum Fluss. Er blieb hin und, wieder stehen, um ein Foto zu schießen, denn er wollte, dass ihn zufällige Beobachter als Naturliebhaber einstuften.
Er sah allerdings niemand. Die Angler hatten ihre Zelte weiter nördlich aufgeschlagen, sie warfen ihre Köder im so genannten Osceola Valley aus. Oh, er kannte die Gegend sehr gut, er hatte sich wiederholt hier umgesehen, er wollte sicher sein, dass er sich auch in totaler Dunkelheit zurechtfinden würde.
Die Jagdhütte von Lydia Kersh lag gut drei Meilen von hier entfernt, an einem kleinen, versteckt liegenden See. Keiner der Angler würde den Schuss hören, wenn Jeff McBrides Todesstunde gekommen war.
Jetzt musste er abwarten, bis es dunkelte. Es war zu gefährlich, mit einem Gewehr und ohne Jagdschein im Walde angetroffen zu werden.
Er verspürte Hunger und bedauerte, dass er keinen Imbiss mitgenommen hatte. Wenn schon! Morgen, nach seinem ersten, großen Erfolg, würde er in New York wie ein Fürst speisen können – im besten und teuersten Restaurant.
Er setzte sich auf einen Stein am Flussufer, steckte sich eine Zigarette an und starrte grübelnd in die tanzenden Wellen. Was wohl McBride und das Mädchen jetzt trieben?
Vielleicht waren sie noch gar nicht eingetroffen. Vermutlich hatten sie unterwegs Halt gemacht, um etwas zu essen. Der Gedanke daran weckte erneut seine Hungergefühle. Er überlegte, ob er zu irgendeinem Straßenrestaurant fahren und dort ein Steak oder einen Hamburger verzehren sollte. Zeit dafür war mehr als genug. Nein, das wäre idiotisch! Er konnte es sich nicht leisten, einem Wirt oder einem Gast sein Gesicht als Visitenkarte in der Erinnerung zu hinterlassen.
Sammy Mather hob den Blick. Es wurde jetzt ziemlich rasch dunkel. Der Himmel hatte sich stark bewölkt. Es sah nach Regen aus. Verdammt, wenn es wirklich zu regnen anfangen sollte, war er dem Guss schutzlos preisgegeben. Er hatte an alles gedacht, nur nicht daran, seinen Regenmantel mitzunehmen.
Fünf Minuten später wurde es noch dunkler und dann begann es tatsächlich zu regnen, ganz sanft und monoton, aber mit wachsender Intensität. Er erhob sich und eilte zu seinem Wagen. Er setzte sich hinein und merkte, wie schläfrig ihn das Trommeln der Regentropfen auf dem Wagendach machte.
Worauf wartete er eigentlich noch? Der Regen hatte auch seine Vorteile. Da war bestimmt niemand im Walde unterwegs. Er, stieg aus, holte das Gewehr aus dem Kofferraum, wickelte die Decke darum und stiefelte los.
Als er eine Stunde später den kleinen See erreichte, war es stockdunkel. In der Jagdhütte brannte hinter den geschlossenen Fensterläden Licht. Auf dem kleinen, gerodeten Vorplatz parkte Jeff McBrides mausgrauer Dodge.
Sammy Mather war klatschnass. Anfangs hatte ihn dieser Zustand wütend gemacht, jetzt störte er sich nicht mehr daran. Jetzt zählte nur noch eins: sein erster Mord.
***
Er erwachte fröstelnd. Er lag im Freien, es regnete, und als er sich mühsam aufrichten wollte, jagte ihm die Anstrengung jähe Schmerzen durch den Kopf. Er ließ sich zurücksinken und entdeckte, dass seine Handgelenke vor seinem Körper von irgendetwas zusammengehalten wurden. Er versuchte sich von diesem Etwas zu befreien. Es ging nicht.
Eine böse Ahnung stieg in ihm auf. Er drehte eine Hand herum und ließ seine Fingerspitzen über das andere Gelenk gleiten. Sie erfassten einen dünnen, scharfkantigen Stahlbügel.
Handschellen.
»Lydia!«, schrie er. »Lydia!«
Niemand antwortete. Warum fiel es ihm nur so schwer, sich zu konzentrieren?
Der Tag hatte so wunderbar begonnen. Lydia war großartig zu ihm gewesen, zärtlich, witzig, verständnisvoll. Er konnte sich nicht erinnern, sie jemals so aufgekratzt erlebt zu haben.
»Lydia!«, brüllte er abermals.
Stille – nur die Regentropfen fielen rings um ihn herab, sie erfüllten die Nachtluft mit einem gleichmäßigen, dünnen Rauschen.
Er hatte keine Ahnung, wie er hierhergekommen war und welche Erklärung es für die Stahlfesseln an seinen Handgelenken gab.
Niemand war seinem Wagen in diese Einöde gefolgt, das wusste er genau. Er befand sich auf einer Privatreise, gewiss, aber wer so lange wie er Polizeiarbeit geleistet hatte, konnte sich einfach nicht von gewissen Angewohnheiten trennen. Zum Beispiel von der Marotte, beim Autofahren auf eventuelle Verfolger zu achten. Nein, es hatte niemand gegeben, der sich länger als fünf oder zehn Minuten in dem Rückblickspiegel seines altersschwachen Dodge gezeigt hatte.
Aber wie kam er hierher, was war geschehen?
Er bemühte sich krampfhaft darum, sich zu erinnern.
Die Ankunft. Die Art, wie Lydia ihn in der Hütte plötzlich geküsst hatte, atemlos und hungrig, als müsste sie nachholen, was sie bislang versäumt hatte. Dann diese unvergessliche Stunde in dem kleinen gemütlichen Schlafzimmer – und schließlich der Champagner, den Lydia aus dem Kühlschrank geholt hatte.
Der Champagner!
Was danach gekommen war, lag für ihn im Dunkel. Irgendetwas musste in dem Champagner gewesen sein. Ein Schlaf- und Betäubungsmittel. Aber wer hatte es hineingetan und warum?
Lydia? Das hielt er für ausgeschlossen, obwohl er sich plötzlich fragte, ob er sie wirklich so gut kannte, wie er immer geglaubt hatte.
Schließlich war sie fast ein Jahr lang Ernie Fishs Freundin gewesen – und jedermann in New York wusste, was das zu bedeuten hatte. Ernie Fish war sicherlich kein Killer, auch kein brutaler Gangster oder Gewaltverbrecher, aber er hatte enge Bindungen zu den Syndikaten und lebte von den damit verbundenen Beziehungen und Vorteilen.
Unendlich langsam zog er sich auf die Knie. In seinem Schädel machte sich sofort ein heftiges Pochen bemerkbar. Er ignorierte es und kam auf die Beine. Reiß dich zusammen, Jeff, sagte er sich. Du hast schon andere Situationen gemeistert. Du wirst auch mit dieser fertig werden.
Seine Hüfte schmerzte, wie immer, wenn das Wetter umschlug. Er schleppte sich mit zusammengebissenen Zähnen einige Schritte auf dem durchweichten Waldboden vorwärts und stoppte dicht vor einem Baumstamm, den er mehr ahnte, als er ihn zu sehen vermochte.
Nirgendwo war ein Licht zu sehen. Wohin, zum Teufel, sollte er sich wenden? Wenn er weiterging, war nichts gewonnen. Im Gegenteil. Er konnte stürzen und sich dabei etwas brechen. Es war besser, wenn er hier ausharrte und den Morgen abwartete. Er hob die Arme dicht vor sein Gesicht, um auf den Leuchtziffern seiner Armbanduhr die Zeit ablesen zu können.
Null Uhr zehn. Seltsam, er hatte angenommen, dass es schon bedeutend später sein müsste. Oder früher, um genau zu, sein. Zwei oder drei Uhr morgens. Was mochte wohl aus Lydia geworden sein? Sie hatte den gleichen Champagner getrunken wie er. Auch die gleiche Menge.
»Lydia!«, brüllte er erneut.
Es war sinnlos. Sie war nicht in der Nähe. Oder war sie noch bewusstlos? War sie, genau wie er, das Opfer eines geplanten Überfalls geworden?
Ein Vorfall dieser Art war nicht ohne Motiv denkbar. Galt der Anschlag nun ihm oder dem Mädchen? Hatte man ihn nur aus der Schusslinie geräumt, um an Lydia heranzukommen?
Wenn ihm doch bloß das Denken nicht so schwer gefallen wäre! Seine Kopfschmerzen, das Reißen in seiner Hüfte, das bis ins Bein ausstrahlte, und der unablässig fallende Regen machten es ihm nicht leichter, sich zu konzentrieren. Er lehnte sich gegen den Baumstamm und zuckte zusammen, als er ein Geräusch hörte, ganz in seiner Nähe.
Ein metallisches Geräusch. Ein Geräusch von der Art, wie es beispielsweise beim Zusammensetzen von Waffen entsteht. Seine Muskeln spannten sich. Er begriff, dass die Gefahr für ihn noch nicht gebannt war.
Er versuchte das Dunkel mit seinen Blicken zu durchdringen, aber das war ein völlig nutzloses Unterfangen. Immerhin gab es ihm den Trost, dass auch der andere nichts sehen konnte. Der andere! Wer war es – und was hatte er vor?
Mord? Unsinn! Man schleppte niemanden in den Wald und legte ihm Handschellen an, um ihn zu töten. Das konnte man gleich tun, ohne diese sinnlose Umständlichkeit.
Moment! Konnte es nicht sein, dass man sich – wer immer dieser ›man‹ auch sein mochte – erst einmal um Lydia kümmerte? Sein Herz krampfte sich zusammen, als er sich vorstellte, dass Lydia hilflos irgendwelchen Gangstern ausgeliefert war, die sich ein Vergnügen daraus machten, über sie herzufallen. So was ereignete sich immer wieder. Liebespaarmörder waren auf makabre Weise zum Hit der Saison geworden.
Erst Lydia, dann er. Aber auch das ergab keinen Sinn. Das Gift im Champagner konnte nur von Leuten stammen, die etwas von diesem Ausflug gewusst hatten, von Leuten aus New York also.
Er zuckte heftig zusammen, als plötzlich eine starke Lampe aufflammte und ihn blendete. Er hob die Hände vor die Augen, dann warf er sich in eine Bodenkuhle, um Deckung zu finden. Wasser drang durch seine schon total durchnässte Kleidung.
»Steh auf!«, kommandierte eine Stimme.
Irgendetwas landete neben ihm. Eine Taschenlampe.
»Nimm das Ding und schlag die Richtung ein, die ich dir befehle«, tönte es aus dem Dunkel.
Jeff McBride hob langsam den Kopf. Er musste tun, was der Fremde von ihm verlangte. Er war einfach zu unbeweglich, um dem gleißenden Lichtkegel zu entgehen. Aber er konnte Fragen stellen, er konnte versuchen, das Geheimnis dieser Nacht zu ergründen.
»Wer sind Sie?«, fragte er und stemmte sich langsam hoch.
»Ich bin nicht hergekommen, um mit dir Konversation zu betreiben«, höhnte die Männerstimme aus dem Dunkel.
Jeff McBride konnte sich nicht erinnern, sie schon einmal gehört zu haben. Es ist keiner deiner alten Klienten, überlegte er, das steht fest! Der Mann war vermutlich so um die Dreißig herum, vielleicht auch etwas jünger. Seine Stimme klang kalt und entschlossen, es war die Stimme eines Mannes, der nicht mit sich spaßen ließ.
»Wo ist Lydia?«, fragte Jeff McBride.
»Schnapp dir die verdammte Lampe und trab los, immer den Weg entlang«, kommandierte der Fremde.
Jeff McBride bückte sich nach der Lampe. Er erfasste sie mit seinen gefesselten Händen und knipste sie an. Tatsächlich, nur wenige Schritte neben ihm verlief ein schmaler Weg mit tiefen Fahrspuren.
»Los, beeil dich«, sagte der Mann aus dem Dunkel.
Die Taschenlampe fühlte sich in McBrides Händen solide und beinahe beruhigend an. Man konnte sie als Waffe benutzen. Dummerweise bedurfte es dazu eines Gegners, der in der Nähe war und sich überrumpeln ließ. Es lag auf der Hand, dass sich der Unbekannte eine solche Blöße kaum geben würde.
»Worauf wartest du noch?«, knurrte der Fremde. »Ich habe keine Lust, mir deinetwegen die ganze Nacht um die Ohren zu schlagen.«
»Wo ist Lydia?«, wiederholte Jeff McBride. »Was haben Sie mit ihr gemacht?«
»Das geht dich einen Dreck an.«
»Ich rühre mich nicht von der Stelle, solang ich nicht weiß, was mit ihr passiert ist!«
»Ich kann dir Beine machen.«
»Kommen Sie doch her!«, höhnte Jeff McBride und blinzelte in das grelle Licht. Das war keine gewöhnliche Taschenlampe, stellte er fest.
»Lydia hat sich hingelegt«, sagte der Fremde. »Sie schläft. Zufrieden?«
»Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?«
»Sie arbeitet für uns, Bulle«, höhnte die Stimme aus dem Dunkel. »Wusstest du das nicht?«
Jeff McBrides Herz machte einen heftigen, harten und schmerzhaften Sprung. Verdammt, hatte er es nicht geahnt? Er hatte seine Befürchtungen verdrängt, aber schließlich konnte eigentlich nur Lydia Kersh das Betäubungsmittel in den Champagner geschüttet haben.
Bulle hatte der Fremde gesagt. Bulle! Damit stand fest, dass es um ihn ging und dass man genau wusste, wer er war.
Lydia. Mein Gott, wie hatte er sich nur so in ihr täuschen können?
Nein, es gab noch andere Möglichkeiten. Er durfte sich von dem Gangster keinen Bären aufbinden lassen. Dem Burschen, ging es offenbar bloß darum, ihn zu quälen.
Lydia liebt mich, dachte Jeff McBride. Sie hat es mir wiederholt versichert. Ich habe dabei in ihre Augen geblickt. Diese Augen logen nicht, konnten gar nicht lügen!
»Was haben Sie mit mir vor?«, fragte Jeff McBride.
Er war außerstande, die Zusammenhänge zu begreifen. Das Ganze ergab bis jetzt keinen Sinn. Es sei denn, er unterstellte, dass jemand sich an ihm zu rächen versuchte. Aber wofür? Seit fünf Jahren war er im Innendienst. Es gab für niemand einen Grund, ihn zu hassen. Oder handelte es sich um Dinge, die vor seiner Verletzung passiert waren, damals, als er als aktiver G-man manchem Gangster das Handwerk gelegt hatte?
Aber falls irgendjemand beabsichtigte, ihn abzuservieren, hätte er das längst tun können. Welchen Sinn sollte dieser nächtliche Marsch durch den Wald haben – und wo sollte er enden?
»Ich folge dir, Bulle«, sagte der Fremde mit harter, drohender Stimme. »Ich habe ein Gewehr bei mir. Wenn du irgendwelche Mätzchen versuchst, drücke ich ab. Ist das klar?«
»Welche Mätzchen sollte ich denn wohl probieren?«, erkundigte sich Jeff McBride bitter. Er sprach sehr laut, er brüllte fast, aber es war natürlich unsinnig zu hoffen, dass jemand, der sich zufällig in der Nähe befand, ihn hören konnte. In einer solchen Nacht waren keine Jäger unterwegs. Menschenjäger ausgenommen.
»Du könntest die Taschenlampe ausknipsen und dich hinter einen Busch in Deckung werfen«, meinte der Gangster. »Aber das wäre zwecklos. Ich würde dich finden. Haben wir uns verstanden?«
»Verstanden«, sagte Jeff McBride und ging los.
Er ließ den Strahl der Taschenlampe vor sich her tanzen und überlegte, was er tun konnte, um seinen Gegner auszutricksen. Die Dunkelheit war Freund und Gegner zugleich; er musste es schaffen, sie für sich zu nutzen.
Er achtete auf die Geräusche, die der Gangster beim Gehen verursachte, konnte aber kaum etwas hören. Der Regen und der aufgeweichte Boden verschluckten und übertönten selbst seine eigenen Schritte.
Er musste immer wieder an Lydia denken. Die Zweifel an ihr, die sich dabei in seinem Inneren einstellten, machten ihn fast verrückt. Er bildete sich ein, Lydia zu lieben, und hatte fest geglaubt, dass sie diese Gefühle erwiderte.
Es verletzte seinen Stolz, dass er sich in ihr getäuscht haben konnte und dass er nicht clever genug gewesen war, ihr Spiel zu durchschauen.
Aber war es wirklich ein Spiel gewesen?
Er dachte an sein erstes Zusammentreffen mit Lydia, um herauszufinden, ob es von irgendwelchen Leuten im Hintergrund gesteuert worden war. Er hatte sie in einem Lokal kennengelernt. Lydia hatte nur wenige Tische von ihm entfernt gesessen, allein. Er hatte sich sein Glas geschnappt und an ihrem Tisch Platz genommen. So hatte es angefangen.
Nein, er konnte nicht glauben, dass sie als Köder gedient hatte. Wer ihn töten oder auf andere Weise aus dem Verkehr ziehen wollte, wäre nicht darauf angewiesen gewesen, einen so umständlichen Weg einzuschlagen …
Jeff McBride blickte kurz über seine Schulter und stellte fest, dass sein Verfolger seine Lampe ausgeknipst hatte. Wahrscheinlich genügte es ihm, sich an dem Licht der Taschenlampe zu orientieren.
Jeff McBride blieb stehen, weil die Schmerzen in seinem Bein unerträglich geworden waren. Er rechnete damit, dass der Fremde ihn heftig anpfeifen würde, aber hinter ihm blieb es still. Jeff McBride hatte auf einmal das Gefühl, völlig allein zu sein.
Er holte tief Luft und überlegte, ob er es riskieren durfte, sich mit einem Ruck umzuwenden und den Lichtkegel seiner Taschenlampe auf den bewaffneten Gangster zu richten.
Nein, das war zu riskant. Aber warum sagte der Fremde nichts?
»Ich muss eine kurze Pause machen«, rief McBride in das Dunkel, das sich hinter ihm staute. »Meine Verletzung macht mir zu schaffen!«
Der Gangster antwortete nicht.
Jeff McBride überlief ein seltsames Frösteln. Er verstand weniger denn je, was das Ganze zu bedeuten hatte. Offenbar war der Gangster hinter ihm zurückgeblieben, oder er hatte sich in eine andere Richtung gewandt. Aber warum, warum?
»He, hören Sie mich?«, brüllte Jeff McBride und wandte sich um.
Niemand antwortete.
Erst jetzt fand er den Mut, den Lichtkegel der Lampe in die Richtung zu lenken, aus der er gekommen war. Er sah die nassen, tropfenden Zweige der Bäume, er sah wucherndes Unkraut und seine eigenen Fußspuren, aber er sah nicht den Mann, den er zu sehen erwartete.
»Hallo?«, brüllte er.
Der Regen ließ in diesem Moment ein wenig nach. Fast schien es so, als wollte er damit seinem Rufen entgegenkommen und seiner Stimme die Chance geben, über eine größere Entfernung hinweg gehört zu werden.
Nur das monotone Rauschen der allmählich dünner werdenden Tropfen antwortete ihm. Jeff McBride fühlte sich weder erleichtert noch beruhigt. Er spürte genau, dass diese Stille Gefahr barg. Und plötzlich begriff er, dass es um sein Leben ging.
Er wollte die Taschenlampe ausknipsen und wegwerfen, um zu fliehen, aber genau in diesem Augenblick geschah es.
Das grellrote Blitzen eines Mündungsfeuers verband sich mit einem Knall, den er nur noch seltsam verzerrt und gedämpft hörte.
Aus, dachte er. Aus und vorbei!
Er brach in die Knie und merkte, wie schwer ihm plötzlich das Atmen fiel.
Gesichter und Namen schossen ihm durch den Sinn.
»Lydia«, murmelte er.
Warum hatte sie ihm das angetan?
Er kippte nach vorn. Sein Gesicht klatschte auf den weichen, nassen Boden. Er wollte sich davon lösen und noch einmal auf die Beine kommen, aber er spürte, dass ihm die Kraft dazu fehlte.
Ein Krampf durchlief seinen Körper, seine Finger krallten sich in einer letzten Anstrengung in den Waldboden.





























