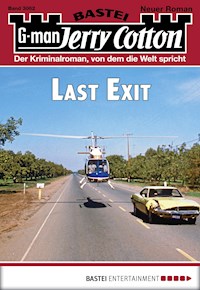1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jerry Cotton Sonder-Edition
- Sprache: Deutsch
Engel der Rache
Es schien die Tat eines Wahnsinnigen zu sein! Er hatte einen Staudamm gesprengt, Menschen waren zu Tode gekommen, viele andere hatten Hab und Gut verloren. Verwüstung und Trauer waren die Folge. Und der skrupellose Verbrecher drohte, noch einen weiteren Damm zu sprengen, wenn ihm das FBI New York nicht eine Million Dollar zahlte!
Phil und ich nahmen die Jagd nach ihm auf, arbeiteten jedoch getrennt. Mir zur Seite stand eine junge, begehrenswerte Frau, die mir sogar das Leben rettete. Doch ganz zum Schluss stellte sich mir die Frage, ob sie mir nicht nur half, um eiskalte Vergeltung zu üben, ob sie nicht in Wirklichkeit ein Engel der Rache war ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Engel der Rache
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelfoto: Lia Koltyrina/shutterstock
Datenkonvertierung eBook: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-8707-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Engel der Rache
Es schien die Tat eines Wahnsinnigen zu sein! Er hatte einen Staudamm gesprengt, Menschen waren zu Tode gekommen! Und der skrupellose Verbrecher drohte, noch einen weiteren Damm zu sprengen, wenn ihm das FBI New York nicht eine Million Dollar zahlte!
Phil und ich nahmen die Jagd nach ihm auf, arbeiteten jedoch getrennt. Mir zur Seite stand eine junge, begehrenswerte Frau, die mir sogar das Leben rettete. Doch ganz zum Schluss stellte sich mir die Frage, ob sie mir nicht nur half, um eiskalte Vergeltung zu üben, ob sie nicht in Wirklichkeit ein Engel der Rache war!
Die Jerry Cotton Sonder-Edition bringt die Romane der Taschenbücher alle zwei Wochen in einer exklusiven Heftromanausgabe. Es ist eine Reise durch die Zeit der frühen Sechziger bis in das neue Jahrtausend.
Margie O’Connor verschloss die Tür des Hühnerstalls und steckte den Schlüssel in die Tasche ihrer Jeans. Sie strich sich eine blonde Haarsträhne aus der Stirn und hielt die Hand über die Augen.
An den Hängen des schmalen Tals standen die Fichten schon im tiefen Schatten; die Abendsonne schien nur noch auf die Wiesen am Talgrund. Weit hinten, wo die hohe Staumauer einen Abschluss bildete und ihre Krone eine gerade Linie vor den fahlblauen Himmel zog, war die Sonne untergegangen.
Margie schauerte unwillkürlich. Seit sie in diesem Tal bei den alten Pettingotes lebte, in einer paradiesischen Landschaft mit mildem, herrlichem Klima, hatte diese hohe Mauer etwas Unheimliches für sie. Die Millionen Kubikmeter Wasser, die dort hoch über ihr standen, schienen sie körperlich zu bedrohen.
Pettingote hatte sie ausgelacht, als sie einmal davon gesprochen hatte. Er war selbst beim Bau der großen Mauer dabei gewesen.
»Mädchen«, hatte er gesagt, »was wir da alles aufgeschüttet haben, das hält. Das kehrt uns keiner mit dem Besen weg!«
Aber als sie sich dem Bann des mächtigen Bauwerks immer noch nicht entziehen konnte, war er eines Tages mit ihr hinaufgefahren, hatte sie über die Dammkrone geführt und ihr gezeigt, wie die Quadern seitlich im Fels verankert waren. Er hatte ihr auf einer Schemazeichnung erklärt, wie sich die Sohle der Mauer unten weit in den See hineinzog und so den Druck der gestauten Wassermassen auffing.
Mit geringem Verständnis hatte sie seinen Erklärungen zugehört. Was sie bedrückte, war nichts, das man mit Physik und Berechnungen wegdiskutieren konnte. An jedem Abend, wenn sie ihre Arbeit auf der Geflügelfarm getan hatte, stand sie hier und richtete den Blick wie unter einem Zwang auf die Mauer. Das Gefüge der dunklen Steinblöcke schien sie zu hypnotisieren, mehr noch aber die Vorstellung der grünlich-dämmerigen Tiefen, die sich dahinter erstreckten …
Sie kniff die Augen zusammen, wandte sich um und riss sie wieder auf. Mit festen Schritten ging sie zum Farmhaus.
»Petty«, rief sie, »komm zum Abendessen!«
Ein dreijähriger, flachsblonder Junge kam aus der grünen Wildnis der Stangenbohnen im Garten herausgekugelt.
»Wo sind Mom und Dad?«, fragte er mit hoher Stimme und hängte sich an sie.
»Drinnen, Petty! Komm, es wird spät!« Sie zog ihn mit sich, warf noch einen Blick auf die lang gestreckten Gebäude der Geflügelhäuser, hinter deren Fenstern die matte Nachtbeleuchtung brannte, und verschwand mit dem Jungen im Farmhaus.
Die Sonne war nun ganz untergegangen. Die Konturen der Staumauer waren mit denen des Waldes zu ihren beiden Seiten verschmolzen, und der Himmel überzog sich mit federig-hellen Nachtwolken.
Ein schwarzer Vogel strich mit weiten Schwingen vorüber, und es raschelte im Holz. Die große Wasserfläche des Stausees war glatt wie ein Spiegel. Zuweilen sprang ein Fisch, und dann breiteten sich kreisförmige Wellen aus, die sich bald verliefen. Am Pegel, einer schwarz-weiß markierten Holzlatte, stand das Wasser dicht unter der oberen Marke.
Wenn es in der Nacht Regen gab, würde es noch ein paar Zentimeter steigen. Am Morgen schoss dann das Wasser durch den seitlichen Überlauf, schäumte über die steinernen Stufen in das kleine Auffangbecken im Tal und floss durch den kanalisierten Flusslauf ab. Ein, zwei Tage lang war dann ein stetes Rauschen im Tal, und eine Wolke von Wasserstaub stand zwischen den Kiefern und Erlen.
An der Talseite der Staumauer rann das Wasser aus mehreren feinen Spalten. Das war schon immer so gewesen und gab keinen Grund zur Besorgnis. Die Kontrollbeamten, die ein paar Mal im Jahr mit dem Jeep über die schmalen Wege heraufgefahren kamen, machten ihre Witze darüber, registrierten aber trotzdem die kleinste Veränderung und nahmen ihre Messwerte für ein Zeichen, dass alles in Ordnung war. Das Mauerwerk hatte sich an den Stellen schwarzgefärbt, und grünes Moos wuchs in den Ritzen.
In dieser Nacht aber geschah etwas, was niemand hatte vorhersehen können außer einem einzigen Menschen. Aber der hütete sich wohlweislich, sein Geheimnis zu verraten.
Gegen elf Uhr abends durchfuhr ein Ruck das ganze Bauwerk. Über den spiegelnden See lief eine Welle, die sich erst weit hinten in den Buchten brach. Auf der Dammkrone flog ein Kanaldeckel in die Luft, klatschte ins Wasser und versank.
Eines der steten, kleinen Rinnsale wurde plötzlich stärker. Es war, als hätte man eine Leitung aufgedreht. Moosflocken wurden mitgerissen und wirbelten hinab. Aus dem Sickerwasser perlten Luftblasen, dünne Wasserstrahlen brachen hervor und zischten in die Nachtluft. Mörtelbrocken polterten die Mauer hinunter, prallten aufschlagend ab und sprangen in die Tiefe. Ein großer Stein löste sich von seinem Platz, und hinter ihm brach ein meterdicker Wasserschwall aus dem Wall.
Das Leck befand sich ungefähr auf halber Höhe der Mauer. Entsprechend stark war der Wasserdruck dahinter, der gegen die Ränder der Mauerlücke drückte und weitere Stücke herausbrach. Seinerzeit war sie aus Gründen der Ersparnis nicht massiv ausgeführt worden; man hatte zur Wasserseite hin einfach aufgeschüttet, was beim Baggern angefallen war: Kies, Sand und Lehm.
Diese Füllung wurde nun durch die plötzlich entstandene Maueröffnung gepresst, die wie eine Düse wirkte. Sie vergrößerte sich in Minutenschnelle. Mit Urgewalt schoss das Wasser hervor und in weitem Bogen hinaus in die Dunkelheit. Brausen erfüllte die Luft, und aus dem Tal wehte das Poltern der losgerissenen Bruchstücke herauf.
Nun lösten sich auch oberhalb der Bruchstelle die Steine. Nach beiden Seiten fraß sich der Riss. Er erreichte die Krone. Es war fast ein Viertel der ganzen Mauer, das einen Augenblick noch in der Schwebe zu stehen schien und dann mit ohrenbetäubendem Getöse in die Tiefe rutschte.
Der Donner brach sich an den Talwänden und wogte mehrfach als Echo hin und her. Eine kompakte Wasserwand quoll durch die breite Lücke und stürzte sich überschlagend zu Tal. Fontänen von Wasserstaub schossen hoch in die Luft. Eine Druckwelle peitschte die alten Bäume an den Abhängen des Tals, ließ Äste brechen und ein paar uralte Erlen mitsamt ihren Wurzelballen aufquirlend in den Strudeln davontreiben.
Das stille Tal war vom Lärm eines Weltuntergangs erfüllt.
***
Margie O’Connor erwachte vom steten Rauschen und hielt es zunächst für Regen. Aber es wurde immer stärker, und fremde Geräusche mischten sich hinein – Poltern und Stoßen.
Sie schwang sich mit einem Ruck aus dem Bett und lief zum Fenster. Was sie sah, ließ sie zwinkern. Das ganze Tal schien in Bewegung zu sein. Die Wiesen, der Garten, die Wege – alles war eine strudelnde, graue Fläche.
Sie öffnete das Fenster. Jetzt wurde das Rauschen zum Tosen. Hinter den Wolken kam für einen Moment der Mond hervor und sandte einen fahlen Schein auf das Chaos. Ein Baum kam herangetrieben und stieß mit einem dumpfen Laut gegen die Hauswand. Das ganze Gebäude erzitterte. Margie fuhr herum, hastete zur Tür und riss sie auf. Wasser stürzte ihr entgegen und riss sie fast von den Füßen.
»Smyrna!«, rief sie gellend. »Al! Der Damm ist gebrochen!« Mit der Faust donnerte sie gegen die Tür zum Schlafzimmer der Pettingotes.
Al Pettingote war wohl schon wach gewesen. Er erschien in einem hastig übergezogenen Overall, mit wirrem Haar. Seine Hand tastete zum Lichtschalter, aber es gab schon keinen Strom mehr. Vermutlich hatte es die Lichtmasten umgerissen …
»Der Damm ist gebrochen!«, wiederholte Margie O’Connor. »Wir müssen hier weg!«
Smyrna Pettingote erschien hinter ihrem Mann, den kleinen Jungen auf dem Arm. Entsetzen hatte ihre Augen geweitet, und sie presste das Kind fest an sich.
»Der Damm?«, stotterte Al ungläubig. Dann blickte er auf seine Füße, die schon im Wasser standen. »Aber es hat doch gar nicht geregnet die letzten Tage!«
Er bahnte sich an ihnen vorbei einen Weg nach draußen. Die Haustür war nur schwer aufzubekommen, so sehr drückte die Flut dagegen. Margie fand die Handlampe, die sie manchmal benutzte, wenn sie nachts draußen nach den Tieren sah, und knipste sie an. Der Schein fiel hinaus auf den Hof, auf eine trübe, heftig kreiselnde Wasserfläche. Zwischen losgerissenen Grasbüscheln und Sträuchern trieben die ersten toten Hühner mit ausgebreiteten Flügeln und nassem Gefieder.
Mit bleichem Gesicht wandte sich Al Pettingote um.
»Da kommen wir nicht mehr durch, Mädchen. Wir müssen aufs Dach! Los, Smyrna, nimm den Jungen mit hinauf! Ich will sehen, dass ich ein paar Decken finde und Lebensmittel!«
»Aber wenn es die Hühnerställe schon eingerissen hat, sind wir auf dem Dach nicht sicher!«, wandte Margie hastig ein.
»Auf dem Weg auch nicht«, entgegnete Al. »Wir kommen nicht durch die kleine Senke vor der Brücke!« Er hielt den Hörer des Wandtelefons in der Hand und horchte hinein. Kein Freizeichen kam. Er entglitt seinen Händen und blieb baumelnd an der Schnur hängen.
»Ich nehme den Jeep und versuche es!«, rief Margie entschlossen. »Vielleicht komme ich durch und finde Hilfe! Sie müssen einen Hubschrauber schicken!« Sie sprang in ihre Jeans und streifte sich einen Pullover über. »Wenn es gar nicht mehr geht, versuche ich zu schwimmen!«
»Mädchen, bleib hier!«, rief Al. »Du kannst es nicht schaffen!« Er hatte die Arme voller Wolldecken und stand auf der Treppe.
Aber Margie war schon auf dem Hof. Barfuß watete sie durch das Wasser und geriet mehr als einmal in Gefahr, von den Füßen gerissen zu werden. Sie erreichte den Jeep und kletterte hinein. Noch war kein Wasser hineingelaufen, aber die Strömung zerrte an dem leichten Fahrzeug.
Der Motor sprang an und brummte auf. Auch die Scheinwerfer funktionierten. Vorsichtig setzte sie zurück. Dann schlug sie das Steuer ein und fuhr durch das Tor hinaus auf die Straße. Glücklicherweise kannte sie den Weg; sie war ihn in völlig dichtem Nebel gefahren und im Schneetreiben – so konnte sie sich an Zaunpfählen, Bäumen und Leitungsmasten orientieren.
Im zweiten Geländegang kam sie anfangs ganz gut vorwärts. Wo sich der Weg senkte, schwappte eine große Welle herein. Im Fahren riss sie die Gummistöpsel aus dem Bodenblech, und langsam lief das Wasser wieder ab. Ihr rechter Fuß auf dem Gaspedal befand sich immer noch unter Wasser, als erneut eine Welle über die niedrige Seitenwand schlug. Sie machte die Kette für die Kühlerjalousie los, um den Motor so lange wie möglich vor Spritzwasser zu schützen.
Einmal drehte sie sich um. Das ganze Tal war jetzt ein See. In der Staumauer glaubte sie einen tiefen Einschnitt wahrzunehmen, aus dem das Wasser herabstürzte, aber dann verfinsterte sich der Himmel wieder.
Sie blickte wieder nach vorn. Der rechte Scheinwerfer war ausgegangen. Bis zur Brücke, hinter der sich der Weg höher an den Abhang schmiegte, waren es noch fünfhundert Yards. Aber davor befand sich eine Senke, vor der Al Pettingote sie gewarnt hatte. Margie glaubte selbst nicht daran, dass sie da mit dem Jeep durchkommen würde, aber sie war fest entschlossen, es wenigstens zu versuchen.
Sie gab Gas. Der Jeep warf jetzt eine ziemliche Bugwelle auf, und sie spürte den Widerstand des Wassers. Trotzdem wagte sie es, in den dritten Gang hochzuschalten. Tief steckte der Jeep seine Nase in die Flut. Und dann, als sie die tiefste Stelle überwunden zu haben glaubte, starb der Motor. Sie drehte den Schlüssel drei-, viermal herum, aber vergebens.
Margie O’Connor stieg auf den Sitz und sah in die Runde. Wieder gaben die Wolken den Mond frei. Margies Hand krampfte sich um den Rahmen der Windschutzscheibe. Was sie sah, ließ ihr den Atem stocken. Vom Damm her wälzte sich eine viele Meter hohe Flutwelle heran. Sie trug eine Schaumkrone und überstürzte sich fortwährend, alles begrabend, was ihr im Weg war.
Noch war sie ein ganzes Stück vom Farmhaus entfernt. Margie glaubte, auf dem Dach die Gestalten der Pettingotes auszumachen, war sich aber nicht ganz sicher. Selbst wenn das Wasser nicht so höher stieg, mussten sie verloren sein. Das Farmhaus war alles andere als solide … Sie konnte den Blick nicht abwenden.
Die Wasserwand erreichte die Hühnerhäuser mit der Wucht einer Explosion. Bretter, ganze Dächer wirbelten empor und klatschten irgendwo ins Wasser, das sie sogleich mitriss und fortführte. Der große Apfelbaum brach ab wie ein Streichholz. Eine Leiter wurde hochgetragen und stand sekundenlang als schwarzes Gittermuster vor dem Himmel, ehe sie zersplitterte.
Und dann brach es über das Farmhaus herein. Die Seitenwand knickte unter dem Anprall, das Dach neigte sich, aber eine zweite Woge hob es an, stellte es auf die Kante und kippte es einfach um. Jetzt barst auch die Vorderwand, und ein breiter Strom wälzte sich durch das Haus und riss mit sich, was er fand. Nur noch zwei Eckpfeiler und der Kamin ragten aus den aufgewühlten Wassermassen.
Margie sah nun die Flutwelle auf sich zukommen. Blitzschnell fasste sie ihren Entschluss: Wenn sie in der Nähe des Jeeps blieb, war sie in Gefahr, von dem Fahrzeug erschlagen zu werden. Im Wasser treibend hatte sie bessere Chancen.
Noch einen letzten Blick warf sie in die Runde. Dann kletterte sie auf die Motorhaube, reckte die Arme und sprang mit einem weiten, flachen Hechtsprung ins Wasser.
Etwas schrammte an ihrer Seite heiß und brennend entlang. Sie bekam Zweige und etwas Weiches zwischen die Finger und strampelte heftig mit den Beinen. Als sie an die Oberfläche kam, hörte sie das Tosen der Wasser.
Ein heulender Wind jagte durch das Tal. Plötzlich wurde es eiskalt um sie herum. Eine Faust schien sie zu packen und fortzuschleudern. Sie fühlte sich in die Luft gehoben und dann wie unter einem Wasserfall begraben. Um sie war nur noch Wasser.
Ehe sie das Bewusstsein verlor, dachte sie noch einmal an Al Pettingote und Smyrna. Sie sah noch einmal den blonden Schopf des kleinen Jungen und sein unbekümmertes Lachen, wenn er durch die grüne Wildnis des Gartens strampelte oder in einer sonnenhellen Wolke weißen Federviehs auf der Weide auftauchte …
***
Ich hatte die Meldung schon beim Frühstück in der Zeitung gelesen und ihr keine besondere Bedeutung beigemessen. Was uns FBI-Beamte interessieren muss, steht meistens – leider – auf der ersten Seite, und ein gebrochener Damm regt uns da nicht besonders auf, zumal wenn keine Menschen dabei zu Schaden gekommen sind und auch wohl gar kein Verbrechen vorliegt.
So jedenfalls lautete der Text, und ich wandte meine Aufmerksamkeit einem anderen Bericht zu, nach dem ein ziemlich prominentes Mitglied der Cosa Nostra endlich nach Europa abgeschoben worden war. Die fixen Jungs von der Redaktion hatten sogar ein Foto geschossen, wie er mit vorgehaltener Hand ins Flugzeug stieg. Das mit der Hand hätte er sich meinetwegen sparen können. Ich kannte den Mann besser, als ihm lieb war, und hatte zu dieser Europa-Reise maßgeblich beigetragen.
Befriedigt genehmigte ich mir noch eine zweite Tasse Kaffee, stellte dann das Geschirr zusammen und fuhr gemächlich zu der Straßenecke, wo mein Freund und Kollege Phil Decker zustieg. Wir unterhielten uns während der Fahrt zum Büro über den exportierten Mafia-Boss und waren uns einig in der Meinung, dass wir die europäischen Kollegen nicht um ihren neuen Kunden beneideten.
In der Halle lag eine Nachricht für uns. Mr. High erwartete uns bereits, und wir sollten ihn möglichst sofort aufsuchen.
»Aus der Traum von einem schönen, ruhigen Tag!«, sagte Phil sarkastisch, und ich ergänzte: »Fahret dahin, ihr sauber getippten Akten, ihr schön gestempelten Protokolle!«
Wir verließen den Lift und klopften an die Tür zum Vorzimmer des Chefs. Helen, seine Sekretärin, sah so strahlend frisch aus wie der junge Morgen, als sie uns von der Kaffeemaschine her begrüßte. Aber ihre Miene war besorgt.
»Ganze Kanne«, sagte sie nur. Das bedeutete, dass wir uns auf Einiges einzurichten hatten. »Der Chef wartet.«
Mr. High hatte den Hörer des roten Telefons am Ohr, winkte uns zu und zeigte auf die beiden Stühle vor seinem Schreibtisch.
»… selbstverständlich«, hörten wir ihn abschließend sagen. »Rechnen Sie mit dem ersten Zwischenbericht in einer Stunde.«
Er legte auf und sah uns überlegend an. Dann seufzte er und breitete vor uns eine Zeitungsmeldung aus.
»Bekannt«, sagte ich, und auch Phil nickte.
»Leider ist das nicht alles«, sagte Mr. High und nahm das Blatt wieder an sich. »Die Meldung ist insofern unvollständig, als wahrscheinlich doch drei oder vier Menschenleben zu beklagen sind und es sich um ein Verbrechen handelt. Um ein Verbrechen, das in unsere Zuständigkeit fällt.«
»Wollen sie damit sagen, dass jemand den Coulder-Damm in die Luft gesprengt hat, Sir?«, fragte ich fassungslos.
Der Chef nickte. »Das ist leider keine Annahme von mir, sondern Gewissheit. Heute früh kam hier ein Brief an, der das Verbrechen bestätigt. Hier ist der Text, lesen Sie!«
Wir beugten uns über die Fotokopie.
An das FBI!
Das mit dem Coulder-Damm ist nur eine Warnung. In einem anderen Damm liegt eine Bombe, und die geht hoch und bringt alle Leute im Tal um, wenn ihr mir nicht eine Million Dollar zahlt. Heute Morgen kriegt ihr meine weiteren Befehle.
»Das scheint nicht nur ein Unbekannter zu sein, sondern auch ein Irrer!«, schnaubte Phil wütend.
Mr. High blickte mich forschend an. »Was meinen Sie, Jerry?«
Ich überlegte. »Einen Defekt hat er ganz bestimmt. Der Stil seines Briefes ist gleichermaßen primitiv und überheblich. Leider scheint er jedoch Gründe für seine Überheblichkeit zu haben. Der Coulder-Damm ist tatsächlich explodiert. Haben wir Einzelheiten?«
»Nicht viele. Die Gegend ist ziemlich einsam; der nächste Ort ist New Bromfield. Unser dortiger Kollege hat einen ersten Bericht über Fernschreiber durchgegeben. Danach wohnten unterhalb des Dammes Al Pettingote, ein Geflügelfarmer, mit seiner Gattin und einem dreijährigen Jungen sowie einer jüngeren Frau namens Margie O’Connor, die auf der Farm arbeitete. Die Farm wurde restlos zerstört, von den Bewohnern keine Spur. Nur ein Jeep, der dahin gehörte, ist weiter unterhalb an einer Brücke gefunden worden, wahrscheinlich hat ihn das Wasser dahin getrieben.«
»Wie sieht es gegenwärtig am Damm aus?«
»Er hat auf halber Höhe ein großes Loch. Bis dahin ist der Stausee leer gelaufen. Da die Gefahr besteht, dass die Mauer weiter ausbricht, ist eine Pioniereinheit der Army unterwegs, um ihn vorläufig zu sichern.«
»Gibt es Beweise, dass der Damm tatsächlich gesprengt worden ist? Vielleicht ist er auch nur aus Altersschwäche zusammengestürzt, und jemand aus der Nähe, der das Unglück kommen sah, hat das für seine Erpressung ausgenutzt?«
Mr. High schüttelte den Kopf. »Altersschwäche scheidet aus. Ich habe die Leute der Kommission aus dem Bett holen lassen, die unsere Dämme regelmäßig überprüfen. Sie bezeugen einstimmig, dass der Damm in Ordnung war. Keine abnormen Regenfälle, nichts dergleichen. Tut mir leid, Jerry – eine solche Erklärung wäre mir auch lieber.«
»Hm …«, machte ich.
Helen kam herein und servierte den besten Kaffee New Yorks im stillen Bewusstsein ihrer Meisterschaft.
»Was tun wir jetzt?«, fragte ich. »Und wieso sind wir überhaupt damit befasst? Der Coulder-Damm liegt doch meines Wissens weit außerhalb unseres Gebiets.«
»Eine Entscheidung von Washington. Der Erpresserbrief ist bei uns angekommen. Und irgendjemand muss ja die Maßnahmen koordinieren.«
»Warum kam der Brief hierher? Philadelphia wäre doch näher gewesen?«
»Vielleicht ist der Absender New Yorker. Oder er denkt, dass hier in der Bankenmetropole am leichtesten eine Million zu beschaffen ist. Sein Briefstil könnte auf ein solches primitives Denken schließen lassen. Aber das ist nicht unsere größte Sorge. Wir müssen selbstverständlich alle Dämme im Land untersuchen und überwachen lassen.«
»Soviel ich weiß, gibt es keine nationale Behörde, denen alle diese Anlagen in den USA unterstehen?«, überlegte Phil.
Der Chef nickte. »Richtig, Phil. Die größte Verwaltungsbehörde ist die Tennessee Valley Activity. Sie hat ein gutes Dutzend Stauwerke unter sich. Aber es gibt auch eine Unzahl von Stauseen, die Gemeindebehörden unterstehen oder sogar im Privatbesitz sind. Und bei der verhältnismäßig dichten Besiedlung unseres Landes sind theoretisch bei jedem Dammbruch Menschen in Gefahr. Wo niemand wohnt, braucht man keine Dämme. Aber schließlich haben wir eine Organisation, die in den ganzen Staaten verbreitet ist.«
Phil blickte fragend auf.
»Das FBI«, sagte ich lakonisch.
Mr. High lächelte flüchtig und nickte. »Ich habe von Washington alle Vollmachten. Sämtliche Dienststellen sind schon per Fernschreiben unterrichtet. Von der Army bekomme ich an ausgebildeten Hilfskräften, was ich brauche. Die werden dann den Objektschutz übernehmen. Hoffentlich haben sie genügend Leute.«
Helen meldete über die Sprechanlage einen Besucher, und herein kam ein langer, magerer und wettergebräunter Mann in grauem Anzug und festen Schuhen, der sich fragend umsah und uns zunickte.
Mr. High stand auf. »Mister Patterson? Ich danke Ihnen, dass Sie so schnell meiner Bitte gefolgt sind.«
Er bat ihm Platz an, und Mr. Patterson ließ sich steifbeinig nieder.
»Mister Patterson ist Spezialist für Staudämme«, erläuterte Mr. High. »Er hat in aller Welt Dämme gebaut, wenn ich recht unterrichtet bin, und ich habe ihn gebeten, uns einen kurzen Vortrag zu halten, wie man Dämme sprengen kann.«
Ich musste wieder einmal Mr. Highs Initiative bewundern. Wenn es um die Verhütung eines Verbrechens geht, würde er bedenkenlos vom Präsidenten dessen Privatmaschine Air Force One erbitten – und auch bekommen. Mochte der Himmel wissen, wo er diesen Staudammspezialisten aufgetrieben und in dieser kurzen Zeit hergeschafft hatte …
Patterson räusperte sich. »Nun, wenn Sie mir sagen, ob die Sprengung sozusagen offiziell durchgeführt wird oder ob sie heimlich vorbereitet werden muss?«
»Heimlich«, sagten wir wie aus einem Mund.
Er nickte. »Das vereinfacht die Sache. Sehen Sie – wir haben verschiedene Dammsysteme. Die alten, aufgeschütteten, die von der Basis her wasserseitig ziemlich langsam ansteigen, unten sehr breit sind und nur zur Dammkrone hin schmal werden, die sind nur in ihrem oberen Teil zu sprengen. Am besten, indem man ein Loch bohrt und eine ordentliche Ladung tief genug einzementiert. Recht umständliches Verfahren, weil man ein Hängegerüst braucht. Das fällt auf. Dann haben wir die modernen Betondämme. Ziemlich dünn; die Mauer hält den Wasserdruck, weil sie vorgespannt und auf ihre optimale Form berechnet ist. Die lässt sich überhaupt nicht sprengen, ohne dass jemand etwas von den Vorbereitungen merkt. Es sei denn, Sie setzen Flugzeuge ein, aber auch da muss die Besatzung ziemlich lange am Objekt selbst trainiert werden, und man braucht allerhand Sprengkraft. Vielleicht erinnern Sie sich, was die Engländer im Zweiten Weltkrieg für Schwierigkeiten hatten, bis sie ein paar kleinere Dämme in Germany kaputtkriegten. In dieser Hinsicht ist die Kriegstechnik nicht viel weiter fortgeschritten.«
»Wie also sprengt man heimlich einen Damm?«, fragte Mr. High mit leiser Ungeduld.
»Nun, am besten so wie den Coulder-Damm. Habe mir im Flugzeug meine Unterlagen einmal daraufhin angesehen. Viele Dämme dieser Bauart haben Einstiegschächte von oben, die ziemlich tief in den eigentlichen Damm hineinreichen. Zur Inspektion und so. Sie brauchen da doch nur eine gute Ladung hineinzusenken, sie halbwegs abzudecken oder auch nur den Schacht voll Wasser laufen zu lassen, damit die Explosionskraft seitlich wirkt und ein Loch reißt. Und das Loch muss gar nicht einmal groß sein. Der Wasserdruck erweitert es von selbst.«
»Wie viele Dämme dieser Bauart gibt es ungefähr?«, wollte Phil wissen.
Patterson maß ihn mit einem nachdenklichen Blick. »Keine Ahnung. Aber Sie können unbesehen alle älteren Staudämme dazu rechnen, von einer gewissen Größe an, und die neueren Dämme, die nicht nur zum Stau, sondern auch zur Elektrizitätsgewinnung dienen. Die haben ganze Systeme von Stollen und Schächten.«
»Angenehme Aussichten«, murmelte Phil, aber Mr. High überging die Bemerkung.
»Ich danke Ihnen, Mister Patterson. Würden Sie sich vorerst zu unserer Verfügung halten?«