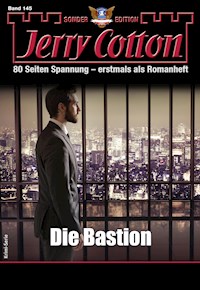
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jerry Cotton Sonder-Edition
- Sprache: Deutsch
Sie hatten eine neue Stadt gebaut - abgesichert durch modernste Alarmanlagen und schwer bewaffnete Wachmannschaften. Eine wahre Bastion gegen die Angst, die mehr und mehr in New York um sich greift. Phil und ich waren zur Einweihungsfeier geladen. Da schlugen die Gangster zu - demonstrierten, dass es gegen sie kein Bollwerk gab. Dass sie mächtiger waren als alle Alarmanlagen und alle Mauern. Phil und ich nahmen diese Herausforderung an. Es wurde ein Kampf auf Leben und Tod ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Die Bastion
Vorschau
BASTEI LÜBBE AG
Vollständige eBook-Ausgabeder beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
© 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: conrado / shutterstock
eBook-Produktion:3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 9-783-7517-0670-4
www.bastei.de
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Die Bastion
Sie hatten eine neue Stadt gebaut – abgesichert durch modernste Alarmanlagen und schwer bewaffnete Wachmannschaften. Eine wahre Bastion gegen die Angst, die mehr und mehr in New York um sich griff. Phil und ich waren zur Einweihungsfeier geladen. Da schlugen die Gangster zu – demonstrierten, dass es gegen sie kein Bollwerk gab. Dass sie mächtiger waren als alle Alarmanlagen und alle Mauern. Phil und ich nahmen diese Herausforderung an. Es wurde ein Kampf auf Leben und Tod ...
1
Es war an diesem Morgen schon so drückend heiß, dass die Unerträglichkeit der bevorstehenden Mittagshitze wie eine Drohung am azurblauen Himmel schwebte. Kein Windhauch milderte die Sonnenstrahlen. Das gechlorte Wasser ruhte bewegungslos wie ein türkisfarbener Spiegel zwischen nierenförmig angeordneten Fliesen.
»Noch einen Wunsch, Madam?«
Er stellte das Tablett mit dem Frühstücksgeschirr auf dem stelzenbeinigen Gartentisch unter dem Sonnenschirm ab. Seine gebräunten Hände lagen am Saum der weißen Jacke, und irgendwie erinnerte er in dieser Haltung an einen gehorsamen Rekruten, dem die ersten Gehversuche befohlen werden.
»Nein danke, Joaquin. Sorgen Sie bitte dafür, dass das Dinner pünktlich fertig ist, wenn die Kinder aus der Schule kommen.«
Joanne Cranford horchte dem Klang ihrer samtenen Altstimme nach. Dann schwang sie ihre langen Beine vom Liegestuhl, stand auf und bewegte sich zwei Schritte weit zum gepolsterten Stuhl am Gartentisch. Durch die dunklen Gläser ihrer Sonnenbrille musterte sie das schmale Gesicht des Puerto Ricaners. Sie bemerkte, dass sein Blick ihre Brüste und ihre Oberschenkel abtastete, und es gefiel ihr. Weil es ihr bewies, dass der Bikini ihre achtunddreißig Jahre nicht verriet. Nein, ganz und gar nicht. Es tat gut, die eigene Wirkung zu testen. Die Wirkung ihres Körpers auf einen Mann. Und dieser Puerto Ricaner war ein Mann, hundertprozentig. Wenn auch nur ein Hausangestellter. Nun, irgendwann ...
Joanne dachte es nicht zu Ende.
»Sehr wohl, Madam«, sagte Joaquin und verbeugte sich.
Joanne schickte ihn mit einem Lächeln weg. Sie freute sich über seine unverschämten Gedanken, die in seinem Gesicht wie in einem offenen Buch standen.
Die Schritte des hauseigenen Butlers entfernten sich, und das leuchtende Weiß seines Jacketts wurde vom satten Grün einer mannshohen Rhododendrongruppe verschluckt. Irgendwo im Haus klappte eine Tür zu. Stille.
Joanne verzehrte ein diagonal gevierteiltes Sandwich mit Salzbutter, anschließend sieben Unzen Corn Crispys mit einem Schuss fettarmer Milch. Dann endlich Kaffee, schwarz und stark, drei Tassen hintereinander. Und die Frühstückszigarette, nikotinarm, mit einem kühlen Hauch von Menthol.
Joanne erhob sich, drückte die Zigarette aus und zupfte das Oberteil ihres Bikinis zurecht. Mit den gedehnten Bewegungen einer gerade erwachten Katze lief sie auf den Rand des nierenförmigen Swimmingpools zu. Die Griffstangen der Leiter waren durch die Sonnenglut zu heiß zum Anfassen. Joanne ging am Fliesenrand des Pools in die Hocke, streckte das linke Bein vor und tauchte die hellrosa lackierten Fußnägel in das türkisfarbene Nass.
Der Stoß in den Rücken war beinahe sanft, jedenfalls schmerzlos.
Joanne verlor die Balance, erschrak zu sehr, um zu schreien, und stürzte kopfüber ins Wasser. Die Sonnenbrille rutschte ihr weg und sank mit torkelnden Bewegungen auf den Fliesengrund des Bassins.
Hastige Schwimmbewegungen brachten Joanne an die Oberfläche zurück. Prustend rang sie nach Luft, wischte sich die Augen frei, in denen das Chlor brannte. Sie wollte an ihre ruinierte Frisur denken, wollte den unverfrorenen Puerto Ricaner zurechtstutzen, dem anscheinend der Anblick eines Bikinis genügte, um alle Beherrschung zu verlieren.
Es blieb beim Wollen.
Wassertretend sperrte Joanne den Mund auf.
Der eine bediente sich aus ihrer Zigarettenschachtel und blies den Menthol gekühlten Rauch in die Morgenluft. Der andere lehnte an den Griffstangen der Leiter und grinste wie ein Straßenlümmel, der gerade einer alten Lady den Fürsorgescheck aus der Handtasche gezupft hatte.
Die Fassungslosigkeit ließ Joanne Wasser schlucken. Sie keuchte und hustete wenig damenhaft, bis sie sich entschloss, zur anderen Seite des Pools zu fliehen.
Der mit der Mentholzigarette im Mundwinkel stelzte um den engeren Bogen des Nierenbeckens herum und baute sich breitbeinig auf, um sie in Empfang zu nehmen. Joanne stoppte ihre Schwimmbewegungen, noch ehe sie den Rand des Pools erreichte.
»Joaquin!«, schrie sie. »Hilfe! Überfall!«
Der Zigarettenraucher nickte mit scheinheiligem Verständnis.
»Schrei, so viel du willst, Darling. Das macht frei. Ich kenne da einen Psychiater, der fährt mit seiner Kundschaft regelmäßig raus an den Hudson River, wo's ganz einsam ist. Und da lässt er sie schreien, bis sie heiser werden. Hinterher fühlen sie sich dann unheimlich befreit und locker.« Er lachte, wobei die Mentholzigarette in seinem Mundwinkel auf und ab hüpfte. »In unserem Fall ist das Geschrei ziemlich witzlos, Darling. Mein Freund und ich, wir haben nämlich im Haus für Ruhe gesorgt. Mit anderen Worten, es ist keiner mehr da, der zuhören kann.«
Joanne starrte den Mann an, und sie spürte plötzlich einen Druck, der sich wie ein stählerner Ring um ihren Hals legte. Erst jetzt begriff sie, dass das kein schlechter Scherz war.
Tausend Gedanken schossen ihr durch den Kopf.
Wie waren die Kerle überhaupt eingedrungen? Hatte die Alarmanlage nicht funktioniert? Weshalb hatte keiner der Hausangestellten geschrien oder Widerstand geleistet? Wie lange hatten sich die Strolche schon im Gebüsch des Villenparks verborgen gehalten?
Gedanken, die sinnlos waren.
Der Kerl, der den Rauch der Mentholzigarette inhalierte, trug einen Charles-Bronson-Schnauzbart im energisch kantigen Gesicht. Ansonsten dunkelblond, groß, schlank, weiße Jeans, hellblaues T-Shirt, das sich über breiten Schultern und muskulösen Oberarmen spannte.
Irritiert stellte Joanne fest, dass ihre Gedanken abschweiften. In eine Richtung, die dem Ernst der Lage gewiss nicht angemessen war.
»Was ... was ...?«, setzte Joanne stotternd an, während sie hastiger Wasser trat.
»Geschenkt, die Frage«, unterbrach sie der Schnauzbärtige. Sein Grinsen hatte etwas von der Siegesgewissheit eines Raubtiers. »Was wir von dir wollen, erfährst du noch. Erst mal solltest du dir überlegen, ob du freiwillig rauskommst oder ob du den Weltrekord im Dauerschwimmen aufstellen willst.«
Joanne drehte sich im Wasser, gehetzt, in die Enge getrieben.
Der andere lehnte noch immer an den Griffstangen. Er strahlte Brutalität aus. Vielleicht lag es an der fingerlangen Narbe auf seiner linken Wange. Der Schmiss stammte bestimmt nicht vom Rasieren. Der Mann war nur ein oder zwei Fingerbreit kleiner als sein Komplize, dafür noch breiter. Bartlos und mit militärisch kurzem Haar sah er aus, als wäre er eben erst aus dem Dschungel gekrochen, um den Ledernackenkampfanzug mit Jeans und Sommerhemd zu vertauschen.
»Wir können dich auch rausholen«, sagte der Dschungelkämpfer mit einer Bassstimme, die tief aus seinem Brustkorb rollte. »Aber dann geht's nicht ohne blaue Flecken ab. Wäre schade, dich so verunstalten zu müssen.«
Joanne wurde blass. Sie begriff, dass jedes Wort überflüssig war. Die Kerle hatten eine Art von Humor, hinter dem sich eine tödliche Drohung verbarg. Ihr lief eine Gänsehaut über den wohlgeformten Körper, trotz der hohen Wassertemperatur.
»Also, was ist?«, fragte der Schnauzbärtige höflich.
Joanne biss sich auf die Unterlippe, dass es schmerzte. Resignierend schwamm sie auf den Beckenrand zu. Ihr brünettes Haar hing in krausen Strähnen herab, als sie die Fliesenkante packte und sich hochzog. Schlagzeilen von spektakulären Entführungen tauchten vor ihrem geistigen Auge auf. Fotos von Entführten, denen man Ohren oder sonst was abgeschnitten hatte. Joanne dachte an die Lösegeldversicherung, die Dell vor zwei Jahren abgeschlossen hatte. Welcher Hohn! Vielleicht machte er mit den Gangstern gemeinsame Sache. Zuzutrauen war es ihm. Und das Geld konnte er gut gebrauchen. Er hatte es sogar verdammt nötig.
Sie zuckte zusammen, als die Schraubstockfäuste des Schnauzbärtigen ihre weichen Oberarme umfassten und ihr hochhalfen. Sobald sie festen Boden unter den Füßen hatte, versuchte sie verzweifelt sich loszureißen. Es war sinnlos. Der Vergleich mit den Schraubstöcken stimmte wirklich. Obwohl Panik in ihr aufflackerte, staunte Joanne darüber, wie ein Mann solche Kraft haben konnte. Aber das änderte nichts daran, dass sie Angst hatte. Wahnsinnige Angst.
»Nein!«, schrie sie. »Lassen Sie mich los, Sie dreckiger ...«
Joannes Schrei erstickte. Ihre Wange brannte wie Höllenfeuer. Der Schmerz trieb ihr Tränen aus den Augen. Der Schnauzbärtige hielt sie nur noch mit der Linken. Joanne sah seine drohend erhobene Rechte, bereit zu einer neuen Ohrfeige.
»Sag so was nicht noch mal, Baby«, zischte er, »keiner nennt mich dreckig. Schon gar nicht so ein Miststück wie du.«
Joanne erstarrte wie in einem Krampf. Ihr Magen schien plötzlich von einem Eisklumpen ausgefüllt zu sein. Sie hatte geahnt, dass die Kerle alles andere als Scherze machten. Jetzt allerdings, angesichts des hasserfüllten Tonfalls, den der Schnauzbärtige plötzlich anschlug, verspürte sie Todesangst. War es der Hass der untersten Gesellschaftsschicht auf jene, die sich im Wohlstand sonnten? Wenn es so war, dann steckte Dell vielleicht doch nicht dahinter, dann war das blutiger Ernst, kein Trick, um an die Versicherungssumme heranzukommen ...
»Vorwärts jetzt«, kommandierte der Schnauzbärtige und schob sie neben sich her.
Willenlos setzte Joanne einen Fuß vor den anderen. Der stahlharte Griff hatte ihren rechten Arm betäubt. Sie spürte, wie sich das Blut staute. Ihre Gedanken jagten sich, suchten nach einem Ausweg. Aber die Gangster hatten recht. Schreien war sinnlos, wenn im Haus niemand etwas hörte. Und Nachbarn gab es im Umkreis einer Viertelmeile nicht.
Teuflisches Verhängnis eines Grundstücks, das für einen Wahnsinnspreis absolute Ruhe und Abgeschiedenheit garantierte.
Der Dschungelkämpfer kam seinem Partner mit verschlagen funkelnden Augen entgegen.
Joanne spürte genau, worauf sich sein Blick heftete, und sie hätte alles darum gegeben, wenn es ihr in diesem Moment gelungen wäre, sich in die hässlichste Frau der Welt zu verwandeln.
»Mann!«, rief der Ledernackentyp begeistert. »Jetzt seh ich's erst richtig. So was Prächtiges! Mal schauen ...«
Seine Rechte zuckte vor, und im selben Moment packte der andere Joanne wieder mit beiden Fäusten. Sie war zur Bewegungsunfähigkeit verdammt, musste es erdulden.
Der Dschungelkämpfer tastete mit kräftigen, behaarten Fingern über das winzige Oberteil ihres Bikinis. Jäh krallten sich diese Finger hinter den Stoffstreifen in der Mitte. Ein kurzer, harter Ruck.
Joanne sah das zerrissene Oberteil zu Boden segeln. Und dann gruben sich die behaarten Finger in ihre großen Brüste. Gleichzeitig spürte sie den hastiger werdenden Atem des Schnauzbärtigen im Nacken. In ihrer Angst empfand sie eine seltsame Wut über das, was mit ihr geschah. Kein Mann hatte jemals das Recht gehabt, es gegen ihren Willen zu tun. Auch Dell nicht. Nein, Dell am allerwenigsten. Immer war es ihre genussvolle Waffe gewesen, mit einem Mann zu spielen, seine Gier auszunutzen. Und jetzt war es dieser brutale Kerl, der sie wie ein Spielzeug behandelte.
»O Mann«, keuchte er, »ich wär fast dafür, dass wir uns noch 'ne Weile in die Büsche schlagen, bevor wir verschwinden.«
Ein Schauer kalter Angst kroch mit tausend eisigen Spinnenbeinen über Joannes Rücken.
»Nein«, sagte der Schnauzbärtige schroff, »wir können uns noch tagelang mit ihr beschäftigen, wenn wir sie auf Nummer sicher haben.
»Aber ...«, wandte der andere ein.
Weiter kam er nicht.
Singend hell peitschte es über das Wasser des Pools.
Die Männer wirbelten herum, noch bevor der Schuss verhallte.
Nur instinktiv registrierte Joanne, dass sie plötzlich frei war. Und der gleiche Instinkt ließ sie reagieren. Es war weder Mut noch Geistesgegenwart oder beherrschte Überlegung. Einfach nur der Instinkt, der nichts als das Überleben wollte.
Sie warf sich zur Seite, weg vom Swimmingpool, in die vom Gartenarchitekten säuberlich angelegten Buschgruppen.
Ein zweiter Schuss peitschte, ließ Joannes Trommelfelle schmerzen. Zweige schrammten über ihre nackte Haut, doch sie achtete nicht auf den Schmerz. Wie von Furien gehetzt, kroch sie über die weiche Erde zwischen dem Gebüsch.
Sie hörte die erschrockenen Rufe der Eindringlinge. Hastige Schritte.
Dann eine harte, energische Stimme, die weit über den Villenpark hallte.
»Halt, stehen bleiben! Der nächste Schuss ist gezielt!«
Die hastigen Schritte brachen ab.
Joannes Verblüffung war größer als ihre Angst. Noch auf dem Boden liegend, drehte sie sich um, teilte die Zweige mit den Händen, um freies Blickfeld zum Pool zu haben.
Ihre Augen weiteten sich ungläubig.
Der Schnauzbärtige und sein Komplize standen mit erhobenen Händen am großen Bogen des nierenförmigen Bassins.
Der Mann vor dem Sonnenschirm war Dell Cranford.
In seiner Hand funkelte der langläufige Colt-Revolver aus Stainless Steel. Dieselbe Waffe, mit der er dauernd seine alberne Ballerei im unterirdischen Schießstand der Villa veranstaltete.
Doch in diesem Augenblick wirkte der Colt in der Hand ihres Ehemanns für Joanne Cranford keineswegs albern.
Staunend sah sie zu, wie Dell den beiden Kerlen befahl, die Waffen aus den Inside-Holstern zu ziehen und fallen zu lassen. Sie selbst hatte nicht einmal bemerkt, dass die Männer unter dem Hosenbund handliche kleine Pistolen getragen hatten.
»Verschwindet!«, befahl Dell eisig. »Verschwindet, bevor ich es mir anders überlege!«
»Mistkerl!«, fluchte der Dschungelkämpfer.
Das metallische Klicken klang überlaut, als ihr Mann wortlos den Hahn des Revolvers spannte.
Die Gangster fanden keine Widerworte mehr. Gehorsam trabten sie vor dem drohenden Revolverlauf zum Tor der Grundstückseinfahrt.
Joanne rappelte sich auf. Sie rieb sich den Staub der trockenen Erde von der nackten Haut, hastete zurück und griff nach der Zigarettenschachtel. Tief inhalierte sie den ersten Zug.
Sie hatte Dell unrecht getan. Einen Moment lang hasste sie sich dafür.
Nur einen Moment lang.
2
Indian Summer, Indianersommer. Septemberwochen, in denen die Sonne noch einmal ihre ganze Macht demonstriert. Dazu hohe Luftfeuchtigkeit, die mit dem Smog über der Ostküste gemeinsame Sache macht. Alles in allem eine drückende Last für den geplagten amerikanischen Bürger, der ohnehin unter dem Stress zu keuchen hat.
Indian Summer, die Zeit der vollklimatisierten Büroräume, der wehmütigen Erinnerung an den Urlaub in Florida oder auf den Bahamas.
Ich hatte es vergleichsweise gut getroffen an diesem Vormittag. Rundherum Wasser, mit einem Hauch von Frische. Wenn auch Hudson-River-Wasser, mit dem Geruch von Tang, Schmieröl, Chemikalien und Undefinierbarem aus den Untergrundrohren jener Städte, die erst vom Bau einer Kläranlage träumen.
Immerhin war wenigstens das Gefühl da. Die Vorstellung, dass es vor hundert Jahren noch Leute gegeben haben muss, die am Ufer dieses Flusses der Verlockung eines erfrischenden Bads nicht zu widerstehen brauchten. Heute soll es Leute geben, die den Bauch ihrer Motorjacht schon für zu schade halten, um ihn in die Hudson-Brühe zu tunken.
Mein Schuhleder, an Manhattan-Betonpflaster gewöhnt, knirschte über dunkelbraunen Ufersand. Eine Brise fächerte in den offenen Kragen meines weißen Sommerhemds, und der hellblaue Sommeranzug war Luxus mit seiner Leichtigkeit, die einem um den Körper schwebte. Kein Gedanke mehr an den Krawattenzwang zu Hoovers Zeiten.
Der Rundgang um die Insel dauerte genau eine Stunde und vierzig Minuten. Bei flottem Marschtempo. So lautete die exakte Auskunft, die mir der Chef der Wachmannschaft mit auf den Weg gegeben hatte. Für flottes Marschieren hatte ich keinen Anlass. Der Tag war sowieso verschenkt. Morgen sollte es erst richtig losgehen. Für meine Begriffe hätte es also gereicht, wenn ich erst vierundzwanzig Stunden später auf der Hudson-Insel eingetroffen wäre. Washington hatte den Termin jedoch festgesetzt. Director Clarence M. Kelley persönlich. Weil sich meine Aufgaben diesmal vor allem auch auf das Repräsentieren ausdehnten, musste ich rechtzeitig an Ort und Stelle sein.
Der FBI-Repräsentant Cotton lief also die idyllische kleine Flussinsel ab, die in etwa vierundzwanzig Stunden öffentliches Interesse erwecken sollte.
Ich musste mir ein Bild machen, musste die Insel genau kennen. Nicht jeden Baum und jeden Strauch, aber doch so viel, dass ich jedes Planquadrat kannte.
Ich war inzwischen gut fünfhundert Yards von dem Damm entfernt, der das Ostufer des Hudson mit der Insel verband. Der Damm hatte eine zweispurige Fahrbahn. Mehr nicht. Fußgänger waren nicht eingeplant.
Vor mir trieb ein weiß schimmernder Fleck auf der Wasseroberfläche. Der Fleck wurde auf den grauen Ufersand gespült und entpuppte sich als toter Fisch, mindestens drei Pfund schwer. Wahrscheinlich hatte er zu viel von den Chemikalien geschluckt, mit denen gewisse Fabriken nach Herzenslust das Flusswasser anreichern.
Ich ließ die aufgeblähte weiße Fischleiche hinter mir zurück und erreichte die erste Biegung des Uferstreifens. Grüngürtel und Maschendrahtzaun versperrten mir den Blick zurück zum Zufahrtsdamm mit der Wachbaracke.
Vor mir lag die kleine Bucht im nordöstlichen Oval der Insel. Ein Halbkreis im Ufersand, wie von Menschenhand angelegt. War es auch. Es existierte keine einzige Stelle rings um die Insel, wo der Uferstreifen nicht genau fünf Yards Breite maß, vom Wasser bis zum Zaun gerechnet. Auf diesen fünf Yards gab es nicht einen Schimmer von Vegetation. Ab morgen konnte es sich bestenfalls ein Regenwurm leisten, unterhalb der Sandoberfläche seine Gänge zu graben. Alles, was sich auf dem Sand bewegte, sollte von hochwirksamen Radargeräten unbestechlich registriert werden. Dann durfte sich selbst ein aufgeblähter Fisch hier nicht mehr zur letzten Ruhe begeben.
Die Bucht bot eine gewisse Unregelmäßigkeit im tristen Einerlei des kahlen Inselufers. Zur Linken war ein zweiflügliges Tor im Maschendrahtzaun mit einem Sicherheitsschloss aus nichtrostendem Stahl verriegelt. Und wer einen Schlüssel zu diesem Tor besaß, brauchte trotzdem eine Genehmigung, es zu öffnen, damit vorher die elektronischen Sensoren ausgeschaltet wurden.
Der hölzerne Anleger, der zur Rechten in die Bucht hinausragte, sah dagegen so alltäglich aus wie eine Verkehrsstauung auf dem Times Square in Manhattan. Auf Pfählen, die in den Grund gerammt worden waren, ruhte eine Bohlenplattform von drei mal zehn Yards Ausdehnung. Lang genug, damit die Patrouillenboote der Flusspolizei anlegen konnten. Im Bedarfsfall, wie es in jenem dicken Wälzer hieß, in dem die Sicherheitseinrichtungen der Insel bis ins Detail beschrieben wurden. Liegeplätze für private Wasserfahrzeuge der Inselbewohner waren nicht vorgesehen. Eben aus Sicherheitsgründen. So eine Motorjacht ließ sich leicht von der Wasserseite her entern, ohne dass es sofort bemerkt wurde.
Im Gedenken an meinen Einsatzbefehl nahm ich den Anleger unter die Lupe. Die Bohlen waren glitschig, obwohl das Ding erst vor einem Monat gebaut worden war. Die ständig hohe Luftfeuchtigkeit des Indian Summer ging selbst an bestem amerikanischen Pinienholz nicht spurlos vorüber. Ich marschierte bis zum vorderen Rand des Anlegers und inspizierte die zwölf Autoreifen, die in Reih und Glied als Rammschutz für anlegende Boote aufgehängt worden waren.
Verglichen mit den übrigen Einrichtungen der Insel, erschien mir das reichlich konventionell. Gemessen an den hoch entwickelten technischen Spielereien, mit denen sie die Insel zur Festung machten, wirkte so ein Bohlenanleger mit alten Autoreifen seltsam. Etwa so wie die Spielzeugrechenmaschinen mit den bunten Holzknöpfen zum Hin-und-her-Schieben, die die Programmierer aus Jux über ihre Computer hängen und ein Schild Für Notfälle darüberkleben.
Angesichts dieser Primitivität meldete sich in mir die Frage, wie der freie Raum zwischen der Unterseite der Bohlenplattform und der Wasseroberfläche gesichert werden sollte. Ich ging an der Kante des Anlegers auf und ab und spähte nach kleinen Metallkästen mit Radarbewegungsmeldern. Nichts dergleichen vorhanden. Ich kam mir schon jetzt wie ein Lästerer vor, wenn ich mir vornahm, die genialen Alarmanlagentechniker auf diesen Tatbestand hinzuweisen.
Unter dem Anleger plätscherte es.
Vor mir, auf der freien Wasserfläche des Hudson, waren keine Wellen. Die Brise reichte gerade aus, um die Brühe ein bisschen zu kräuseln.
Trotzdem dieses Geplätscher.
Ich dachte an die fehlenden Radarkästchen, an die banale Lücke im Sicherheitssystem. Ein innerer Reflex, aus der Berufserfahrung entwickelt, ließ meine Rechte unter das leichte Jackett tasten.
Noch bevor ich den kühlen Stahl des 38ers fühlte, registrierte ich eine Bewegung. Auch ohne Radar. Rechts. An der Seite des Anlegers.
Ich wirbelte herum.
Eine schwarze Öffnung von neun Millimeter Durchmesser gähnte mich an. Hinter der Öffnung die unverkennbaren Konturen einer Beretta 951.
Mit der Linken schob der Mann den wasserdichten Plastikbeutel beiseite, in dem er seinen Waffenstahl vermutlich transportiert hatte. Unter Wasser. Letzteres ließ sich aus dem Neoprenanzug schließen, den er trug. Schwarz, mit zwei gelben Streifen in der Mitte der Kopfhaube. Irgendwie erinnerte er mich dadurch an einen Salamander. Obwohl dies wahrhaftig nicht der Zeitpunkt war, solche Vergleiche anzustellen.
Einen Moment lang sah er irritiert aus. Ich bemerkte, wie sich sein Blick auf meine Rechte heftete, die ich unter dem Jackett hatte erstarren lassen. Oder war er irritiert, weil ich nicht vor Schreck einen Kollaps erlitt?
»Okay, Bruder, streck sie hoch«, sagte der Salamander, und sein Tonfall klang so, als würde er mich zu einer Pokerparty einladen.
Ich gehorchte. Aus zwingenden Gründen. Der eine war die Beretta. Die anderen waren jetzt hinter mir. Es rauschte und gurgelte in der Hudson-Brühe, und dann patschte es auf die feuchten Holzbohlen.
Ich riskierte eine halbe Kopfdrehung und erblickte zwei weitere Salamander, die mit ihren Flossenfüßen heranwatschelten. Bewaffnet war nur der eine von ihnen. Mit einer Harpune. Die rasiermesserscharfe Stahlspitze des Unterwasermordinstruments war auf meinen Rücken gerichtet.
Ich spürte ein Kribbeln unter der Kopfhaut. Und ich begann zu schwitzen, obwohl ich die Hitze bislang recht gut ertragen hatte.
Zum Nachdenken kam ich nicht. Warum und Wieso zählen nicht mehr, wenn man von Neun-Millimeter-Stahlmantelblei oder von einer Harpune durchbohrt worden ist.
»Schleppst du ein Schießeisen mit dir rum, Bruder?«, fragte der mit der Beretta spöttisch. Er hing noch immer mit den Ellenbogen auf der Kante des Anlegers, die Schwimmflossen vermutlich im Wasser.
»Erraten«, sagte ich, denn ich gewann keine Zeit, wenn ich es mit Wortgeplänkel versuchte.
»Nett, dass du ehrlich bist, Bruder. Du traust dem Frieden nicht, stimmt's? Eure hübsche kleine Insel ist dir noch immer nicht sicher genug, richtig?«
Ich zuckte mit den Schultern, war mir noch nicht ganz darüber im Klaren, worauf der Typ hinauswollte.
Die beiden anderen verharrten mit drei Schritt Abstand hinter mir. Ohne ihre Waffen wären sie mir mit ihren Schwimmflossen hoffnungslos unterlegen gewesen. Schwacher Trost.
»Okay, dann nimm dein Schießeisen schön vorsichtig raus und leg es vor deine Füße, Bruder.« Der Lauf der Beretta beschrieb einen auffordernden Schwenker.
Ich gehorchte, langte in Zeitlupe unter das Jackett und fischte den 38er mit Daumen und Zeigefinger aus dem Schulterholster.
Der Salamander grinste zufrieden, als der Kurzläufige ans Tageslicht kam. Doch nur zwei Sekunden lang. Dann war sein Grinsen wie weggefegt. Ihm schien zu dämmern, in welchen Kreisen ein Smith & Wesson, Kaliber .38 Special mit Zwei-Inch-Lauf, zur üblichen Ausrüstung gehört.
Ich ließ ihm keine Zeit, die Erkenntnis zu verdauen.
Blitzartig drehte ich mich seitwärts, stieß mich im selben Moment mit den Beinen ab. Mit geballter Muskelkraft katapultierte ich mich in flachem Kopfsprung dem Hudson River entgegen.
Im spitzen Winkel tauchte ich ein, wartete vergeblich auf das Krachen eines Schusses.
Sofort kippte ich meine ausgestreckten Handflächen rechtwinklig nach unten ab. Die Ruderwirkung ließ mich durch den eigenen Schwung fast senkrecht dem Grund des Flusses entgegenrauschen. Tintenschwärze umgab mich. Trotzdem hatte ich noch immer das beklemmende Gefühl, dass meine Beine und Füße noch über Wasser waren und eine prächtige Zielscheibe abgaben.
Irrtum zu meinen Gunsten.
Etwas sirrte haarscharf links an mir vorbei, riss einen Strudel von Luftblasen hinter sich her.
Meine Fingerspitzen bohrten sich in den schwarzen Schlamm. Sofort beschrieb ich eine Kehrtwendung und bewegte mich mit kräftigen Schwimmzügen in die Richtung zurück, aus der ich gekommen war. Meine Atemreserve reichte im Höchstfall noch für eine Sekunde. Aber wenn meine Kalkulation aufging, tat ich genau das, womit die Kerle in den Neoprenanzügen vermutlich am allerwenigsten rechneten.
Der leichte Sommeranzug war ein Pluspunkt. Er behinderte mich kaum. Ich tauchte dicht über dem schlammigen Grund entlang und hoffte nur, dass die Wassertiefe unter dem Anleger ausreichte, damit sie mich nicht sofort bemerkten.
Immer noch wartete ich vergeblich auf Kugeln, die über mir in die Wasseroberfläche klatschten.
Dafür registrierte ich zwei Dinge fast zur gleichen Zeit.
Meine Fingerspitzen berührten glitschiges Holz. Die vorderen Stützbalken, auf denen der Anleger ruhte.
Jemand sprang ins Wasser. Das Klatschen drang unter Wasser überlaut an meine Ohren.
Ich schwamm noch zwei Züge weiter, bewegte mich so spärlich wie möglich und tauchte auf. Halbdunkel umgab mich. Tief pumpte ich die Luft in meine Lungen. Meine Füße berührten nicht den Grund. Die Wassertiefe war also ausreichend.
Blitzschnell sah ich mich um.
Es waren zwei Mann, die vom Anleger gesprungen waren. Die beiden, die hinter mir gestanden hatten. Ich sah gerade noch, wie sie tauchten und in Richtung Flussmitte davonpaddelten. Der eine hatte seine Harpune neu geladen.
Offenbar rechneten sie mit einer hundertprozentig sicheren Beute.
Ich wandte den Kopf nach rechts. Aluminiumfarbene Atemluftgeräte hingen an einer vorstehenden Verstrebung unter den Bohlen des Anlegers.
Von dem Typ mit der Beretta war kein Neoprenzipfel zu sehen.
Es gab nur eine Erklärung dafür. Er hatte sich auf den Anleger gewagt, um bessere Übersicht zu haben.
Ich überlegte nicht lange. Mit behutsamen Schwimmbewegungen glitt ich lautlos dem landseitigen Ende des Anlegers entgegen. Der Raum zwischen der Unterseite der Bohlen und der Wasseroberfläche wurde zusehends enger. Dann spürte ich Schlamm unter den Füßen. Ich watete, noch vorsichtiger jetzt.





























