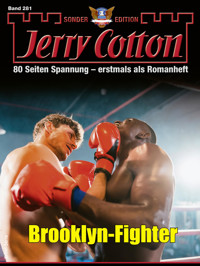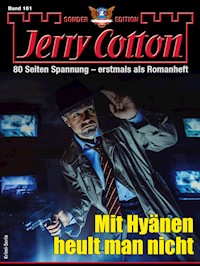
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jerry Cotton Sonder-Edition
- Sprache: Deutsch
John Hayden galt als vollendeter Gentleman. Bis ihn seine Vergangenheit einholte. Die Unterwelt zwang ihn zu einem Job, in dem er einst Experte gewesen war. Er musste Banknoten fälschen. Aber er dachte nur an Flucht. Endlich gelang sie ihm. Doch die Verfolger jagten ihn gnadenlos. Als sie ihn stellten, wehrte er sich bis zum Letzten. Denn mit Hyänen heult man nicht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Mit Hyänen heult man nicht
Vorschau
Impressum
Mit Hyänen heult man nicht
John Hayden galt als vollendeter Gentleman. Bis ihn unvermittelt seine Vergangenheit einholte. Die Unterwelt zwang ihn zu einem Job, in dem er einst Experte gewesen war. Er musste Banknoten fälschen. Aber er dachte nur an Flucht. Endlich gelang sie ihm. Doch die Verfolger jagten ihn gnadenlos. Als sie ihn stellten, wehrte er sich bis zum Letzten. Denn mit Hyänen heult man nicht ...
1
Susan Fenner tanzte zu den Klängen einer alten Elvis-Platte im Radio. Sie trug nur einen Slip am Leib. Susan wollte in ihrem Einzimmerapartment duschen, sich umziehen und für den Abend mit Stan Franklin besonders hübsch machen. Sie hatte noch reichlich Zeit.
Die Musik und die Stimme des kürzlich verstorbenen Rock-›n‹-Roll-Königs gingen ihr ins Blut. Sie musste tanzen.
Bei der lauten Musik hörte sie den Türgong erst, als er zum wiederholten Mal anschlug. Susan zog eine Schnute. Wollte sich der alte Sauertopf vom unteren Stockwerk etwa schon wieder beschweren, weil ihr Radio zu laut war? Oder kam Stan eine Dreiviertelstunde zu früh?
Susan ging, so wie sie war, zur Tür. Falls Sauertopf draußen stand, sollte er ruhig einen Schock kriegen. Und Stan würde freudig überrascht sein, wenn er sie fast hüllenlos sah. Mit anderem Besuch rechnete Susan nicht.
Sie riss die Tür auf.
»Hal...«
Das Wort blieb ihr im Hals stecken. Es waren weder Stan noch der alte Sauertopf, sondern zwei völlig fremde Männer. Sie trugen die dunkelblaue Uniform des Ambulance Service und Schildmützen mit dieser Aufschrift. Eine Trage mit zusammenklappbarem Aluminiumgestell lehnte neben der Tür an der Wand.
Der größere der beiden Männer bearbeitete einen Kaugummi. Er und sein Kollege stutzten, als sie das fast nackte Girl sahen. Aber nur einen Augenblick. Dann schlug der Große zu. Es war ein Schlag ohne Ansatz, der Schlag eines Profis, der auch einen starken Mann auf die Bretter geschickt hätte.
Er traf Susan genau auf den Punkt und warf sie nach hinten ins Apartment. Sie riss einen imitierten Chippendalestuhl um und blieb bewusstlos liegen. Der Schläger gab seinem Komplizen einen Wink. Die beiden angeblichen Sanitäter nahmen die Trage und kamen herein. Der Kleinere schloss die Tür.
Sein bleiches Gesicht verriet, dass er einen längeren Gefängnisaufenthalt hinter sich hatte. Er drehte das überlaute Radio leiser, während sein Kollege die Trage aufklappte.
Beide Männer trugen helle Handschuhe. Der Größere hatte ein kantiges Gesicht mit dunklen Bartschatten und zusammengewachsenen, buschigen Augenbrauen. Seine starken Kiefer bewegten sich rhythmisch.
Die beiden Gangster legten die Bewusstlose auf die Tragbahre. Der Blonde mit dem bleichen Gesicht zog eine Einwegspritze aus der Tasche und stach sie der Frau in die Armbeuge, ohne zu desinfizieren. Er pumpte ein Betäubungsmittel in ihren Kreislauf.
Dabei wackelte er mit dem Kopf und den Schultern.
»Was hast du denn?«, fragte der Große misstrauisch. »Nervöse Zuckungen?«
»Diese Musik«, sagte der Blonde, während er die Nadel aus der Vene zog und aufstand. »Da kannst du sagen, was du willst, Elvis war der Größte. Nach ihm kommt nichts mehr.«
»Eine Heulboje war er«, brummte der Große. Er wickelte Susan Fenner fachmännisch in die helle Decke ein und schnallte sie auf der Bahre fest. »Und zum Schluss war er so fett, dass er aus allen Nähten platzte. Ich verstehe den ganzen Rummel um seinen Tod nicht.«
»Weil du eben keine Ahnung von wirklich guter Musik hast«, sagte der Blonde. »Wenn ich dich so über King Elvis reden höre, läuft mir die Galle über. Und mit so was muss man zusammenarbeiten. Elvis steckt die Beatles und die Rolling Stones und wie sie alle heißen doch glatt in die Tasche. Dass er zum Schluss ein wenig dick war, hat bei so einem Idol nichts zu bedeuten.«
»Jetzt halt aber die Klappe!«, sagte der Große. »Sind wir hier, um über Elvis Presley zu reden oder um die Kleine da zu kidnappen?«
Der Blonde schwieg. Es war ihm jedoch anzusehen, dass er sauer auf den Großen war. Der große Gangster schaute sich im Apartment um und warf einen Blick ins Bad.
»Okay«, sagte er. »Die Luft ist rein. Abmarsch!«
Die beiden als Sanitäter verkleideten Gangster nahmen die Trage und verließen das Apartment. Die letzten Töne des Elvis-Presley-Songs verklagen. Die Entführung hatte vom Klingeln an knapp anderthalb Minuten gedauert.
Ich saß im Bereitschaftsraum mit Steve Dillaggio und Fred Nagara beim Pokern. Wir spielten nur um Streichhölzer, trotzdem wollte keiner verlieren. Trotz dreier Könige in der Hand war ich mir nicht so recht sicher. Steve Dillaggio hatte nicht viel, das wusste ich. Fred Nagara zog sein Nussknackergesicht. Wie immer wenn er ein besonders gutes Blatt hielt und es auf keinen Fall verraten wollte.
Es war Samstagabend. Der Chef vom Dienst hatte mich für den erkrankten Kollegen Tim Holder zum Bereitschaftsdienst eingeteilt. Später wollte ich in meinem Office noch einigen liegen gebliebenen Papierkram aufarbeiten, wenn nichts dazwischenkam.
Normalerweise wird beim FBI kein Poker gespielt. Aber der Bereitschaftsdienst ist eine besondere und meist sehr langweilige Angelegenheit.
Das Telefon auf dem Tisch klingelte. Steve Dillaggio nahm ab.
»Für dich, Jerry«, sagte er und gab mir den Hörer.
Ich stellte den Kaffeebecher weg. Die Zentrale meldete sich und stellte gleich durch. Die aufgeregte Stimme, die aus dem Hörer drang, kannte ich.
»Jerry«, sagte Stan Franklin, ein junger Kriminalreporter, den ich bei verschiedenen Fällen kennengelernt hatte, »ein Glück, dass ich dich erreiche. Ich hatte zuerst in deiner Wohnung angerufen und glaubte schon, du wärst ausgegangen.«
»Das hatte ich auch vor«, sagte ich und dachte an Tim Holder und seine Grippe. »Wo drückt der Schuh, Stan?«
Wir waren keine dicken Freunde, hatten jedoch Sympathie füreinander. Stan Franklin bewunderte mich. Er wäre selbst gern ein G-man geworden, hatte er mir einmal gesagt. Zu seinem Leidwesen erfüllte er die Voraussetzungen nicht, nach denen das FBI seine Anwärter auswählte. Ich schätzte seine offene, gerade Art.
Stan Franklin war kein Sensationsgeier wie manche andere in seiner Branche.
»Ich bin mir sicher, dass meine Freundin entführt worden ist«, sagte er. »Susan Fenner, hundertneununddreißig Southern Avenue in der südlichen Bronx. Es ist ein Apartmenthaus. Du musst dir das ansehen, Jerry.«
»Gibt es Anzeichen für eine gewaltsame Entführung?«, fragte ich. »Kampfspuren? Zeugen? Soll ich gleich mit den Spurensicherungsexperten anrücken und eine Fahndung auslösen?«
»Nein, nein. Es gibt keinerlei Spuren und auch keine Zeugen. Ich bin mir trotzdem sicher, dass es eine Entführung ist. Du musst herkommen.«
Stan Franklin war kein Spinner, der Gespenster sah, weil ihn sein Mädchen versetzt hatte. Außerdem lag für mich nichts anderes vor.
»Ich bin in knapp zwanzig Minuten da«, sagte ich und beendete das Gespräch.
Dann meldete ich mich bei der Einsatzzentrale telefonisch ab. Steve Dillaggio hatte gepasst. Auch ich warf die Karten hin. Fred Nagara strich grinsend die Streichhölzer ein. Er konnte es nicht lassen, uns sein Blatt zu zeigen.
Zwei lumpige Siebener. Dagegen waren meine drei Könige ein erstklassiges Blatt.
»Wenn du so weitermachst, kannst du bald mit Zündhölzern handeln, Fred«, sagte ich.
Ich suchte mein Office auf, schnallte den 38er um und zog mein helles Jackett an. Dann lief ich die Treppen hinunter zu meinem roten Jaguar, der im Hof parkte. Ich blinkte zweimal kurz und einmal lang. Die Selenzelle am Tor reagierte. Das Tor, das die Auffahrt zur 70th Street versperrte, glitt zurück. Das FBI Building gehört zur 69th Street.
Ich fuhr zum mehrspurigen East River Drive und darauf Richtung Bronx. Es war Ende Mai, und es herrschte mildes Frühlingswetter. Kurz zuvor war ein Regenschauer niedergegangen. Die nasse Fahrbahn glänzte. Sie spiegelte Scheinwerfer und Straßenlampen wider. Links von mir ragten die Hochhäuser und Wolkenkratzer mit den unzähligen beleuchteten Fenstern auf. Rechts war der East River.
Wegen des starken Verkehrs brauchte ich etwas länger. Fünfundzwanzig Minuten nach meinem Telefonat stoppte ich vor dem dreiflügeligen Apartmenthaus gegenüber dem Bronx Park. Stan Franklin stand am Eingang und erwartete mich.
»Deine Freundin ist aus der Wohnung entführt worden?«, fragte ich.
Stan nickte. Er hatte einen Haustürschlüssel und einen Schlüssel für Susan Fenners Apartment. Wir gelangten mit dem Fahrstuhl in den vierten Stock. Im Apartment spielte das Radio. Es war eine Vierzig-Quadratzoll-Wohnung mit einer Kochnische und einem kleinen Bad.
Susan Fenner hatte die Wohnung modern und geschmackvoll eingerichtet, ohne viel Geld dabei auszugeben. Das bunte abstrakte Gemälde über der Bettcouch hatte sie sicher einem Village-Künstler abgehandelt.
Ich sah mich überall um, konnte aber nichts Ungewöhnliches entdecken.
»Wie kommst du darauf, dass sie entführt wurde, Stan?«, fragte ich.
Stan Franklin war fünfundzwanzig Jahre alt und gut sechs Fuß groß. Er wirkte sehr sportlich. Er hatte kurz geschnittenes braunes Haar und ein offenes Gesicht. Jetzt sah er besorgt und unruhig aus.
»Susan ist bestimmt nicht nur mit einem Slip bekleidet draußen rumgelaufen«, sagte er. »Hier liegt das Kleid, das sie anziehen wollte. Die anderen sind im Schrank. Da fehlt nichts. Jemand muss sie entführt haben.«
»Vielleicht hat sie etwas anderes angezogen«, sagte ich. »Sie kann bei einer Freundin oder bei Bekannten irgendwo im Haus sein. Oder vielleicht ist einem guten Bekannten oder Verwandten von ihr etwas passiert. Als man sie darüber verständigte, hat sie die Wohnung Hals über Kopf verlassen.«
»Sie hat keine Freunde hier im Haus«, sagte Stan Franklin verbissen. »Ich weiß es, denn ich kenne Susan seit dreieinhalb Monaten und war oft hier bei ihr. Susan ist Waise. Ihr einziger Verwandter ist ein Onkel in Brooklyn. Ich habe über eine Stunde gewartet, bevor ich dich angerufen habe, Jerry. Susan und ich, wir lieben uns sehr. Wir haben sogar schon über Heirat gesprochen. Sie wusste, dass ich um neunzehn Uhr dreißig zu ihr komme und dass ich mir Sorgen mache, wenn ich sie nicht antreffe. Sie hätte entweder eine Nachricht hinterlassen oder angerufen und mich verständigt.«
Ein Telefonapparat stand auf dem Ecktischchen. Stan Franklins Beweisführung hatte etwas für sich. Es war zumindest sehr merkwürdig, dass Susan Fenner offenbar nur im Slip ihre Wohnung verlassen hatte, in der das Radio spielte und das Licht brannte.
Susan nahm keine Drogen, wie ich von Stan Franklin erfuhr. Sie hatte auch keinerlei Kontakte zur Unterwelt. Nach dem Abschluss der Highschool hatte sie zu jobben begonnen und arbeitete jetzt als Sekretärin bei einem Elektrogerätekonzern in der City von Manhattan.
Nur warum sollte jemand ein Interesse daran haben, sie zu entführen?
Mehr als ein paar Hundert Dollar hatte Susan Fenner bestimmt nicht auf ihrem Konto. Augenzeugin eines Verbrechens war sie auch nicht gewesen. Denn das hätte sie Stan sofort brühwarm erzählt.
Wir klingelten an der Tür nebenan. Ein älterer Mann im Hausmantel und mit Pantoffeln an den Füßen öffnete uns. Er war kurz angebunden, weil er die Baseballübertragungen im Fernsehen anschauen wollte. Er fühlte sich ungemein gestört.
Der Mann kannte Susan Fenner nur flüchtig vom Sehen und wusste nicht, wann sie an diesen Abend ihre Wohnung verlassen hatte. Auch nicht, ob jemand bei ihr gewesen war. An der nächsten Tür und bei zwei Wohnungen gegenüber der von Susan Fenner hatten wir ebenso wenig Glück.
In zwei Wohnungen war niemand zu Hause. Bei der dritten öffnete uns eine Lady, deren Ginfahne einen Vollmatrosen vom Mast gehauen hätte. Sie lachte lauthals und schrill ohne jeden Grund. Sie konnte uns nichts sagen. Vielleicht sah sie gelegentlich weiße Mäuse, aber bestimmt keine Entführer.
Nach diesen erfolglosen Bemühungen hielten wir in der Wohnung von Susan Fenner Kriegsrat.
»Kannte Susan denn niemanden im Haus näher?«, fragte ich. »Du sagtest, sie sei ein kontaktfreudiger Mensch. Sie wohnt schon länger als vier Monate hier. Da muss sie doch irgendjemand kennengelernt haben.«
»Du weißt, wie es in solchen Apartmenthäusern ist, Jerry. Jeder interessiert sich nur für seine eigenen Angelegenheiten. Die Leute wissen nicht einmal, wer alles im Haus wohnt. Außerdem bin ich mit Susan vertrauter als jeder andere Mensch. Wie könnte ein flüchtiger Bekannter mehr von ihr wissen als ich?«
Ich verschwieg Stan, dass ich einen bestimmten Verdacht hatte. Jemand im Haus konnte Susan in seine Wohnung gelockt oder verschleppt haben und dort festhalten. Ein abgeblitzter Verehrer vielleicht, der mit Gewalt zum Ziel kommen wollte.
Oder vielleicht gab es einen Sittenstrolch im Haus. Ein anderes Motiv als Susans Schönheit konnte ich mir für eine Entführung nicht denken. Ich wollte mich schon telefonisch an den Hausmeister wenden, um ihm Fragen zu stellen, da fiel Stan Franklin etwas ein.
»Eine Bekannte Susans gibt es in diesem Haus. Eine gewisse Sandy. Ich kenne nur den Vornamen. Sie und Susan haben vor längerer Zeit in der gleichen Firma gearbeitet. Sandy hat Susan die Wohnung hier vermittelt. Aber Susan hat den Kontakt zu ihr abgebrochen.«
»Warum?«
»Sandy ... Na ja, sie steht nur auf Frauen. Sie hat sich Hoffnungen gemacht, als Susan eingezogen ist, obwohl sie keinerlei Grund dazu hatte. Als ich dann auftauchte, war sie bitter enttäuscht. Sie zog bei Susan eine große Szene ab. Und damit war die lockere Freundschaft vorbei.«
Mein Blick fiel auf Susans weiße Handtasche, die auf der Bettcouch lag. Ich öffnete sie. Ein kleines Notizbüchlein mit einem hellblauen Kunststoffeinband befand sich darin. Darauf hatte ich gehofft. Ich blätterte in dem Notizkalender.
Die vorderen Seiten waren mit Adressen vollgeschrieben, von denen einige wieder ausgestrichen waren. Auch die von Miss Sandra Simone, 139 South. Ave. Apt. 134. Susan Fenner hatte mit der lesbischen früheren Arbeitskollegin wirklich nichts mehr zu tun haben wollen.
Die dreizehnte Etage war auf dem Druckschalter des Fahrstuhls mit 12 A bezeichnet. Wegen der abergläubischen Gemüter, von denen es selbst im Atomzeitalter viel mehr gibt, als man glaubt. Der Fahrstuhl stoppte auf der Etage. Wir wandten uns zum Ostflügel, wo sich das Apartment 134 befinden musste.
Der Wohnsilo enthielt knapp zweihundertfünfzig Wohneinheiten. Ich hätte ihn zur Mittelklasse gezählt. Unsere Schritte hallten auf den Kunststoffplatten.
Als wir in den Ostflügel einbogen, trat ein Mann aus einer Wohnung. Ich überschlug rasch die Nummern an den Türen. Er kam aus Nummer 134, dem Apartment von Sandra Simone.
Das hatte noch nichts zu bedeuten. Aber der Mann blieb stehen und schaute uns zögernd entgegen. Er war groß und breitschultrig. In seinem kantigen Gesicht wuchsen die Augenbrauen zusammen. Vertrauenerweckend sah er nicht gerade aus.
Man konnte ihn ohne Weiteres für einen hartgesottenen Gangster halten. Er drehte sich um und ging mit betonter Ruhe in die andere Richtung zum Ende des Korridors. Ich wollte ihm lautlos nacheilen.
Auch Stan Franklin hatte beobachtet, dass der Große mit dem kantigen Gesicht bei Sandra Simone gewesen war. Und da beging er einen Fehler.
»He, Sie, Mister!«, rief er.
Der Große warf einen Blick über die Schulter. Ich sah seine Rechte unter die dunkle Jacke zucken. Doch dann riss er die Tür ganz am Ende des Korridors auf und verschwand.
Ich spurtete los. Ich rief Stan Franklin zu, er solle bei Sandra Simone klingeln, und zog meinen 38er. Der Große hatte bestimmt nicht unter die Jacke gefasst, um sich vom Vorhandensein seiner Brieftasche zu überzeugen.
Hinter der Tür war eine enge Treppe, eine bessere Hühnerleiter. Der Gangster polterte die Treppe hinunter. Es handelte sich um eine Nottreppe, die es gemäß den Sicherheitsvorschriften in jeden Gebäudeflügel geben musste.
»Stehen bleiben, FBI!«, rief ich.
Ein Schuss krachte. Der Gangster hatte blind gefeuert. Die Kugel prallte jedoch von der Wand ab und jaulte als Querschläger gefährlich nah an meinem Kopf vorbei. Der Schuss dröhnte ohrenbetäubend.
Jetzt wusste ich endgültig Bescheid.
Der Gangster hastete die dreizehn Treppen bis ins Erdgeschoss hinunter und verursachte dabei einen Höllenlärm. Er nahm immer mehrere Stufen auf einmal und sprang auf die Treppenabsätze, dass es dröhnte. Ich blieb ihm hart auf den Fersen.
Ich hörte ihn keuchen. Auch mein Puls ging schneller. Sekunden ehe ich um die Ecke am letzten Treppenabsatz bog, entwischte der Gangster aus der Tür. Sie fiel hinter ihm zu. Ich stoppte und schlich mich vorsichtig an die Tür heran.
Er brauchte sich nur draußen hinzustellen und konnte mich mit Kugeln durchlöchern, wenn ich einfach hinausbrauste. Und ich wollte meinen nächsten Geburtstag noch erleben.
Ich presste mich seitlich an die Wand und stieß mit der linken Hand die Tür auf. Die Waffe hielt ich in der Rechten.
Doch es krachte kein Schuss. Der Gangster hatte sich etwas anderes einfallen lassen. Ich hörte sein Lachen und seine heisere Stimme. Es klang gehetzt, aber nicht so, als wäre er in Panik und kopflos.
Er war in die Enge getrieben und kannte keine Hemmungen mehr.
»Du brauchst gar nicht erst in die Trickkiste zu greifen, G-man!«, rief er. »Ich habe eine Geisel hier. Ein junges Girl, dem meine Pistolenmündung an der Schläfe sitzt. Wenn du willst, dass sie am Leben bleibt, lass mich gehen.«
Ich spähte um die Ecke. Der Gangster log nicht. Er stand hinter einer jungen Frau mit einer gefärbten Kaninchenpelzjacke, die auf Ozelot getrimmt sein sollte, und kniehohen weißen Stiefeln. Der Gangster hatte den linken Arm um die Kehle der Frau geschlungen und drückte sie an sich.
Er presste eine 39er Automatic an ihre Schläfe.
An der Wand stand ein langer Kerl mit schwarzer Pelzjacke und lockiger blonder Haarmähne. In der rechten Hand, die stark zitterte, hielt er eine bauchige Chiantiflasche. Es war der Begleiter der jungen Frau.
Das kalte Neonlicht der Leuchtröhren an der Decke erhellte die Szene mit grausamer Schärfe.
»Ich gehe jetzt durch den Seitenausgang raus, G-man«, sagte der Gangster. »Wenn du mir folgst, stirbt die Kleine.«
Der Lange ließ die Chiantiflasche fallen. Sie zerbrach klirrend am Boden. Eine Weinpfütze breitete sich aus. Der Gangster ging mit der Frau rückwärts zu dem Korridor des Westflügels.
»Hauen Sie ab, falls er schießt!«, zischte ich dem Langen zu.
Doch er war zu geschockt, um zu gehorchen. Der Gangster und die Frau, deren Augen vor Angst weit aufgerissen waren, bogen um die Ecke und verschwanden im Korridor. Ich verließ meine Deckung und eilte hin.
Da hörte ich einen Fluch. Ich spähte vorsichtig um die Ecke.
»Los, hau ab!«, rief der Gangster. »Verschwinde in deine Wanzenbude, oder ich schieße dir ein Loch in den Pelz!«
Eine Zimmertür schlug zu. Der Schuss war vorhin nur in den oberen Stockwerken des Ostflügels gehört worden. Der Gangster hielt seine Geisel noch immer an sich gepresst. Er zog sie rückwärtsgehend mit sich zum Ausgang.
Ich knirschte mit den Zähnen. Es war zu befürchten, dass Sandra Simone nicht mehr lebte. Sonst hätte der Gangster nicht so reagiert. Aber wenn ich jetzt eingriff, gab es noch eine Tote.
Ich konnte nur dastehen und zusehen, wie der Gangster mit seiner Geisel davonging. In der Tür blieb er noch einen Moment stehen.
»Wenn du nicht im Haus bleibst, G-man, ist sie tot, klar?«
»Klar«, sagte ich.
Die schwere Tür schloss sich langsam und fiel ins Schloss. Der Gangster war draußen. Der Mann, den der Gangster in die Wohnung zurückgescheucht hatte, steckte den Kopf wieder aus der Tür.
Ich lief den Korridor entlang, riss die Tür zur Nottreppe auf und eilte hoch in den ersten Stock. Ein schmales Fenster führte nach draußen. Es ließ sich nicht öffnen.
Ich sah den Gangster. Er hatte immer noch die Geisel bei sich. Über die Grünfläche zog er sich zwischen zwei Hochhäuser zurück. Einige Bäume und Büsche warfen lange Schatten. Auf der Southern Avenue fuhren Autos vorbei.
Ein Fußgängerweg führte mitten durch die Grünfläche. Ich hörte, wie ein schweres Motorrad ansprang. Dann sah ich auch die Maschine und den Fahrer. Er hatte einen gelben Sturzhelm auf und trug eine schwarze Lederkombination mit gelbem Rückenstreifen.
Der Gangster zerrte die Frau zum Motorrad. Um das Fabrikat oder das Nummernschild zu erkennen, war die Entfernung zu groß und die Beleuchtung zu schlecht.
Der Gangster stieß die Geisel von sich. Die junge Frau taumelte und stürzte, und der Gangster sprang auf den Sozius der schweren Maschine. Der Fahrer gab Vollgas, dass die schwere Maschine aufröhrte.
Im nächsten Moment schoss das Motorrad zur Southern Avenue davon. Ich verließ das Haus und rannte zu der Frau, die sich wieder erhoben hatte. Mit hängenden Armen stand sie da. Sie hatte einen Schock erlitten. Ich packte ihren Arm.
»Cotton, FBI. Sind Sie verletzt, Miss?«
»Nein. Nein.«
»Sehr gut. Gehen Sie ins Haus zu Ihrem Freund und halten Sie sich für Ihre Aussage bereit. Ich veranlasse die Fahndung nach dem Mann, der Sie bedroht hat.«
Sie nickte so mechanisch wie eine aufgezogene Puppe. Ich hatte keine Zeit, mich länger um sie zu kümmern. Ich lief zu meinem Jaguar und verständigte über Funk die City Police und das FBI. Meine Fahrt in die Bronx war nicht umsonst gewesen.
Aber ich konnte mich nicht darüber freuen.
2
Der Hausmeister und Stan Franklin standen vor der Tür vom Apartment 134, als ich in die dreizehnte Etage zurückkehrte. Zwei Dutzend Neugierige hatten sich angesammelt. Sie witterten eine Sensation.
Der Hausmeister war ein dürrer kleiner Schwarzer. Er trug popfarbene Hosenträger über dem abenteuerlich gemusterten Hemd. Die Farbzusammenstellung hätte jeden Hund knurren lassen.
»Der Schlüssel steckt von innen«, sagte der Hausmeister, als ich eintraf. »Ich muss das Schloss herausschneiden oder aufbohren.«
Ich zeigte ihm meine ID Card. »Das dauert zu lange. Vielleicht ist Miss Simone noch zu helfen.«
»Sie meinen, sie ist verletzt oder tot, G-man?«, fragte er.
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich trete die Tür ein.«
Ich nahm einen kurzen Anlauf und trat gegen die Wohnungstür. Beim ersten Mal krachte und knackte es nur. Beim zweiten Mal flog die Tür auf. Ich wäre fast in die Wohnung hineingestürzt und konnte mich gerade noch fangen. Stan Franklin folgte mir.
Ich sagte dem Hausmeister, er solle an der Tür bleiben und die Neugierigen draußen halten. Sandra Simone bewohnte ein Zweizimmerapartment, das eine kleine Diele hatte. Die Tür zum Wohnzimmer stand offen.
Der Hausmeister verrenkte sich beinahe den Hals, um hineinsehen zu können. Ich knipste das Licht an, wobei ich die Hand mit dem Taschentuch bedeckte. Falls der Gangster einen Mord begangen hatte, würde er kaum seine Fingerspuren hinterlassen haben.
Doch ich wollte nichts verderben.
Sandra Simone lag halb unter dem Rauchtisch mit der Platte aus schwarz gefärbtem Glas. Der helle Hirtenteppich hatte sich voll Blut gesogen. Sandra Simone war eine große, pummlige Person Mitte zwanzig.
Sie hatte schwarzes Haar und trug ein rotes Kleid. Ihr Kopf lag eigenartig auf der Seite. Der Mörder hatte ihr die Kehle durchgeschnitten. Kampfspuren waren nicht vorhanden. An Sandra Simones Kinn sah ich jedoch eine leichte Schwellung.
Der Killer hatte sie wahrscheinlich vor dem Mord mit einem gezielten Schlag betäubt. Stan Franklin starrte die Tote an. Es war nicht die erste Leiche, die er in seiner Laufbahn als Kriminalreporter beim Evening Herald sah.
Aber in diesem Fall hatte er ein persönliches Interesse.
»Sie muss etwas gewusst haben, Jerry«, sagte er.
Ich nickte. Ich ging hinaus zum Hausmeister und fragte ihn über Sandra Simone aus. Er konnte mir nur sagen, dass sie ihre Miete regelmäßig und pünktlich bezahlt habe und eine ruhige Mieterin gewesen sei. Dann wollte ich wissen, ob ihm an diesem Abend etwas Ungewöhnliches im Haus aufgefallen sei.
»Nein«, sagte er. Er trat von einem Bein aufs andere. Er stand bei der Wohnungstür und hätte gar zu gern einen Blick in den Livingroom geworfen. »Außer dass zwei Sanitäter im vierten Stock waren.«