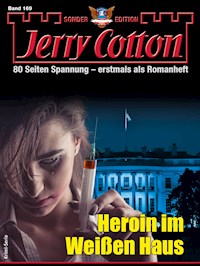
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jerry Cotton Sonder-Edition
- Sprache: Deutsch
Skandal in Washington! Politiker verdächtigten sich gegenseitig. Wir sollten die Fäden entwirren. Zuerst fanden wir die Leiche der schönen Marilyn. Dann kamen wir einem gigantischen Verbrechen auf die Spur. Es begann mit Heroin im Weißen Haus ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Heroin im Weißen Haus
Vorschau
Impressum
Heroin im Weißen Haus
Skandal in Washington! Politiker verdächtigten sich gegenseitig. Wir sollten die Fäden entwirren. Zuerst fanden wir die Leiche der schönen Marilyn. Dann kamen wir einem gigantischen Verbrechen auf die Spur. Es begann mit Heroin im Weißen Haus ...
1
Rauch hing in dicken Schwaden unter der Decke der Bar. Der Bourbon hatte den Beigeschmack von Veilchenpastillen. Aber heute Abend konnte das Chuck Millers Stimmung nicht trüben.
»Ich sag dir, das wird der Knüller meines Lebens«, verkündete er. »Sämtliche Zeitungen werden sich darum reißen. Ich werde reich, Junge!«
»Quatsch«, brummte der Journalist, der mit Chuck Miller an der Theke stand.
»Wart's ab! Mein Material ist astrein! Ich sage dir ...«
Niemand erfuhr mehr, was Chuck Miller noch hatte sagen wollen.
Die Tür des Lokals flog auf. Drei Männer glitten über die Schwelle. Männer in dunklen Trenchcoats, mit Strumpfmasken über den Gesichtern. Zwei brachten sofort Maschinenpistolen in Anschlag und hielten Personal und Gäste in Schach. Der dritte schwenkte eine Luger mit aufgeschraubtem Schalldämpfer hoch und feuerte.
»Plopp«, machte es. Und noch einmal: »Plopp.«
Über Chuck Millers Gesicht glitt ein Ausdruck törichten Staunens.
Beide Kugeln hatten ihn in die Brust getroffen. Langsam rutschte er an der Bartheke herunter, und als er zur Seite kippte, brachen seine Augen.
Einer der Killer zerschoss mit einem kurzen Feuerstoß die Deckenlampen.
Scherben rieselten, schlagartig wurde es dunkel. Die Mörder warfen sich herum und waren wie ein Spuk verschwunden, noch bevor sich das Entsetzen der Zeugen in einem vielstimmigen Aufschrei entlud.
Pünktlich um neun Uhr betrat Jonathan Willow, persönlicher Referent eines einflussreichen Politikers, sein Büro im Weißen Haus.
Willow trug eine schwarze Aktenmappe in der Linken und einen Packen Zeitungen unter dem Arm. Zu seinen Aufgaben gehörte es, seinen Chef, der als enger Berater des Präsidenten galt, regelmäßig über alle wichtigen Neuigkeiten zu unterrichten. Heute hatte er sich die Blätter persönlich von der Verteilerstelle geholt, da seine Sekretärin krank war. Sie fehlte ihm, Ersatz bekam er wegen der augenblicklichen Grippewelle nur stundenweise. Aber das war nicht der Grund für die Unmutsfalten, die sich auf seinem Gesicht abzeichneten.
Mit einer ärgerlichen Geste warf er die Zeitungen auf seinen Schreibtisch und faltete eine davon auseinander.
Heroin im Weißen Haus. Die Schlagzeile sprang ihm förmlich in die Augen. Immerhin hatte der Verfasser den Anstand besessen, die reißerische Überschrift mit einem Fragezeichen zu versehen. Doch sonst wimmelte es in dem Artikel von Andeutungen, abenteuerlichen Mutmaßungen und kaum verbrämten Unterstellungen.
Jonathan Willow biss sich auf die Unterlippe.
Ihm war klar, dass etwas geschehen musste. Presseskandale waren bei seinen Kollegen und Vorgesetzten so beliebt wie vereiterte Zähne. Es gab kaum jemand, der nicht noch mit Schaudern an Watergate dachte. Und ein paar Revolverblätter hatten sich bereits zu der Behauptung verstiegen, dass ein zweites Watergate bevorstehe.
Dabei gab es nichts als wilde Gerüchte, keine einzige konkrete Information, die man nachprüfen konnte. Der Reporter eines miesen Boulevardblättchens war ermordet worden, nachdem er in einer Bar lautstark behauptet hatte, Material über einen Rauschgiftskandal im Weißen Haus zu besitzen. Die Mörder waren unerkannt entkommen. Es gab weder Spuren noch Hinweise. Dafür brodelte die Gerüchteküche. Jonathan Willow seufzte, fuhr sich mit der Hand über das Haar und fischte den Schlüssel für seine Schreibtischschublade aus der Tasche.
Er wollte den Rotstift herausholen, mit dem er allmorgendlich die wichtigen Pressemeldungen ankreuzte. Seine Sekretärin schnitt sie dann aus, klebte sie auf Formblätter und ordnete sie nach Dringlichkeit. Heute würde er auch diese Arbeit selbst übernehmen müssen, da ihm die Ersatzsekretärin erst ab Mittag zur Verfügung stand. Die leidige Grippewelle! Und das ausgerechnet zur Kirschblütenzeit, wenn sich Washington den Besuchern sozusagen im Festgewand zeigte.
Willow griff nach dem Rotstift – und dabei fiel ihm der braune Umschlag auf.
Er runzelte die Stirn.
Jonathan Willow kannte den Umschlag nicht, hatte ihn nicht in die Schreibtischschublade gelegt und war sich ziemlich sicher, ihn gestern noch nicht dort gesehen zu haben. Zögernd griff er danach. Die Lasche war offen. Als Willow sie hochklappte, fiel sein Blick auf ein Dutzend kleiner, zusammengefalteter Papierstücke.
Weiße Briefchen!
Mechanisch schüttelte Jonathan Willow sie auf die lederne Schreibunterlage. Eine steile Falte kerbte sich zwischen seine Augen. Weiße Briefchen ... Die Gedankenverbindung zu Rauschgift, zu Heroin, kam automatisch, und Willows Atem beschleunigte sich.
Sollte das etwa ...?
Er wagte den Gedanken nicht zu Ende zu denken. Seine Finger zitterten leicht, als er nach einem der Briefchen griff und es vorsichtig auseinanderfaltete. Etwas von dem Pulver, das zum Vorschein kam, stäubte auf die Schreibtischplatte. Ein kristallines Pulver, schneeweiß. Es könnte Zucker sein, Jonathan Willow glaubte jedoch nicht daran, dass ihm jemand Zucker in seinen Schreibtisch geschmuggelt hatte.
Irgendwo hatte er einmal gelesen, dass Heroin ein Gefühl der Taubheit auf der Zunge erzeugt.
Er schluckte heftig, dann befeuchtete er einen Zeigefinger und tupfte etwas von dem Pulver auf. Vorsichtig probierte er, halb und halb in der Erwartung, doch klebrige Süße zu schmecken, weil alles andere einfach zu ungeheuerlich gewesen wäre. Aber es schmeckte nicht süß. Der Geschmack war vollkommen neutral – und fassungslos spürte Jonathan Willow, wie seine Zungenspitze taub wurde.
Heroin!
Es war Heroin!
Irgendjemand hatte ihm ein Dutzend Heroinbriefchen in den Schreibtisch geschmuggelt. Sie waren da, sie ließen sich nicht wegleugnen. Das Heroin im Weißen Haus existierte tatsächlich, unabhängig von der Frage, wie es hierhergekommen war. Bei der Vorstellung, was die Zeitungen aus dieser Tatsache machen würden, rann Jonathan Willow ein kalter Schauer über den Rücken.
Er musste etwas tun.
Es musste etwas geschehen – so konnte es nicht weitergehen!
Willow biss die Zähne zusammen. Er konnte allerdings nicht verhindern, dass seine Hände zitterten, als er zum Telefon griff, um Alarm auszulösen.
Jenkins, stand in verschnörkelten schmiedeeisernen Buchstaben an dem weißen Torpfeiler.
Ich betrachtete den Namenszug, die brusthohe Mauer und den ebenfalls schmiedeeisernen Zaun, der sie krönte. Der Park dahinter war nur klein und umgab eines der »herrschaftlichen« alten Häuser von Georgetown, Washington, die heutzutage von gut verdienenden jungen Leuten bevorzugt werden. Hank Jenkins gehörte dazu. Er war Journalist und schrieb freiberuflich für die renommierte Washington Post. Diese Zeitung hat damals den Watergate-Skandal aufgedeckt. Die Drohung eines mindestens ebenso schlimmen Skandals war es, die mich, den G-man Jerry Cotton, an jenem Tag Anfang April nach Washington, D. C. geführt hatte.
Heroin im Weißen Haus – das war die Quintessenz des Rauschens im Blätterwald. Politiker und Beamte sahen schon ein Damoklesschwert über ihren Häuptern hängen.
Angefangen hatte es damit, dass ein Sensationsreporter ermordet worden war, nachdem er gerade mit seinem Material über einen angeblichen Rauschgiftskandal im Weißen Haus angegeben hatte. Am nächsten Tag hatte dann ein Beamter, Jonathan Willow, Heroinbriefchen in seinem Schreibtisch gefunden und sofort Alarm geschlagen. Die Situation war brisant, und die FBI-Zentrale in Washington beschloss, zwei ortsfremde G-men auf den Fall anzusetzen, um größtmögliche Objektivität zu garantieren.
Die Wahl fiel auf meinen Freund und Partner Phil Decker und mich.
Heute Morgen waren wir auf dem National Airport angekommen. Beide nicht sehr begeistert von den Aussichten, die sich uns boten. Im Grunde war der Skandal bereits perfekt. Unsere Aufgabe bestand ja auch nicht darin, Skandale unter den Teppich zu kehren. Aber in diesem Fall sah es tatsächlich so aus, als hätte jemand mit voller Absicht an bestimmten Fäden gezogen, um etwas zu erreichen. Nur was der Unbekannte erreichen wollte, lag bis jetzt noch im Dunkeln. Deshalb wollte ich den Journalisten Hank Jenkins sprechen.
Das Theater, das die Sensationspresse veranstaltete, brauchte uns nicht zu interessieren.
Doch wenn eine renommierte Zeitung wie die Washington Post in die gleiche Kerbe schlug und ihre Leser mit brisanten Andeutungen fütterte, war das ein anderer Fall. Dann musste man davon ausgehen, dass harte Tatsachen vorlagen, und die wollte ich erfahren.
Ich ließ den Mietwagen unter einem der Kirschbäume stehen, für die Washington berühmt ist.
Mit einem Anruf hatte ich mich davon überzeugt, dass Hank Jenkins zu Hause war. Mechanisch schloss ich den Wagen ab. Ebenso mechanisch registrierte ich das Brummen des schweren Trucks, der sich näherte.
Ein Truck war in Georgetown eine Seltenheit. Doch auch das machte mich noch nicht misstrauisch.
Ich wandte lediglich den Kopf und betrachtete kurz das knallrote Fahrzeug, das sich über die ruhige Wohnstraße schob. Immer noch stand ich neben dem Mietwagen. Mit der Rechten schob ich den Schlüssel in die Tasche. Gleichzeitig sah ich, dass der Truck die Richtung änderte.
Scharf wurde er nach rechts gezogen.
Einer der Zwillingsreifen rumpelte über die Bordsteinkante. Wie ein röhrendes Untier raste der Lastwagen auf mich zu. Im Bruchteil einer Sekunde begriff ich, dass er mich rammen wollte.
Meine Muskeln zogen sich zusammen.
Die Schrecksekunde verkürzte sich auf die Hälfte. Akute Lebensgefahr hat manchmal diese Wirkung. Ich sah den Truck auf mich zurasen, sah die knallrote Motorhaube ins Gigantische wachsen und schnellte mich mit einem mächtigen Satz nach links.
Der schwere Kotflügel zischte so dicht an mir vorbei, dass ich den Luftzug spürte.
Ein schmetternder Krach übertönte das Dröhnen des Motors. Ich überschlug mich auf dem Straßenpflaster, wälzte mich weiter, hörte dabei Blech kreischen, Scherben klirren und Metall reißen. Als ich auf die Knie kam, schrammte der rechte Kotflügel des Lastwagens an der Grundstücksmauer entlang. Undeutlich sah ich das blasse Gesichtsoval hinter der Frontscheibe. Der Truck beschleunigte wieder. Gleichzeitig sprang ich auf die Beine und senkte die Hand unter die Jacke.
Sekundenlang hing der Wagen fest. Da ich in seine Fahrtrichtung gesprungen war, befand ich mich vor ihm.
Trotzdem musste dem Fahrer klar sein, dass er mich jetzt nicht mehr erwischen konnte. Er suchte sein Heil in der Flucht. Schwerfällig löste sich das Fahrzeug von der Mauer. Mir blieben nur Sekundenbruchteile, um meine Entscheidung zu treffen.
Mit dem Blechklumpen, der mal ein Mietwagen gewesen war, konnte ich die Verfolgung nicht mehr aufnehmen.
Die Reifen eines schweren Lasters zu zerschießen, ist gar nicht so einfach. Der Truck raste auf mich zu, und in dem Moment, als er an mir vorbeipreschte, handelte ich.
Federnd stieß ich mich ab.
Mit einem Sprung landete ich auf dem Trittbrett des Lasters, klammerte mich mit der Linken am Türgriff fest und zog mit der Rechten den Revolver. Der Fahrer warf den Kopf herum. Sein Gesicht verzerrte sich. Er beugte sich nach vorn, schnappte sich etwas von der Ablage, und im selben Moment schmetterte ich den Revolverkolben gegen die Scheibe.
Ein Spinnennetz entstand vor meinen Augen.
Undeutlich sah ich das verzerrte Gesicht des Fahrers und das Schimmern von schwarzem Waffenstahl. Scharf peitschte die Pistole. Ich hatte schon eine halbe Sekunde vorher den Kopf eingezogen, kauerte auf dem Trittbrett und klammerte mich fest, während die Scherben der Scheibe auf mich herunterprasselten.
Mit kreischenden Reifen schlingerte der Laster um eine Ecke.
Ich hörte den Fahrer fluchen. Er hatte erwartet, mich auf die Straße fallen zu sehen. Jetzt wusste er, dass er mich wieder nicht erwischt hatte. Etwas quietschte. Ich spürte die Bewegung der Tür und begriff, dass der Kerl mich abschütteln wollte wie eine reife Pflaume.
Wenn er mit einer Hand lenkte und mit der anderen am Türgriff hantierte, konnte er nicht schießen.
Ich schnellte hoch. Mit der Linken umklammerte ich die Dachkante, die Rechte stieß ich durch das Fenster ins Wageninnere. Die Revolvermündung berührte die Schläfe des Fahrers. Er versteinerte förmlich.
»Anhalten!«, schrie ich. »Keine verdächtige Bewegung, sonst ...«
Er versuchte nicht, nach der Pistole zu greifen, die er neben sich auf den Beifahrersitz gelegt hatte.
Aber er gab auch nicht auf, ich spürte förmlich, dass er etwas versuchen würde. Seine Muskeln spannten sich. Pfeifend kam der Atem über seine Lippen. In der nächsten Sekunde überstürzten sich die Ereignisse.
Der Fahrer warf sich nach vorn.
Sein linker Arm zuckte hoch und fegte meine Schusshand beiseite. Gleichzeitig ließ er das Lenkrad los und holte aus, um mir die Faust ins Gesicht zu schmettern. Dabei geriet der Truck aus der Richtung.
Blitzartig riss ich den Kopf weg.
Der Fahrer konnte den eigenen Schwung nicht Abfangen und fiel gegen die Tür. Ich wollte ihm den Revolverlauf über den Schädel ziehen. Doch dann hatte ich alle Mühe, mich festzuklammern, weil der Truck über die Bordsteinkante rumpelte. Es hatte immer noch ein Höllentempo drauf, obwohl der Fuß des Fahrers vom Gaspedal gerutscht war.
»Bremsen, du Narr!«, schrie ich.
In der nächsten Sekunde krachte es.
Mit voller Wucht rammte der Lastwagen den dicken Stamm eines Kirschbaums.
Jetzt wurde ich wirklich abgeschüttelt. Gegen die Gewalt des Anpralls war kein Kraut gewachsen. Zum zweiten Mal landete ich unsanft auf dem Straßenpflaster. Fallübungen gehören zur Karateausbildung. Die entsprechenden Reflexe gehen einem glücklicherweise mit der Zeit in Fleisch und Blut über.
Ich prellte mir Ellenbogen und Knie und schrammte mir die Hand auf, das war alles. Als ich wieder aufsprang, klirrten immer noch Scherben. Blubbernd starb der Motor des Trucks ab. In der jähen gespenstischen Stille regneten weiße Blütenblätter aus der Krone des Kirschbaums auf den Wagen herab.
Der Fahrer war mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschleudert worden.
Blut rann über das Lenkrad. Mit drei Schritten war ich heran, sprang wieder auf das Trittbrett und hob vorsichtig den Kopf des Mannes ein Stück an.
In dem blutverschmierten Gesicht waren die Augen gebrochen. Er lebte nicht mehr.
Der elegante weiße Bungalow war L-förmig gebaut und lag in einem weitläufigen Park mit hohen alten Bäumen.
Lediglich der asphaltierte Besucherparkplatz störte das romantische Bild. Auf einen Parkplatz unmittelbar vor dem Haus konnte der erfolgreiche Modearzt Dr. Sheldon Mortimer jedoch nicht verzichten. Zu seinen prominenten Patienten gehörten verwöhnte Millionärsgattinnen, die es nicht gewohnt waren, mehr als drei Schritte zu Fuß zu gehen, aber auch Politiker und hohe Beamte, die von Leibwächtern abgeschirmt wurden. Wie alle Ärzte empfahl Dr. Mortimer stressgeplagten Infarktkandidaten und enttäuschten Ehefrauen regelmäßige Spaziergänge. Doch er wusste, dass sich die wenigsten seiner Patienten daran hielten.
Heute war ihm das gleichgültig.
Genauso gleichgültig wie das verführerische Lächeln seiner hübschesten Sprechstundenhilfe oder das schöne Wetter. Er musste sich zwingen, dem Patienten zuzulächeln, der sich im Behandlungszimmer auf einer Liege ausgestreckt hatte.
James Watson, seines Zeichens Soziologe, aufstrebender Politiker und im Weißen Haus wegen seines Sachverstands in Bezug auf das Verhalten von Wählern hoch angesehen, seufzte leicht. Er hatte eine Halbglatze und zwanzig Pfund Übergewicht. Außerdem rauchte er zu viel. Seinen Herz- und Kreislaufbeschwerden wäre mit einer schonenden Entfettungskur, frischer Luft und Bewegung beizukommen gewesen. Doch dazu glaubte er keine Zeit zu haben.
»Diese neuen Kreislaufspritzen sind phänomenal, Doc«, sagte er. »Ich wüsste gar nicht mehr, wie ich ohne sie auskommen sollte.«
»Sie würden sehr gut ohne sie auskommen, wenn Sie meine Ratschläge für eine gesunde Lebensführung beherzigten«, sagte Dr. Mortimer mechanisch. Eine steile Falte stand auf seiner Stirn, als er die Spritze aufzog.
Er sah zu, wie die Schwester Watsons Ärmel hochstreifte und ihm den Arm abband. Auch das Setzen der Spritze wäre normalerweise ihre Aufgabe gewesen. Aber wer bereit war, Dr. Mortimers hohe Privathonorare zu zahlen, erwartete natürlich auch persönliche Behandlung.
James Watson wandte das Gesicht ab, weil er nicht zusehen wollte, wie die spitze Kanüle die Haut durchdrang. Dr. Mortimer tastete prüfend mit dem Daumen über die deutlich hervortretende Vene, desinfizierte die Stelle und stach die Spritze ein. Vorsichtig zog er den Kolben zurück, bis Blut kam. Während er langsam die helle Flüssigkeit injizierte, löste er den Lederriemen an Watsons Oberarm.
Watson schloss die Augen und seufzte wohlig.
»Wunderbar«, murmelte der Patient. »Unbegreiflich, wie schnell das Zeug wirkt. Wie hieß es noch?«
Dr. Mortimer nannte eine lateinische Bezeichnung. Dabei zog er die Kanüle aus der Vene und presste ein Stück alkoholgetränkten Zellstoffs auf die Einstichstelle, Watson hob den Arm, um die geringfügige Blutung schneller zum Stillstand zu bringen. Ein paar Minuten später klebte ihm die Sprechstundenhilfe ein kleines Pflaster in die Ellenbogenbeuge, und er erhob sich elastisch.
»Jetzt bin ich wieder fit«, meinte er aufgeräumt. »Ich habe das Gefühl, meine angeschlagene Pumpe kann ich bald vergessen. Ach ja, die Herztropfen! Sie wollten mir eine neue Flasche verschreiben.«
»Wir sollten einmal das Mittel wechseln. Warten Sie, ich habe da etwas ganz Neues.« Dr. Mortimer trat an seinen Schreibtisch heran, öffnete die Schublade und holte ein braunes Fläschchen heraus. »Jeden Morgen zehn Tropfen. Vor dem Frühstück bitte. Und nicht vergessen! Ich erhoffe mir in Ihrem speziellen Fall eine ganz besonders günstige Wirkung davon.«
»Freut mich, Doc, freut mich! Also dann – vielen Dank.« James Watson verabschiedete sich.
Dr. Mortimer sah ihm nach. Er wartete, bis sich hinter der Sprechstundenhilfe die Tür geschlossen hatte. Dann ließ er sich mit einem tiefen Atemzug auf seinen Schreibtischstuhl sinken.
Schweißperlen standen auf seiner Stirn, und die Hand, mit der er sie wegwischte, zitterte leicht.
2
Jonathan Willow empfing Phil Decker in seinem Arbeitszimmer.
Der Beamte rauchte nervös. Er sah blass aus. Alle paar Sekunden fuhr er sich mit der Hand durch das graue Haar und machte einen zerfahrenen, überreizten Eindruck.
»Ich kann mir das alles nicht erklären«, versicherte er zum wiederholten Mal. »Das heißt, ich kann es mir in gewisser Weise schon erklären, aber ...«
»Sie glauben, dass Ihnen jemand das Heroin in den Schreibtisch geschmuggelt hat, um Sie verdächtig zu machen?«, fragte Phil.
»Ja. Das heißt nein.« Willow biss sich auf die Lippen. »Natürlich konnte niemand ernstlich annehmen, man würde mich als Rauschgifthändler verdächtigen, zumal ich den Fund ja sofort gemeldet habe. Doch die bloße Existenz von zwölf Heroinbriefchen in diesen Räumen genügt ja für einen Skandal, wenn etwas davon durchsickert. Um diesen Skandal muss es den Tätern gehen, aus welchen Gründen auch immer. Die Gerüchte, die in den Revolverblättern kolportiert werden, entbehren selbstverständlich jeglicher Grundlage.«
»Sind Sie sich da ganz sicher?«
»Das fragen Sie?«, rief Willow empört. »Heroin im Weißen Haus – ich bitte Sie! Ich ... ich bin enttäuscht von Ihnen, Agent Decker. Wenn jetzt schon das FBI anfängt, daran zu zweifeln, dass ...«
»Mein Partner und ich sind hierhergeschickt worden, um die Dinge zu klären, Mister Willow«, sagte Phil ruhig. »Das kann man nicht, wenn man von einer vorgefassten Meinung ausgeht. Es gibt zwei schwerwiegende Punkte, die gegen Ihre Theorie von einem künstlich gemachten Skandal sprechen. Einmal die Tatsache, dass eine renommierte Zeitung wie die Washington Post im Allgemeinen keine bloßen Gerüchte kolportiert. Zum anderen der Mord an dem Reporter Chuck Miller.« Er hob beschwichtigend die Hand, als Willow protestieren wollte. »Warten Sie! Ich weiß selbst, dass Miller umgebracht worden sein könnte, um den Eindruck zu erwecken, dass er tatsächlich zu viel wusste und über brisantes Material verfügte. Nur ist das wahrscheinlich? Ein eiskalter Mord, offenbar von drei professionellen Killern begangen, Mister Willow. Eine politische Intrige ist als Motiv für einen Mord ein wenig dünn. Oder finden Sie nicht?«
Jonathan Willow lehnte sich zurück und schloss einen Moment die Augen.
»Sie haben recht.« Er seufzte. »Es muss mehr dahinterstecken. Aber was? Die Heroinbriefchen in meinem Schreibtisch beweisen doch eindeutig, dass die Sache manipuliert ist. Oder wollen Sie mir unterstellen, ich wäre in einen Rauschgiftskandal verwickelt und hätte auf diese Weise versucht, mich reinzuwaschen?«
»Das wäre immerhin eine theoretische Möglichkeit.« Phil lächelte matt. »Sehen wir zunächst einmal von der Frage nach dem Warum ab. Wer hat überhaupt Zugang zu diesem Zimmer und zu Ihrem Schreibtisch?«
»Meine Sekretärin und ich. Sonst niemand. Büros werden bei uns in Abwesenheit der Benutzer grundsätzlich abgeschlossen. Wie Sie wissen, gibt es immer mal wieder Führungen durch das Weiße Haus, einen gewissen Publikumsverkehr ...«
»Kann ich Ihre Sekretärin sprechen?«
»Leider nein. Miss Rivers – Marilyn Rivers – ist seit einigen Tagen krank. Die leidige Grippe!« Der Beamte seufzte und strich sich wieder einmal durch das kurz geschnittene graue Haar. »Und das ausgerechnet jetzt, da wir Mister Markyos erwarten.«
»Markyos?«
»Alvaredo Markyos. Er wird einige Tage als Staatsgast in Washington weilen. Dass das enorme Sicherheitsprobleme aufwirft, können Sie sich sicher vorstellen.«
Phil konnte es sich tatsächlich vorstellen. Alvaredo Markyos war Präsident einer südamerikanischen Inselrepublik, die von Rebellionen geschüttelt wurde. Der Staatschef hatte schon mehrere Attentate überstanden. Phil nahm an, dass seinen Washingtoner Kollegen Überstunden bevorstanden. Das war jedoch nicht sein Problem.
Er ließ sich die Adresse von Marilyn Rivers geben.
Dass Willows Sekretärin ausgerechnet jetzt Grippe hatte, konnte Zufall sein – aber vielleicht auch mehr. Und wenn die Frau tatsächlich eine so zuverlässige, treue Mitarbeiterin war, wie Jonathan Willow behauptete, würde sie sicher nichts dagegen haben, im Interesse ihres Chefs ein paar Fragen zu beantworten.
Marilyn Rivers hielt sich nicht in ihrer Wohnung an der Florida Avenue auf, sondern in einem Jagdhaus in den Wäldern des Potomac River.





























