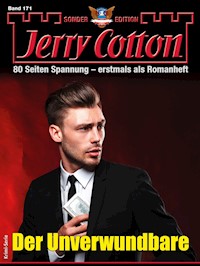
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jerry Cotton Sonder-Edition
- Sprache: Deutsch
Ein Artist von Weltruf: Tscheng-Li. Er ließ mit scharfen Gewehrkugeln auf sich schießen und blieb unverletzt. Trick? Wunder? Aber warum kam er uns dauernd bei der Gangsterjagd in die Quere? Wer war er wirklich - der Unverwundbare?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Der Unverwundbare
Vorschau
Impressum
Der Unverwundbare
Ein Artist von Weltruf: Tscheng-Li. Er ließ mit scharfen Gewehrkugeln auf sich schießen und blieb unverletzt. Trick? Wunder? Aber warum kam er uns dauernd bei der Gangsterjagd in die Quere? Wer war er wirklich – der Unverwundbare?
1
»Oh ... Bitte ... Wie meinen Sie, Sir?«
Die Lady mit dem rabenschwarzen Haar, den mitternachtsblauen Augen und der Traumfigur gehörte zu denen, die an Ausstrahlung verlieren, wenn sie den Mund aufmachen. Aber der Mensch kann nicht alles haben. Und dass mit dem Anblick dieser Traumfrau ein wahrer Albtraum beginnen würde, konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen.
Ich dachte nicht an Albträume. Auch nicht ans FBI, an Räuber, Mörder und ähnlich unfreundliche Zeitgenossen. Ich dachte an die Geburtstagsparty meines Freundes und Partners Phil Decker und den Floridaurlaub, der in zwei Tagen beginnen würde. Drei Wochen saubere Luft, Sonnenschein und Ruhe.
»Die schwedischen Gardinen«, wiederholte ich geduldig. Dabei zeigte ich auf das Bild, das unter einem Dutzend anderer an der Wand der New Yorker Galerie Wickert hing. Ein Bild, sehr modern, das auf mittelgrauem Hintergrund fünf schwarze Gitterstäbe zeigte – schwedische Gardinen eben.
Die Traumfrau schob eine perlmuttrosa schillernde Unterlippe vor. Offenbar mochte sie nicht recht glauben, dass jemand fünfzig Dollar für die schwedischen Gardinen anlegen wollte. Verdenken konnte ich es ihr nicht. Denn ich war zwar in die Kunsthandlung gekommen, um ein Geburtstagsgeschenk für Phil zu kaufen. Doch ich hatte dabei weniger Kunst als Jux im Sinn.
Leidenschaft und Zahnschmerzen haben bekanntlich eines gemeinsam: dass die Opfer zu allem Unglück noch den sanften Spott ihrer Mitmenschen herausfordern.
Phils Leidenschaft galt seit zwei Monaten einer attraktiven Innenarchitektin namens Gloria Davis. Sie hatte seine Wohnung, seine Freizeitgewohnheiten und seine Interessengebiete umgekrempelt. Im Urlaub würde er nicht zum Angeln in die Adirondacks fahren, sondern mit Gloria nach Paris. Und auch das nicht etwa der Lido-Girls, sondern der gemalten Ladys aus dem Louvre wegen. Mich nervte er ausdauernd mit Kunstbetrachtungen. Deshalb hatte ich mich mit ein paar Kollegen verabredet, um ihn an seinem Geburtstag mit möglichst verrückten Bildern einzudecken.
Meine Wahl war auf die schwedischen Gardinen gefallen.
Nicht nur weil sie eine Anspielung auf Phils Beruf enthielten. In erster Linie hatte es mir der Name des Malers angetan. Decker, stand da nämlich groß und deutlich rechts unten zwischen dem vierten und fünften Gitterstab. Ich malte mir bereits aus, wie mein Freund wortreich jedem Besucher versichern würde, dass nicht er es war, der das Meisterwerk geschaffen hatte.
»Wirklich die ... die schwedischen Dingsda?«, fragte die schwarzhaarige Traumfrau, während sie das Bild von der Wand nahm.
Ich nickte entschieden. Irgendwo in einem Nebenraum hörte ich ein Telefon klingeln, aber ich achtete nicht weiter darauf.
»Wirklich! Können Sie mir übrigens sagen, wie der Maler mit Vornamen heißt?«
Die Traumfrau runzelte die Stirn und blickte auf das unleserliche Kürzel.
»Mit Vornamen ...? Also, ich weiß nicht ... da muss doch irgendwo ...« Sie stockte.
Ein paar Schritte neben ihr öffnete sich die Tür, hinter der ich das Telefon gehört hatte. Der Mann, der in den Laden schoss, war mittelgroß, schlank und von leicht zerraufter Eleganz. Der Krawattenknoten saß schief. Eine silbergraue Haarsträhne hing ihm in die Stirn. Das schmale, kultivierte Gesicht verschloss sich bei meinem Anblick. Ich fand, er sah aus, als hätte er gerade auf der Rückseite eines für echt gekauften Rubens den Aufdruck Made in Hongkong entdeckt.
Das Traummädchen strahlte. »Mister Wickert! Der Gentleman möchte die schwedischen ... der Gentleman möchte das Bild hier kaufen. Wissen Sie vielleicht zufällig, wie der Maler mit Vornamen ...?«
Der Kunsthändler riss ihr das Bild aus der Hand.
Eine Sekunde lang starrte er die fünf Gitterstäbe an wie eine Offenbarung. Dann schluckte er und nickte mir mit verkrampftem Lächeln zu.
»Ray Wickert«, stellte er sich vor. »Augenblick, Sir, das werden wir gleich haben.« Er schwang herum, schoss in sein Hinterzimmer zurück und schloss die Tür hinter sich.
Eigentlich hatte ich es eilig. Aber ich kam nicht mehr dazu, ihm zu sagen, dass der Vorname des Malers so wichtig nun auch nicht sei. Das Traummädchen lächelte mich an. Ich fasste mich in Geduld. Die Sache dauerte.
Nach fünf Minuten wurde das Lächeln der Schwarzhaarigen etwas angestrengt. Ich betrachtete die Bilder und warf ab und zu einen Blick auf meinen Chronometer. Die Parkuhr, vor der mein Jaguar stand, würde gleich ablaufen.
Als Wickert zurückkehrte, hatte er seinen Krawattenknoten zurechtgerückt und das wohlfrisierte silbergraue Haar geglättet.
Er lächelte. »Da haben wir's endlich! Das Bild wurde gemalt von Vincente Decker, und es trägt den Titel Frustrationen. – Bitte sehr, Sir!«
Die Frustrationen waren bereits in dezent gemustertes Firmenpapier eingepackt. Ich zahlte meine fünfzig Dollar. Ray Wickert strebte der Tür zu, offenbar um sie für mich aufzuhalten. Ehe er dazu kam, wurde sie mit einem energischen Ruck von außen geöffnet.
Ein halbes Dutzend Männer betrat die Galerie.
Schweigend, schnellen Schrittes – mit einer ganz bestimmten Art, sich umzusehen und im Raum zu verteilen, die mir sofort klarmachte, dass es sich nicht um normale Kundschaft handelte.
Den siebten Mann kannte ich sogar.
Henry Obermeier, Captain der City Police, Mitglied einer Sonderkommission, die mit der Bekämpfung der überhandnehmenden Kunst- und Antiquitätenschiebungen betraut war. Obermeiers Wiege hat noch in München gestanden. Kein Mensch würde dem schweren Mann mit dem freundlichen runden Gesicht und den Schaufelhänden den Kunstkenner ansehen.
Die Polizeimarke wirkte in seiner Pranke wie ein Spielzeug. Den Durchsuchungsbefehl zupfte er mit zwei Fingern aus der Brusttasche. Beides hielt er Ray Wickert vor das blass gewordene Gesicht. Dabei glitten seine flinken Augen durch den Raum und blieben an mir hängen.
»Cotton! Sagen Sie bloß, die fixen Boys vom FBI haben schon vorher ...?«
»Ich bin zufällig hier«, beteuerte ich, ehe er falsche Schlüsse ziehen konnte. »Ich habe ein Bild gekauft.«
»Das gibt's doch nicht! Ich dachte, ihr interessiert euch nur für die Bilder auf Steckbriefen. Na, ich werde mir das Ding sowieso anschauen müssen. Hier kommt nämlich im Augenblick keiner raus, ohne ...«
Für ein paar Sekunden hatte er Ray Wickert vergessen. Genau die Sekunden, die der Galerist brauchte, um Atem zu schöpfen und Worte zu finden.
»Was bedeutet das?«, fragte er scharf. »Ich protestiere! Glauben Sie etwa, dass ich hier Diebesgut verkaufe und ...?«
Henry Obermeiers Blick glitt von mir ab. Er lächelte zuvorkommend.
»Wir glauben selbstverständlich nichts dergleichen«, sagte er. »Nur wir haben gewisse Vorschriften. Und leider müssen wir auch unangenehme Aufgaben erledigen. Ich versichere Ihnen, dass meine Beamten mit Kunstgegenständen umzugehen wissen.«
»Aber ich bin ... ich habe ...«
»Niemand verdächtigt Sie, Mister Wickert. Sehen Sie, der Gentleman da ist mir zum Beispiel persönlich bekannt. Und trotzdem werde ich einen Blick in das Paket werfen müssen, das er bei sich hat.«
Wickert schluckte und zerrte an seinem Krawattenknoten. Auch die silbergraue Haarsträhne war ihm wieder in die Stirn gefallen. Im Hintergrund des Ladens hatten ein paar Beamte begonnen, unter den staunenden Augen der Verkäuferin die Bilder zu prüfen. Der Galerist schleuderte noch einen vernichtenden Blick in die Runde. Dann schwang er herum, schoss quer durch den Raum und blieb neben den Männern stehen, um mit Argusaugen ihr Tun zu überwachen.
Henry Obermeier seufzte.
»Ein anonymer Anruf«, brummte er. »Wahrscheinlich ein Windei. Jemand behauptete, hier sei ein Picasso versteckt, der vor zwei Monaten in Mailand gestohlen wurde.«
»Picasso?«, wunderte ich mich. »Lässt sich so etwas denn überhaupt verkaufen?«
»Auf dem freien Markt bestimmt nicht. Aber es gibt fanatische Sammler, die sich den Teufel darum scheren, woher die Bilder stammen, für die sie Millionen hinblättern. Und der geklaute Clown aus der blauen Periode ist eine Million wert.« Obermeier seufzte noch einmal. Dann zeigte er auf mein Paket und grinste von einem Ohr zum anderen. »Darf ich mal, Jerry?«
Ich löste die Klebestreifen und entblätterte die schwedischen Gardinen. Obermeier runzelte die Stirn.
»Mann«, murmelte er.
»Nicht gut?«, fragte ich harmlos.
Er wollte meinen Kunstverstand nicht beleidigen. »Nun ... über Geschmack ...«
»Es ist als Jux gedacht«, beruhigte ich ihn. »Geburtstagsgeschenk für einen Freund, der seine Liebe zur Kunst entdeckt hat, um einer Kunstliebhaberin zu imponieren.« Ich musste lachen. Denn so weit, dass ich dieses Gitterbild nicht mit einer weltbewegenden Schöpfung der Modern Art verwechselte, reicht mein Scharfblick dann doch noch.
»Für diesen Zweck ist es bestens geeignet«, sagte Captain Obermeier. »Falls Sie den Picasso-Clown übrigens nicht in der Westentasche haben, können Sie gehen.«
»Danke. Vielleicht rufe ich Sie nachher mal an und erkundige mich, ob Sie den Clown erwischt haben.«
»Tun Sie das, Jerry. Dann können Sie mir auch gleich erzählen, was die Kunstliebhaberin zu dem Ausblick Marke Sing Sing gesagt hat.«
Ich versprach es.
Während ich die Galerie verließ, dachte ich darüber nach, dass das Werk von Vincente Decker offenbar auf jeden Polizeibeamten ähnlich wirkte. Ein Blick zur Uhr zeigte mir, dass ich mich beeilen musste. Für die nächsten Minuten vergaß ich Captain Obermeier und den Picasso-Clown, weil ich meine Aufmerksamkeit auf die Klebestreifen konzentrieren musste, die nicht mehr halten wollten.
Unterwegs stoppte ich kurz vor einem Drugstore.
Als ich wieder in den Jaguar kletterte, fiel mir zum ersten Mal der weiße Mercedes-Sportwagen auf. Er stand mit laufendem Motor drei Parklücken von mir entfernt. Unmittelbar hinter meinem Flitzer ordnete er sich in den Verkehrsstrom ein. Ich beachtete ihn nicht weiter.
Auch als er vier Ampeln später immer noch hinter mir war, widmete ich ihm nicht mehr als einen flüchtigen Blick. Das war nur die gewohnheitsmäßige Aufmerksamkeit, mit der man den Verkehr beobachtet, wenn man am Steuer sitzt. Die fünfte Ampel sprang gerade um, als ich sie passierte. Hinter mir trat der Mercedesfahrer das Gaspedal durch, um noch bei Gelb über die Kreuzung zu kommen.
Eiliger Mensch, dachte ich.
Dann runzelte ich die Stirn. Denn der eilige Mensch wurde deutlich langsamer und ließ zwei Wagen an sich vorbei, bevor er wieder mit normalem Tempo weiterrollte.
Bei mir meldeten sich die inneren Alarmglocken.
Verfolgte mich der Mann? War es überhaupt ein Mann? Ich erinnerte mich an schwarze Locken, die als Löwenmähne um ein schmales, knochiges Gesicht standen. Im Rückspiegel konnte ich die Frontpartie des offenen weißen Wagens sehen. Ich kniff die Augen zusammen, blickte wieder nach vorn und beschloss, die Probe aufs Exempel zu machen.
Rechts von mir glitt gerade das World Diamond Center vorbei. Ich verließ die Avenue of the Americas, bog in die 48th Street West ein und rollte auf die Fifth Avenue zu. Der weiße Mercedes-Sportwagen blieb hinter mir. Ich hatte vor, einmal um den Block zu fahren und südlich der Diamantenbörse wieder auf die Avenue of the Americas zu stoßen – ein völlig sinnloser Schnörkel. Aber wenn der schwarzgelockte Mercedesfahrer diesen Schnörkel mitmachte ...
Irrtum, Jeremias, dachte ich.
In der Fifth Avenue hatte ich den Mercedes zwar noch im Blickfeld. Doch in die 47th Street folgte er mir nicht mehr. Ohne merkbares Zögern lenkte der Schwarzgelockte seinen Wagen zurück Richtung Downtown. Er fuhr dicht an mir vorbei, und im Rückspiegel konnte ich mich sogar noch überzeugen, dass er wirklich und eindeutig männlichen Geschlechts war. Sein Hemd stand offen und gab das schwarze Kräuselhaar auf seiner Brust frei.
Ich freute mich. Nicht weil der Mercedesfahrer ein Mann war. Sondern weil unklare Ereignisse und geheimnisvolle Verfolger das letzte gewesen wären, was mir zwei Tage vor dem Urlaub Spaß gemacht hätte. Mit Genuss ging ich in Gedanken noch einmal das Programm durch. In meinem Apartment würde ich mich für Phils Geburtstagsfeier in Schale werfen. Da ein freies Wochenende vor mir lag, konnte ich ausnahmsweise mal nach Herzenslust den Hund von der Kette lassen, wozu mein Beruf sonst wenig Gelegenheit bietet. Sonntag würde ich endlos ausschlafen, ein bisschen packen und früh zu Bett gehen. Und Montagmorgen startete meine Maschine nach Miami Beach.
Vergnügt pfiff ich vor mich hin, während ich nach einer Parklücke Ausschau hielt. Unmittelbar vor dem Eingang des Apartmenthauses, in dem meine Wohnung liegt, war eine Box frei. Ich klemmte mir das Bild unter den Arm, stieg aus und schloss den Wagen ab. In der Eingangshalle warf ich noch einen Blick zurück durch die Glastür. Und da sah ich den weißen Mercedes auf der anderen Straßenseite.
Da sollte doch ...
Ich fluchte innerlich. Irgendjemand schien es darauf anzulegen, mir Party- und Urlaubslaune zu vermiesen. Der Mercedes rollte langsam vorbei und verschwand aus meinem Gesichtsfeld. Ich spürte den verwirrten Blick vom Pförtner, als ich kehrtmachte und die Tür wieder aufstieß.
Ein paar Yards links von mir stand der offene weiße Mercedes am Straßenrand.
Der Fahrer hatte den Kopf gedreht. Sein Blick haftete an der Tür, durch die ich eben verschwunden war. Jetzt sah er mich wiederauftauchen. Das lange, magere Gesicht verzerrte sich vor Schrecken.
Der Mercedesmotor jaulte, weil der Schwarzgelockte zu heftig Gas gab. Der Wagen machte einen Sprung. Ein paar andere Verkehrsteilnehmer hupten wütend, weil sie bremsen mussten. Wie eine startende Rakete fegte der weiße Sportwagen um die nächste Ecke. Ich musste mich anstrengen, um wenigstens noch das Kennzeichen abzulesen.
Immerhin, ich schaffte es.
Noch auf dem Gehsteig notierte ich mir die Nummer, weil ich aus Erfahrung weiß, dass man solche Zwischenfälle tunlichst nicht auf sich beruhen lässt. Wie, zum Teufel, hatte der Kerl mich überhaupt wiedergefunden? Den Sichtkontakt musste er auf der Fifth Avenue verloren haben. Also ...
Ich ging zu meinem Jaguar, bückte mich und tastete die Unterseite der Stoßstange ab. Nicht dass ich ein Hellseher bin! Aber der Schwarzgelockte hatte auf recht plumpe Weise versucht, mich zu verfolgen. Amateure neigen dazu, Abhörwanzen, Peilsender und Ähnliches immer wieder an den gleichen Stellen anzubringen.
Eine halbe Minute später lag das runde, blitzende Ding auf meiner Handfläche.
Peilsender, wie erwartet. Ich überlegte, ob ich schnurstracks damit ins FBI-Labor fahren sollte. Ich hatte mich noch nicht entschieden, als ich plötzlich Hitze auf der Haut spürte.
Der Sender sonderte Rauch ab.
Blitzartig ließ ich ihn aufs Pflaster fallen. Ein ebenso schneller Blick in die Runde zeigte mir, dass niemand in der Nähe war, der erschrecken würde. Leises Fauchen ertönte. Dann ein Knall, ein blau zuckendes Flämmchen – und auf der leicht geschwärzten Bürgersteigplatte lag etwas, das entfernt an ein vor zehn Jahren ausgespucktes Kaugummi erinnerte.
Ich atmete aus.
Mit allen Schikanen, dachte ich wütend, während ich das krumm gezogene, verschmorte Ding mit der Fußspitze berührte. Für Labortests war es jetzt ungeeignet. Auf diese Weise sparte ich mir den Weg zum District Office, aber ich kann nicht behaupten, dass ich darüber besonders froh war.
Als ich zum zweiten Mal die Halle des Apartmenthauses betrat, pfiff ich nicht mehr, und meine Laune ließ entschieden zu wünschen übrig.
Dass ich auf dem Weg zu Phil keine Spur von einem weißen Mercedes-Sportwagen sah, beruhigte mich.
Aus der Wohnung meines Freundes drang gedämpfte Musik. Auf der Treppe begegnete ich seiner Nachbarin, Mrs. Myrna Gains, soweit ich mich erinnerte, einer netten Blondine, mit einem eigenbrötlerischen Ehemann gesegnet. Sie lächelte verständnisvoll. Ich lächelte zurück. Dann klingelte ich.
Gloria öffnete. Auch sie war eine Blondine. Doch bei ihrem Anblick verblasste die Erinnerung an Mrs. Gains. Glorias schulterlanges Haar schimmerte wie ein Weizenfeld in der Sonne. Ihre blauen Augen brauchten keine Kosmetik, um zu strahlen. Ihre Figur kam auch ohne hautenge Hüllen zur Geltung. Und sie konnte lächeln wie die Sünde selbst. Ihretwegen, dachte ich bei der Begrüßung, würde ich mich an Phils Stelle vielleicht auch für den Louvre begeistern. Oder meinetwegen für den Einfluss der Luftverschmutzung auf das Liebesleben der Kartoffelkäfer.
Mein Freund balancierte ein Whiskyglas, als er in der Diele auftauchte. Auch er hatte Urlaub. Er würde aber erst Mitte nächster Woche starten, da Gloria bis dahin noch mit der Auswahl von Gemälden für das Foyer eines Theaters beschäftigt war. Ich gratulierte, überreichte mein Geschenk, begrüßte die schon recht fröhliche Runde auf der modernen Wohnlandschaft, zu der Gloria meinem Freund verholfen hatte. Als mein Blick auf die Wand fiel, die gestern noch kahl gewesen war, musste ich zweimal schlucken. Jetzt hing eine üppige Nackte am Nagel.
Eine Nackte in Öl, versteht sich. Hingegossen auf eine Blumenwiese. Die etwas unglückliche Pose musste für das Modell strapaziös gewesen sein, hatte es jedoch dem Maler ermöglicht, wesentliche Einzelheiten auszusparen. Unwillkürlich suchte ich nach der Signatur. Bellemy, hieß der schamhafte Mensch. Kein Vergleich zu meinem Original-Decker!
»Ein Geschenk von Mister Dillaggio«, sagte Gloria neben mir. Ihre blauen Augen funkelten mich an. »Außerdem haben wir inzwischen einen Porzellanhund, eine griechische Vase, made in Italy ...«
»... und ein Zebra in Nahaufnahme«, stöhnte Phil, der mein Geschenk entblätterte.
»Irrtum«, sagte ich trocken. »Es ist eine Landschaft im Nebel, gesehen durch ein Gefängnisfenster. Vielleicht hat der Maler einschlägige Erfahrungen. Schau dir mal seinen Namen an.«
»Ewiges Texas«, murmelte Phil ergriffen.
»Decker?«, wunderte sich Steve, der inzwischen neben ihn getreten war. »Hey, ich wusste gar nicht, dass du dir auf diese Weise die Wurst auf die Brötchen verdienst! Zeery! Joe! Kommt mal her und schaut euch an ...«
Für eine Weile rückte das Bild mit dem Titel Frustrationen in den Mittelpunkt von Gedränge und Stimmengewirr. Phil rettete sich an die Hausbar, schenkte mir einen Begrüßungsschluck ein und genehmigte sich das gleiche Quantum auf den Schrecken. Über das Glas hinweg widmete er mir einen Blick – Marke Beim-nächsten-Training-bist-du-fällig. Doch die nächste Trainingsrunde im Boxring stand erst nach dem Urlaub auf dem Programm. Im Vergleich zu dem Porzellanhund und der Nackten in Öl fand ich die schwedischen Gardinen gar nicht so übel.
Der Meinung war auch Gloria. Wir hörten ihre Stimme die anderen übertönen.
»... auf Zweidimensionalität abgestimmte Ästhetik! Was der Maler beabsichtigt, ist zweifellos die Auflösung des Gegenständlichen in geometrische Strukturen bis zur völligen Abstraktion. Wenn man es unvoreingenommen betrachtet ...«
»Das sagt sie nur, weil sie die Nackte von der Wand haben möchte«, unkte Phil. »Ihr habt euch wohl verabredet, was? Erst der Porzellanhund, dann Eva auf der grünen Wiese und jetzt noch Gefängnisfenster in Nahaufnahme.«
»Immerhin ist es dekorativ«, ließ sich Gloria vernehmen.
»Dekorativ? Seit wann sind Gefängnisgitter dekorativ? Ich sage dir, die Nackte bleibt! Ich habe keine Lust, in Zukunft jedem Besucher zu erklären, dass dieser Verrückte nur ein Namensvetter von mir ist.«
»Aber es passt viel besser zum Stil der Wohnung!« Gloria hatte sich der schwedischen Gardinen bemächtigt und hielt sie über das andere Bild. »Die Eva könntest du ins Schlafzimmer hängen und ...«
»Ha! Damit sie mir den Schlaf raubt, was?«
Die Debatte wäre wohl noch eine Weile weitergegangen, wenn nicht das Telefon geklingelt hätte. Phil nahm ab und winkte in meine Richtung. »Für dich, Jerry. Die Zentrale.«
Ich übernahm den Hörer. Von meinem Apartment aus hatte ich im Office angerufen, um den Besitzer des weißen Mercedes-Sportwagens feststellen zu lassen, und Phils Nummer zwecks Rückruf angegeben. Der Wagen war auf eine Frau zugelassen. Eine gewisse Marilyn Houston. Ich notierte mir ihre Adresse. Dabei fiel mir ein, dass die ganze undurchsichtige Geschichte vielleicht etwas mit der Razzia in der Galerie Wickert zu tun haben könnte.
Phil gestattete großzügig die Benutzung seines Telefons. Ich rief Captain Obermeier an. Fehlanzeige, erfuhr ich. Kein Picasso, kein Hinweis auf irgendetwas, das dem guten Ruf der Galerie zuwidergelaufen wäre. Ich warf den Hörer auf die Gabel. Inzwischen war Phil neugierig geworden. So erzählte ich ihm das Vorgefallene.
»Marilyn Houston«, wiederholte ich. »Eigentlich möchte ich mir die Lady mal ansehen ...«
»Nicht heute Abend!«, sagte Phil kategorisch. »Wir haben beschlossen, die Festlichkeiten mit einem Kabarettbesuch zu krönen. Das Paradiso wird dich übrigens interessieren. Es gehört deinem fabelhaften Mister Wickert, soviel ich weiß.«
»Dem Galeristen? Wie, zum Teufel, kommt ein Kunsthändler zu einem Nachtlokal?«
»Weiß ich nicht. Vielleicht treffen wir ihn, dann kannst du ihn fragen. Und jetzt beruhigt euch endlich über die verdammten Gitterstäbe«, wandte er sich an die anderen. »Der Bourbon hat sechzehn Jahre auf dem Buckel. Also braucht er nicht noch älter zu werden.«
Ich grinste und steckte den Zettel mit Marilyn Houstons Adresse ein.
Bei dieser Gelegenheit rutschte mir das Flugticket nach Florida aus der Brieftasche und fiel in die Falten des Seidenschals, den Gloria neben dem Telefon auf den Dielenschrank drapiert hatte.
Aber das bemerkte ich erst sehr viel später.
2
Der Rest des Abends war feuchtfröhlich.
Zum Paradiso gingen wir zu Fuß, weil wir Phils sechzehnjährigen Whisky vor weiterem Altern bewahrt hatten. Zu diesem Zeitpunkt interessierte es mich nur noch herzlich wenig, dass der Besitzer des Kabaretts Ray Wickert hieß. Die Lady mit dem Namen Marilyn Houston würde ich am Sonntag besuchen, falls ich Zeit dafür fand. Viel versprach ich mir ohnehin nicht davon. Selbst wenn ich den Schwarzgelockten erwischte, konnte ich ihm nicht beweisen, dass er mir den Peilsender unter die Stoßstange geklebt hatte. Und die Verfolgung bis zu meinem Apartment brauchte er einfach nur abzustreiten.
Wir belegten zwei Tische im Paradiso





























