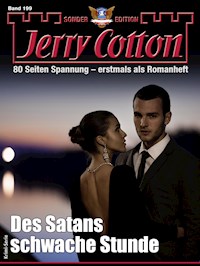
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jerry Cotton Sonder-Edition
- Sprache: Deutsch
Neun Opfer hatte der unheimliche Frauenmörder bereits auf dem Gewissen, als wir vom FBI die Falle für ihn aufbauten. Der Köder war eine Anzeige, die in verschiedenen Zeitungen erschien: Wer ist einsam wie ich? Bin 28, blond, schlank. Suche Partner. Als Lockvogel diente unsere mutige Kollegin Jill Trent. Schauplatz des Rendezvous war ein Apartment im neunten Stock des Clinton Hotel in Manhattan. Rundum waren G-men versteckt. Wir warteten auf des Satans schwache Stunde ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Des Satans schwache Stunde
Vorschau
Impressum
Des Satans schwache Stunde
Neun Opfer hatte der unheimliche Frauenmörder bereits auf dem Gewissen, als wir vom FBI die Falle für ihn aufbauten. Der Köder war eine Anzeige, die in verschiedenen Zeitungen erschien: Wer ist einsam wie ich? Bin 28, blond, schlank. Suche Partner. Als Lockvogel diente unsere mutige Kollegin Jill Trent. Schauplatz des Rendezvous war ein Apartment im neunten Stock des Clinton Hotel in Manhattan. Rundum waren G-men versteckt. Wir warteten auf des Satans schwache Stunde ...
1
Eigentlich war nichts Auffälliges an dem jungen Mann, der durch die Drehtür in die Halle des Clinton Hotel wirbelte. Er trug eine Strickmütze und eine wattierte Jacke, weite Thermohosen und unförmige Moonboots, von denen er jetzt den Schnee trampelte. Denn Manhattan erstickte wieder einmal unter einer dicken weißen Decke, die allenfalls den Kindern im Central Park Freude machte, nicht aber denjenigen, die arbeiten mussten.
Arbeiten mussten auch die fünf G-men, die sich in der Halle des Clinton aufhielten. Sie warteten auf einen Frauenmörder.
Der junge Mann ging auf die Fahrstühle zu. Die drei Türen waren geschlossen. Der Mann blieb stehen und drückte den Rufknopf.
Special Agent George Baker nickte seinem Kollegen Tom Mantell zu. Tom Mantell trug eine rote Pagenjacke mit dem verschnörkelten Schriftzug Clinton Hotel auf der Brusttasche.
Tom nahm einen Koffer auf und stellte sich neben den jungen Mann. Er lächelte unbestimmt an ihm vorbei.
Die Falle war im neunten Stock aufgebaut. Dort saß eine blonde Frau allein in einem Zimmer. Wie die angepflockte Ziege, die den Tiger lockt.
Die blonde Frau war unsere Kollegin Jill Trent.
In jedem Aufzug, der nach oben schwebte, fuhr ein G-man mit. Jedes Mal ein anderer. Wenn ein Gast im neunten Stock ausstieg, fuhr der G-man weiter und gab über Funk eine kurze Nachricht an die anderen. Das war seine Aufgabe. Nichts sollte den Mann misstrauisch machen. Das FBI wollte ihn endlich haben. Um ihn festnageln zu können, musste er so nah wie möglich an Jill herankommen.
Die Tür der mittleren Kabine öffnete sich. Höflich ließ Tom dem jungen Mann den Vortritt. Umständlich kam er ihm nach und stellte den Koffer ab.
Der junge Mann drückte den Knopf neben der 11. Tom Mantell drückte die 10. Der Aufzug schoss in die Höhe.
Unauffällig beobachtete Tom das Gesicht des jungen Mannes im Spiegel, der an der Rückwand der Kabine angebracht war.
Die roten Flecke in dem glatten Gesicht konnten von der schneidenden Kälte draußen herrühren. Die gespannten Lippen und das leichte Zucken der Mundwinkel mochten Ausdruck einer Konzentration sein, die sich auf etwas ganz anderes richtete als auf einen bestialischen Frauenmord.
Doch Tom Mantell spürte eine Spannung in dem Jungen, die ihn betroffen machte.
Die Kabine hielt. Tom nahm den Koffer auf, der nur ein paar alte Zeitungen enthielt. Er trat auf den Gang des zehnten Stocks hinaus. Er wandte sich nach rechts, bis er das Klicken hörte, mit dem die zufahrende Kabinentür den Kontakt für die Weiterfahrt freigab.
Er blieb stehen. Seine Hand berührte das flache Gehäuse des Walkie-Talkie in seiner Jackentasche. Bei der Einsatzbesprechung war vereinbart worden, dass einer der an der Aktion beteiligten G-men nur dann eine Meldung absetzte, wenn von einem anderen Agent eine Maßnahme ergriffen werden musste. Etwa wenn eine verdächtige Person im Anmarsch war oder ein anderer ihre Beobachtung übernehmen musste.
Und wenn ein Notfall eintrat.
Tom kehrte um und ging an den geschlossenen Türen vorbei. Eigentlich sollte er mit dem nächsten freien Aufzug wieder nach unten fahren.
Tom Mantell beschleunigte seine Schritte. Wie die anderen Kollegen hatte er sich in aller Eile mit dem Bauplan des Hauses vertraut gemacht. Der Hausingenieur war sehr hilfsbereit gewesen.
Die eiserne Feuerschutztür lag hinter der Gangbiegung im Westflügel. Tom öffnete sie. Ein kalter Wind strich über sein Gesicht. Er zwängte sich hindurch. Leise ließ er die Tür ins Schloss fallen.
Langsam stellte er den Koffer ab. Er lauschte angespannt.
Irgendwo knallte eine Tür. Der hohe Schacht veränderte das Geräusch und ließ seine Herkunft im ungewissen. Tom trat ans Geländer und blickte nach unten.
Der Schacht war nur schwach beleuchtet. Tief unten bewegte sich eine Hand auf dem Geländer. Dann hörte er eine dunkle Männerstimme. Eine Frau lachte schrill.
Tom trat zurück. Zwei Hotelangestellte, die Feierabend hatten oder zur Pause ein Stockwerk tiefer gingen.
Er sah einen Schatten, der neben ihm auf die graue Betonwand fiel. Der Schatten gehörte nicht zu ihm.
Er wirbelte herum. Seine Ahnung hatte ihn also nicht getrogen. Seine Linke zuckte zum Walkie-Talkie, die andere zur Waffe.
Ein heftiger Schlag in den Nacken warf ihn zu Boden. Er fiel auf die Knie und stützte sich mit den Armen ab. Vor seinen Augen standen zwei unförmige Stiefel. Wie von Astronauten, schoss es durch sein Hirn, das sich unter der Schädeldecke zu drehen schien.
Da traf ihn ein zweiter, ungleich heftigerer Hieb, und sein Bewusstsein zersplitterte wie eine Glaskugel.
Kein Licht brannte in dem engen Raum, und es war kalt, weil das Fenster ein Stück in die Höhe geschoben war. Es roch nach Staub und alten Akten. Ein Anwalt hatte uns seinen Ablageraum zur Verfügung gestellt.
Der Raum lag im zehnten Stock. Das Fenster ging nach hinten hinaus. Zwei Stockwerke unter uns breitete sich das Dach eines nach hinten hinausragenden Gebäudevorsprungs aus, der bis zur Rückseite des Clinton Hotel reichte.
Auf dem Dach lag eine fünf Fuß hohe Schneeschicht. Schnee bedeckte die Dächer und Feuertreppen der umliegenden Gebäude. Schnee hatte den Wasserbehältern und Lüfteraufsätzen weiße Hauben verpasst. Der Schnee reflektierte alles Licht. Sogar die dunklen Brandmauern der Häuser waren deutlich zu erkennen, als würden sie angestrahlt.
Im Ausschnitt zwischen den umgebenden Häusern standen die Zacken der Wolkenkratzer, von denen die meisten zum Rockefeller Center gehörten, wie eine eigenwillige Bühnendekoration vor dem strahlenden abendlichen Winterhimmel.
Fast jeder freie Fleck zwischen den beiden Regalen war mit optischen und elektronischen Geräten vollgestellt.
Das Fernglas mit der angesetzten automatischen Kamera war vier Fuß lang. Es stand auf einem sechs Fuß hohen Stativ, da sein Objektiv abwärts geneigt und genau auf ein erleuchtetes Fenster im gegenüberliegenden Gebäude gerichtet war.
Mein Freund und Partner Phil Decker stand auf einer Trittleiter. Sein Kopf berührte fast die Decke. Er presste ein Auge gegen die Gummimanschette des Okulars.
Ich stand am Fenster und starrte auf das matt leuchtende gelbe Rechteck auf der anderen Seite. Hinter der dünnen Tüllgardine waren ein breites Doppelbett, eine hübsche Kommode mit einer Stehlampe darauf und einem Sessel davor zu sehen – ein Hotelzimmer in Manhattan Midtown, Standardeinrichtung.
Im Moment war drüben keine Bewegung zu erkennen. Und das Walkie-Talkie blieb stumm.
»Warum hält sie sich nicht an die Abmachung?«, stieß Phil hervor.
»Vielleicht ist sie gerade mal für kleine Mädchen«, vermutete ich.
Von der Tür zum Bad war nur die untere Ecke zu erkennen. Sie stand halb offen.
»Das gefällt mir nicht«, murmelte Phil. »Ich war von Anfang an gegen diese Aktion!«
»Wir können von Glück sagen, dass wir noch einmal eine Chance bekommen haben«, gab ich laut zurück. Dann sagte ich ruhiger: »Da ist sie ja.«
Unsere Kollegin Jill Trent erschien im Zimmer. Ich konnte sie auch ohne Fernglas gut erkennen.
Sie trat ans Fenster, das eine Handbreit hochgeschoben war. Ihr Zimmer war vermutlich überheizt. Der Schnee auf der Außenseite des Fensterbretts war geschmolzen und am Ende zu langen, dolchartigen Eiszapfen gefroren.
Sie tippte mit einem Finger auf das Fensterbrett. Ihr Walkie-Talkie stand neben dem Fenster, unter einer der zurückgezogenen Vorhanghälften verborgen. Das Gerät war auf Dauersenden geschaltet. Jetzt übertrug es das harte Pochen von Jills Finger.
»Hier rührt sich nichts«, sagte sie.
Ihre Stimme drang klar aus dem Lautsprecher. Ich sah, wie sich ihre Lippen bewegten. Jill Trents Lippen waren hübsch. Ihr blondes Haar fiel in weichen Wellen auf ihre Schultern. Sie sah zu meinem Fenster herauf und konnte mich nicht erkennen.
Sie wandte sich vom Fenster ab. Ihre Bewegungen verrieten die innere Spannung, unter der meine Kollegin stand.
Zwei Verabredungen mit dem Frauenmörder waren geplatzt.
Der Verbrecher mochte verrückt oder pervers sein, aber er war auch intelligent und mit Instinkten ausgestattet, die ihn lautlos und unsichtbar im Dschungel der Großstadt machten.
Jill ging um das Bett herum. An der Tür zum Flur verharrte sie. Lauschend neigte sie den Kopf. Dann nahm sie ihre Wanderung wieder auf. Sie trug einen blauen Rock und einen hochgeschlossenen gelben Pullover, der über ihre Hüften fiel und den 38er Smith & Wesson Bodyguard verdeckte, eine Waffe, die von weiblichen Polizisten und Special Agents bevorzugt wird, weil sie im Rockbund getragen werden kann und sie keinen Hammer hat, der sich beim Ziehen in der Bluse oder im Pullover verfangen kann.
Außer Phil und mir und den fünf Mann in der Halle des Clinton bestand Jill Trents Schutzmacht aus drei weiteren Teams, die in zwei Zimmern des neunten Stocks auf der Lauer lagen. Alle Walkie-Talkies arbeiteten auf derselben Frequenz.
Hinter der Scheibe eines Fensters links von Jills Zimmer erschien hin und wieder ein heller, konturenloser Fleck, wenn der Kollege dort bei seiner Wanderung vorbeikam.
Das Warten zerrte an unseren Nerven.
»Wie spät ist es?«, fragte Phil, der das Auge nicht vom Okular des Fernglases nahm.
»Zwanzig nach acht.« Ich wischte über die Scheibe, die von meinem Atem beschlug.
Phil auf seiner Leiter bewegte sich kaum.
Jill kehrte ans Fenster zurück. Ihre Stimme füllte plötzlich den Raum. »Wird es euch nicht langweilig?«
»Nein, Baby«, sagte Phil, obwohl er genau wusste, dass sie ihn nicht hören konnte. »Küsschen, Baby!«
»Sie hasst es, wenn ein Mann sie Baby nennt«, sagte ich.
»Süß siehst du aus. Schnucklig ...«
»Sag es ihr, und sie haut dir eine runter! Sie ist eben eine selbstbewusste, moderne Frau. Aber eine Frau!«
»Du hast es doch schon mal bei ihr versucht ...«
»Still!«, sagte ich scharf.
Der Lautsprecher knackte. Dann drang eine Stimme heraus, die ich genau kannte. Sie gehörte meinem Kollegen George Baker.
»Tom! Melde dich!«
Das Gerät blieb stumm. Meine Kopfhaut begann zu prickeln.
»Tom!«, sagte George. »Bitte melden!«
Phil stieß einen leisen Laut aus. In seinem Glas sah er genau, wie sich der Ausdruck im Gesicht unserer Kollegin drüben veränderte. Dann fuhr sie herum.
»Es hat geklopft!« Ihre Stimme klang klein und angespannt aus dem Gerätelautsprecher.
Ich schnappte unser Walkie-Talkie. Wenn jemand an Jills Tür war, warum hatte dann niemand gemeldet, dass jemand den neunten Stock betreten hatte?
»Was ist mit Tom?«, fragte ich.
»Er ist mit einem Gast nach oben gefahren. Einem jungen Mann, weiß, Alter etwa zweiundzwanzig, dicke Jacke, Schneestiefel, Wollmütze ...«
Jill starrte auf die Tür. Es wurde still. Das Walkie-Talkie übertrug das leise Klopfen an der Zimmertür.
Jill machte einen entschlossenen Schritt. Sie strich ihren Pullover über den Hüften glatt und öffnete die Tür.
Phil schaltete die automatische Kamera ein, die über einen Spiegelaufsatz mit dem Fernglas verbunden war. Ein Tonbandgerät zeichnete jeden Laut auf, der aus dem Lautsprecher des Walkie-Talkies kam.
Der Verschluss klickte. Der Winder summte, wenn er den Film weitertransportierte. Klick, summ. Klick, summ.
Der Türspalt wurde breiter, und der junge Mann schob sich ins Zimmer. Linkisch blieb er vor Jill stehen. Er senkte den Blick.
Jill drückte die Tür ran. Sie würde nach Möglichkeit versuchen, das Schloss nicht einschnappen zu lassen. Sie zwang sich zu einem Lächeln.
»Sie haben mir geschrieben, nicht wahr?«, fragte sie.
Der junge Mann hob den Kopf und sah sie an.
Klick, summ, klick, summ, machte die Kamera.
Er musste es sein. Es gab keinen Zweifel. Nach einer Serie von Frauenmorden an der Ostküste, die alle nach demselben Schema abgelaufen waren, hatte das FBI die Ermittlungen an sich gezogen und eine Sonderkommission gebildet, da der Täter bisher in drei verschiedenen Bundesstaaten gemordet hatte.
Nur New York City hatte er ausgelassen.
Weil er sein eigenes Nest sauber halten wollte, vermuteten Psychologen und Kriminologen, die gemeinsam versucht hatten, ein Psychogramm des Täters zu erstellen.
Nach dem, was wir bisher wussten, schrieb der Mörder an Frauen, die Bekanntschafts- oder Heiratsanzeigen aufgaben. Es war gar nicht so einfach gewesen, diese Handlungsweise aufzudecken, denn dem Täter war es anscheinend gelungen, in fast allen Fällen seine Briefe von den Opfern zurückzubekommen. Stets machte er sich an einsame Frauen heran, von denen er annehmen konnte, dass sie sich keinem anvertrauten und nicht herumtratschten, auf welche Weise sie Bekanntschaften suchten.
Sieben Frauen hatten sterben müssen, bevor wir die Methode erkannten. Zwei weitere waren ermordet worden, bevor der Täter auf eine Anzeige antwortete, die vom FBI aufgegeben worden war.
Wer ist einsam wie ich und sehnt sich nach etwas Geborgenheit und Zärtlichkeit? Bin 28, schlank, blond ...
So etwa lauteten die Anzeigen, die wochenlang in zwei Dutzend Zeitungen und Zeitschriften erschienen.
Wir verfügten über einen Brief, den wir im Nachlass eines Opfers gefunden hatten und von dem wir annahmen, dass der Mörder ihn geschrieben und nicht zurückerhalten hatte. Der Brief war mit einer Underwood geschrieben und mit einem unleserlichen Namenszug unterzeichnet worden. Im Text nannte sich der Schreiber Will. Der Satan hatte sich einen Namen gegeben ...
Blumig schrieb der Mörder von seiner eigenen Einsamkeit. Er sei schüchtern und gehemmt, weshalb es ihm bisher unmöglich gewesen sei, eine nette Frau kennenzulernen. Weil er Hemmungen habe, scheue er auch vor einer ersten Begegnung mit der Inserentin in einer Bar zurück, und für ein Rendezvous im Park oder auf der Straße sei das Wetter jetzt doch zu kalt.
So lautete der mitleidheischende und um Vertrauen werbende Brief, den wir bei einer der ermordeten Frauen gefunden hatten. Die Briefe, von denen wir bis jetzt drei Stück auf unsere Inserate hin erhalten hatten, klangen ähnlich – und sie alle waren auf derselben Maschine geschrieben worden. Und in allen schlug der Schreiber schließlich ein Treffen in einem Hotel vor.
Zwei Rendezvous, eines drüben in New Jersey und ein anderes oben in Scarsdale, hatten zu keinem Kontakt geführt. Entweder hatte der Mann die Falle gewittert, oder er war einfach übervorsichtig gewesen. Er war jedenfalls nicht erschienen.
Jetzt fand ein Kontakt statt. Es war ein fragwürdiges Glück, das unserer Kollegin da beschieden war.
»Ich lasse Tom suchen«, sagte George Baker.
Ich hielt das Walkie-Talkie an meine Lippen.
»Kommt nicht infrage!«, sagte ich entschieden. »Haltet den Kanal frei!«
Ich ließ keinen Blick von der Szene drüben. Der junge Mann hatte beide Hände in den Taschen seiner dicken Jacke vergraben. Er schien jetzt nach den richtigen Worten zu suchen.
Schüchtern und gehemmt, das waren auch die Eigenschaften, die dem Frauenmörder von den Psychologen gegeben wurden. Hinsichtlich seines Alters waren sie unterschiedlicher Meinung, und weil sie sich auf keinen Fall festlegen wollten, boten sie eine Spanne an, die vom pubertierenden Jüngling bis zum reifen Mann reichte.
»Seine Klamotten sind teuer und gediegen«, meldete Phil, der durch sein scharfes Glas jede Naht erkennen konnte. »Wie der Kerl Jill anstarrt ...«
Ich schloss und öffnete meine Finger. Am liebsten hätte ich sofort losgeschlagen, den Kerl festgesetzt und den Rest, der dann noch für eine fest untermauerte Anklage fehlte, nachträglich beschafft. Bei der Hausdurchsuchung hätten wir vermutlich die Schreibmaschine gefunden, auf der der Täter die Frauen angeschrieben hatte. Das Messer, mit denen er sie getötet hatte, trug er vermutlich bei sich.
Aber nach allem, was wir wussten, konnten wir annehmen, dass wir etwas Zeit hatten. Denn keine der neun Frauen, die bisher nachweislich Opfer des Satans geworden waren, hatte man in einem Hotelzimmer gefunden.
Sie hatten auf den Rücksitzen geparkter Wagen oder an der Böschung eines Flusses gelegen, in ihren Wohnungen oder auf einem Schrottplatz.
Er musste einen Dreh auf Lager haben ...
Umso überraschter war ich, als ich jetzt seine Stimme hörte. Sie klang laut und schroff.
»Geben Sie den Brief her!«
Die rechte Hand des Burschen in der Jackentasche bewegte sich, als Jill lächelte und etwas zurückwich.
Ich zerrte den Fensterrahmen in die Höhe. Schnee wehte herein.
»Da stimmt doch was nicht!«, sagte ich.
Der Kerl drüben ging auf Jill zu. »Geben Sie mir den Brief! Geben Sie ihn mir!«
Seine Hand kam aus der Jacke. Sie umklammerte den Griff einer Pistole.
Ich drückte die Sprechtaste des Walkie-Talkies. »Schnappen wir ihn!«
Gleichzeitig schwang ich ein Bein über die Fensterkante. Das Dach lag ein ganzes Stück unter mir. Ich stieß einen schrillen Pfiff aus, der das Einsatzsignal für Jill darstellte.
Dann sprang ich. Und versank sofort bis zu den Ohren in einer Schneewehe, die der Wind unter unserem Beobachtungsposten aufgetürmt hatte.
Überall wurde es jetzt lebendig.
Jemand hämmerte gegen die Tür zu Jills Apartment. Sie war zugeschnappt. Jill hatte nicht bemerkt, dass der junge Mann sie ins Schloss gedrückt hatte.
Der Kerl jagte einen Schuss ins Holz. Sofort wirbelte er wieder herum und richtete die Mündung der Waffe auf Jill.
Jill hatte ihren 38er erst halb gezogen, als sie in das kleine schwarze Loch starrte. Sie bewegte sich nicht, hob nur den Blick um ein paar Inch und sah dann in die Augen des jungen Mannes.
Der Bursche zögerte. Seine Lippen zitterten.
Jemand wummerte gegen die Tür. Eine Stimme draußen schrie Jill zu, sie solle in Deckung gehen.
»Wir schießen das Schloss raus!«
Die ersten Kugeln fetzten lange Splitter aus der Tür.
Der junge Mann schob sich um das Bett herum. Jill folgte ihm mit den Augen. Irgendetwas schnürte ihr die Kehle zu.
Dann krümmte der Kerl den Rücken, nahm den Kopf zwischen die Arme und machte einen Satz.
Sein Körper krachte gegen den Fensterrahmen, und inmitten eines Scherbenregens flog er nach draußen.
Jill brachte ihren Revolver heraus. Während hinter ihr die Tür unter dem Anprall einer Schulter aufsprang, feuerte sie eine Kugel durch den leeren Fensterrahmen.
2
Ich sah die Gestalt durch die Luft segeln und dann im Schnee versinken. Mit rudernden Bewegungen watete ich auf ihn zu.
Aus den Fenstern neben Jills Zimmer purzelten meine Kollegen. Schließlich waren wir vier oder fünf Mann auf dem Dach. Alle sahen aus wie Schneemänner. Für kurze Zeit waren Freund und Feind nicht zu unterscheiden.
Bis der junge Kerl wild um sich zu schießen begann.
Meine Kollegen tauchten sofort im Schnee unter. Auch ich zog den Kopf ein.
»Ergeben Sie sich!«, rief jemand. »Wir sind vom FBI! Sie kommen hier nicht runter! Alle Abgänge sind versperrt!«
Er kam vom Dach herunter. Auf dem einzigen Weg, der ihm nicht versperrt war.
Mit seinen übergroßen Stiefeln pflügte er eine Schneise in den Schnee. Für kurze Zeit verschwand er hinter einem Aufbau.
Ich kämpfte mich um den Aufsatz herum.
»Stehen bleiben! Mann, bleiben Sie stehen!«, schrie Jimmy Stone.
Ich kam hinter meinem Hindernis hervor.
Der Kerl bewegte sich rückwärtsgehend auf die Dachkante zu. Seine Hand ruckte. Die Kugel klatschte in ein Lüfterrohr. Er machte noch einen Schritt. Schnee stäubte von seinen Stiefeln.
Ich arbeitete mich näher an ihn heran. Der Kerl sah mich nicht.
Er sah auch nicht die Dachkante, die unter dem Schnee verborgen lag. Er stieß mit seinen unförmigen Schuhen dagegen. Seine Knie knickten ein.
Für einen Moment begegnete ich seinen Augen. Ich las Verzweiflung und Ergebenheit darin. Langsam, zu langsam kam ich näher.
Wenn er sich einfach auf der Stelle hätte fallen lassen, wäre es gut gewesen. Aber er neigte sich nach hinten und verschwand einfach.
Ich warf mich vor und schaute über die Kante in den dunklen Schacht des Hofs hinunter.
Inmitten einer kleinen Schneelawine sah ich ihn fallen. Ich schloss die Augen, bevor er unten aufschlug.
Das kalte Kunstlicht im Warteraum neben der Intensivstation des Bellevue Hospital ließ alle Gesichter gleich grau aussehen, obwohl es bestimmt Nuancen gab. Schattengrau, schlammgrau, rauchgrau, krankgrau.
Jill Trents kleines Gesicht war spitz. Unter ihrem rechten Auge zuckte ein Muskel. Sie sah an mir vorbei. Wenn draußen im Flur jemand vorbeihastete oder wenn der Lautsprecher oben in der Wand knackte und die unpersönliche Stimme einen Namen rief, erstarrte sie sekundenlang.
Ich wusste, welche Gedanken hinter Jills Stirn kreisten. Ich hatte sie in meinem Jaguar vom Clinton zum Bellevue mitgenommen. Sie sprach ununterbrochen, erzählte irgendwelches belangloses Zeug, bis ich sie einfach unterbrach.
»Wir sind gleich da«, sagte ich. »Erzähl mir lieber, was dich wirklich beschäftigt.«
Sie sah mich von der Seite an. Ihr Blick schien etwas Feindseliges zu bekommen.
»Wenn ich Probleme habe, rede ich mit meinem Psychiater darüber«, sagte sie. »Im Job darf man keine Schwäche zeigen, oder?«
»Wir sind keine Konkurrenten«, sagte ich ruhig. »Wir sind Kollegen. Und Freunde. Oder irre ich mich?«
Ich fuhr sehr langsam, Jill rutschte im Sitz zusammen.
»Ich hab's vermasselt«, sagte sie schließlich. »Verdammt, Jerry, sag es ruhig. Ich hätte den Kerl stoppen können!«
»Dir ist nichts passiert, und wir haben den Kerl. Was verlangst du mehr?«
»Er stirbt vielleicht.«
Jetzt war ich es, der verblüfft schwieg. Jill hatte Mitleid mit einem Mann, der auf bestialische Weise neun Frauen getötet hatte!
»Niemand macht dir einen Vorwurf«, sagte ich nach einer Weile. »Er hatte die Pistole. Du musstest entscheiden.«
»Ich habe erst geschossen, als er schon draußen war. Ich glaube, ich habe mit Absicht daneben gehalten.«
»So etwas kann jedem von uns passieren. Wenn man einen anderen ansieht und auf ihn schießen soll, das geht einem durch und durch.«
Jill hörte mir gar nicht zu. »Ich hätte ihn in den Arm schießen können. Ich hätte es tun müssen. Aber ich habe es nicht gekonnt. Mein Gott, Jerry, er ist so jung! Er sieht nicht wie ein Mörder aus!«
Wie sieht ein Mörder aus?
Ich lächelte Jill zu, und sie lächelte zurück. Ihr Lächeln fiel ein wenig kläglich aus. Sie wandte den Kopf, als unser Kollege Tom Mantell den Warteraum betrat.
Er hielt den Kopf schief. Hinter dem linken Ohr klebte ein breites Pflaster.





























