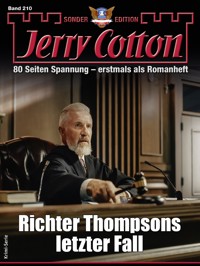
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Richter David L. Thompson wusste genau, dass der Angeklagte Harold Medina ein Mörder im Dienst der Mafia war. Und doch musste er das Recht beugen und die Verhandlung so geschickt leiten, dass Medina am Schluss von der Jury freigesprochen wurde! Denn seit den frühen Morgenstunden dieses ersten Prozesstages befand sich die Tochter des Richters in den Händen der Mafia ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Richter Thompsons letzter Fall
Vorschau
Impressum
Richter Thompsons letzter Fall
Richter David L. Thompson wusste genau, dass der Angeklagte Harold Medina ein skrupelloser Mörder im Dienst der Mafia war. Und doch musste er das Recht beugen und die Verhandlung so geschickt leiten, dass Medina am Schluss von der Jury freigesprochen wurde! Denn seit den frühen Morgenstunden dieses ersten Prozesstages befand sich die Tochter des Richters in den Händen der Mafia ...
1
Diesmal ging es nicht glatt.
Medina wusste es, als er das Messer in den jungen Frauenkörper stieß. Dabei hatte es sich so einfach angelassen. Er hatte sie in der Bar an der Ecke Madison Avenue angesprochen, und sie hatte sich an ihn geschmissen, als hätte sie seit Monaten keinen Mann mehr gehabt.
Und jetzt das! Er spürte, dass er nicht richtig getroffen hatte. Die Frau war nicht tot. Sie stieß einen schrillen Schrei aus. Er geriet in Panik und stieß mehrmals zu, bis der Schrei in einem schrecklichen gurgelnden Laut endete.
Er presste sie noch so lange mit dem Knie auf das Sofa, bis er überzeugt war, dass sie nicht mehr lebte.
Keuchend richtete er sich auf. Er lauschte. Die Wände waren papierdünn. Eben hatte er nebenan noch Musik gehört. War jemand auf den Schrei aufmerksam geworden und hatte deshalb den Ton des Fernsehers leiser gedreht?
Medina wirbelte herum. Er raffte seinen dünnen Mantel vom Garderobenhaken und huschte zur Tür.
Im Spiegel neben der Tür begegnete er seinem Gesicht. Der Anblick traf ihn wie ein Schock.
Sein Hals und sein Hemd waren blutbespritzt.
Er rannte ins Bad, schaltete mit dem Handrücken das Licht an und rieb mit einem Handtuch über die Flecke.
Das Ergebnis war eine Katastrophe. Sein hübsches Gesicht glich der Fratze aus einem Horrorfilm. Er drehte das Wasser an, machte das Handtuch nass und versuchte es noch einmal.
Sein Gesicht war jetzt einigermaßen sauber, aber die Nässe verteilte das Blut über die ganze Hemdbrust.
Er drehte das Wasser zu und wischte den Hahn mit dem Handtuch ab. Er trug keine Handschuhe. Er wusste immer genau, was er berührte.
Er schleuderte das Handtuch in eine Ecke und glitt zur Tür zurück. Er wollte sie gerade öffnen, als es klingelte. Im selben Moment klopfte es, und eine Frauenstimme rief den Namen der Wohnungsinhaberin.
»Susan? Bist du da? Ist alles in Ordnung?«
Harold Medina stand starr. Er wagte kaum zu atmen, während die Gedanken durch seinen Kopf rasten. Die Nachbarin hatte den Schrei gehört. Sie musste Susan Ortmans Gewohnheiten kennen und sich verantwortlich fühlen.
Medina presste die Lippen aufeinander. Langsam näherte er sich dem Türspion.
Die Optik des Gucklochs verzerrte das Gesicht der Frau, das vor der Tür schwebte. Medina sah, dass sie die Brauen argwöhnisch zusammenkniff und die Oberlippe hochzog, wodurch sie lange, gleichmäßige Zähne entblößte.
»Susan! Mein Gott, Susan, ist etwas geschehen?«
Das Gesicht näherte sich dem Türspion und schien sich aufzublähen. Medina zuckte zurück. Seine Finger umschlossen das zusammengeklappte Messer in seiner Tasche. Der Atem pfiff durch seine geblähten Nasenlöcher. Er würde auch sie töten müssen, bevor sie das ganze Haus rebellisch machte.
Er packte den Türgriff. Da verschwand das Gesicht. Im nächsten Augenblick hörte Medina eine Tür zuknallen.
Er nahm seinen Mantel und warf ihn sich so über die Schulter, dass der Stoff das verräterische Hemd verdeckte. Vorsichtig öffnete er die Tür.
Der Flur war hell erleuchtet. Medina zögerte, bevor er ins Licht trat. Dann lief er zum Fahrstuhl. Er presste den Daumen auf den Rufknopf und wischte mit dem Handrücken darüber. Da fiel ihm ein, dass er den Knauf an der Tür zu Susan Ortmans Apartment nicht abgewischt hatte. Er rannte zurück. Der weiche Teppichboden verschluckte das Geräusch seiner Schritte.
Die Türverriegelung des Aufzugs klickte, als die Kabine hielt. Medina sprintete, aber er kam zu spät. Die automatische Verriegelung sprang an. Die Kabine glitt abwärts. Die Tür blieb verschlossen.
Unten hatte jemand den Aufzug gerufen.
Es war ein kleines Apartmenthaus, zwölf Stockwerke hoch, und es gab nur den einen Lift. Die Wohnung des Opfers lag im neunten Stock.
Neun Treppen hoch. Durch das Fenster am Ende des Gangs, dessen Lüftungsklappe geöffnet war, drangen die nächtlichen Verkehrsgeräusche auf der East 62nd Street herein.
Plötzlich mischte sich das schrille Jaulen mehrerer Sirenen in das gleichmäßige Summen. Medina hetzte zum Fenster und starrte nach unten.
Vor dem Haus stoppten die ersten beiden Streifenwagen, und die Cops sprangen heraus.
Der Funkruf der FBI-Zentrale erreichte mich auf dem Weg nach Hause. Es war 11:23 Uhr, und ich hatte einen langen eintönigen Tag hinter mir.
»Die City Police bekam einen Notruf«, berichtete Steve Dillaggio, der Einsatzleiter von der Nachtschicht. In der Einsatzzentrale läuft ständig ein Funkgerät, das auf den Kanal der City Police geschaltet ist. »Ich höre gerade, dass die Cops die Mordabteilung rufen. Es handelt sich um Susan Ortman. Ich denke, es interessiert dich.«
Susan Ortman. Ja, sie interessierte mich. Vor ein paar Wochen hatte sie vor meinem Schreibtisch gesessen. Ich erinnerte mich an ein Paar hübsche lange Beine, runde Hüften, eine schmale Taille und angenehme Rundungen unter einer hellen Rüschenbluse. Und besonders gern erinnerte ich mich an den verheißungsvollen Blick der blauen Augen und das lockende Lächeln der vollen Lippen.
Ein wenig locker, ein wenig frech. Nicht übel, die Mischung. Ich hatte nichts mit ihr angefangen. Natürlich nicht.
Denn Susan Ortman hatte sich ans FBI gewandt, weil sie sich Sorgen um ihre Schwester machte. Susan hatte seit Monaten nichts mehr von ihr gehört und dann plötzlich einen Anruf von ihr erhalten, der sich wie ein Hilferuf anhörte.
Ich hatte mich nach Susans Schwester umgehört, ihr aber nicht helfen können. Virginia Ortman war dreiundzwanzig Jahre alt, und sie mochte einen Grund haben, weshalb sie sich nicht wieder mit ihrer Schwester in Verbindung setzte.
Ich hatte Susans Gesicht und ihre blauen Augen nicht vergessen.
»Glaubst du, dass es einen Zusammenhang geben kann?«, fragte ich.
»Die erste Meldung lautet, dass es sich um ein Sexualverbrechen handelt«, antwortete Steve.
Ich überlegte einige Sekunden. »Ich sehe sie mir an.«
»Darauf wollte ich hinaus«, sagte Steve Dillaggio.
Unten in der Lobby und oben im neunten Stock wimmelte es von Cops und Beamten der Mordabteilung Manhattan North. Ein jüngerer Detective kam gerade aus der Wohnung. Sein Gesicht sah grün aus.
Detective Lieutenant Carl Hobson, der eben erst eingetroffen war, warf mir ein Paar Einweghandschuhe zu. Ich streifte die Dinger über. Dann sah ich mich um, und in meinem Magen machte sich ein unangenehmes Ziehen bemerkbar.
»Beinahe hätten die Cops den Kerl erwischt, der das getan hat«, erklärte Hobson. »Es muss buchstäblich um Sekunden gegangen sein. Die Nachbarin, Miss Arlow, hat einen Schrei gehört. Sie kam an die Tür, hat geklingelt und geklopft und nach ihr gerufen. Dann hat sie sich blitzschnell in ihre Wohnung verzogen und 911 angerufen. Sie schwört Stein und Bein, dass der Schweinehund zu dem Zeitpunkt noch hier drin war. Sie hat ihn dann nämlich an ihrer Wohnungstür vorbeilaufen sehen.«
Hobsons Worte sickerten in mein Hirn und wurden vom Unterbewusstsein gespeichert. Der Polizeiarzt, der mit seinem breiten Rücken den nackten Oberkörper der toten Susan Ortman verdeckt hatte, richtete sich ächzend auf. Der Doc sah Hobson aus trüben Augen an.
Er räusperte sich. »Das Blut auf der Couch und auf dem Sofa beweist, dass ihr Herz noch geschlagen hat, als der Kerl sie so zugerichtet hat.«
»Ein Sexualmord, Doc?«, fragte ich.
Der Arzt hob die Schultern. »Es gibt da tausend Abarten. Sie hatte jedenfalls keinen Geschlechtsverkehr, das steht fest. Ich konnte weder Spermaspuren noch Verletzungen im Genitalbereich feststellen, die sonst bei Vergewaltigungsversuchen unweigerlich auftreten.«
Ich versuchte, einen kühlen Kopf zu behalten. Ich verdrängte die Vorstellung an die hübsche Frau, die mich frech und lockend angesehen hatte, obwohl sie sich Sorgen um ihre Schwester gemacht hatte – und die jetzt auf grauenvolle Weise ermordet worden war.
Sergeant Koskas, Lieutenant Hobsons Assistent, kam von einem ersten Rundgang zurück.
»Keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen, Chef«, sagte er. Hobson hasste es, wenn seine Leute ihn Chef nannten, doch er sagte nichts. »Brown und Cummins sind bei der Nachbarin«, fuhr Koskas fort. »Sie steht zwar noch unter Schockeinwirkung, vielleicht holen sie trotzdem eine Beschreibung aus ihr raus.«
Hobson nickte stumm, während er in einem Kommodenfach herumstocherte, das mit Fotos und Briefen vollgestopft war. Einige Fotos zeigten Susan Ortman in Unterwäsche oder Bikinis.
Susan Ortman hatte mir erzählt, dass sie einen Halbtagsjob als Verkäuferin in einem Kaufhaus hatte und nebenbei gelegentlich als Fotomodell arbeitete.
»Der Killer hat was abbekommen«, sagte Koskas. »Im Bad liegt ein blutiges Handtuch.«
»Verletzt?«, fragte Hobson.
»Das muss das Labor feststellen, aber ich glaube eher, dass das Blut von ihr stammt.«
Die Kollegen vom Erkennungsdienst trafen ein und beanspruchten das Feld für sich. Ich warf einen letzten Blick auf den misshandelten Körper. Der Mörder musste in eine große Blutlache auf dem Teppich vor der Couch getreten sein, als er von seinem Opfer abließ. Der Teil eines Sohlenabdrucks mit geriffeltem Profil, wie es bei Sportschuhen üblich ist, war deutlich zu erkennen.
Der Mörder hatte gemerkt, dass er in das Blut getreten war. Denn anschließend hatte er den Schuh auf einem anderen Teppichstück wie auf einem Fußabtreter gesäubert, was ein Hinweis auf seine Kaltblütigkeit war.
Ich verließ die Wohnung und trat in den Gang hinaus. Die Türen einiger anderer Apartments waren geöffnet. Hier und da sahen neugierige oder entsetzte Gesichter heraus. Cops nahmen die Personalien der Bewohner auf.
Ich stieg über die Geräte der Laborleute und Fotografen. Am Fenster am Ende des Gangs blieb ich stehen. Tief atmete ich die frische Luft ein.
Ich hatte hier nichts verloren. Susan Ortman hatte einen Mann aufgegabelt und den falschen erwischt. Einen Psychopathen mit einem krankhaften Hass auf Frauen.
Es muss um Sekunden gegangen sein, hatte Hobson erklärt. Eine Nachbarin hatte den Schrei gehört und bei Susan Ortman geklingelt. Und dann gleich die Notrufnummer gewählt.
Wie lange hatte der Killer gebraucht, um das Blut von seiner Kleidung zu wischen? Und wie gut war es ihm gelungen?
Ich öffnete die Eisentür, die zum Treppenhaus führte. Im schwachen Schein des Dauerlichts sah ich eine schmale Betontreppe und ein schwarz gestrichenes Eisengeländer. Ich trat über die Schwelle und blieb auf dem Treppenabsatz stehen. Der Knall der zuschlagenden Tür erzeugte ein kurzes hohles Echo.
Die Treppe diente nur als Fluchtweg im Fall einer Gefahr oder wenn der Fahrstuhl einmal ausfiel. Eine dünne weißliche Staubschicht bedeckte die Stufen.
Während ich mir die Einweghandschuhe abstreifte und in die Tasche steckte, tastete ich den Boden und die nach unten führenden Stufen mit den Augen ab.
Die Staubschicht war unversehrt.
Jerry, was hast du erwartet? Der Bastard hat den Fahrstuhl genommen.
Mit seinen blutbefleckten Kleidern, während draußen bereits die Streifenwagen heranheulten?
Bei einem Notruf aus einem Wohnhaus sind die Cops zunächst bemüht, die Ein- und Ausgänge zu sichern.
Ich bückte mich und blickte schräg über die nach oben führenden Stufen. Das Licht war schwach. Aber als ich mich näher herabbeugte, sah ich den Abdruck einer geriffelten Sohle im Staub der dritten Stufe von unten.
Ich hielt den Atem an, hob den Kopf und starrte ins Halbdunkel. Bei meiner Ankunft vor zehn oder zwölf Minuten hatte ich nur einen flüchtigen Blick auf das Haus geworfen. Es war zwölf Stockwerke hoch und wurde links und rechts von wesentlich höheren Betonklötzen eingezwängt. Über die Dächer der Nachbarhäuser konnte der Killer nicht entkommen.
Falls er da oben war, saß er in der Falle.
Ich stand da, alle Sinne angespannt. Ein leises Quietschen drang wie ein Messer in mein Hirn. Und als gleich darauf ein kaum wahrnehmbarer Luftzug über mein Gesicht strich, hetzte ich mit langen Sprüngen die Treppen hinauf.
Die Treppe endete in einem rechteckigen Aufsatz, der vermutlich mitten auf dem Dach stand. Über der Tür, die aufs Dach hinausführte, brannte eine Lampe, deren Kuppel mit einer dicken Staubschicht bedeckt war. Ihr Schein reichte kaum bis zum Boden.
Ich zog meinen Smith & Wesson, presste mich neben der Tür in die Ecke und drehte den Knauf mit der Linken herum.
Die Tür war nicht abgeschlossen. Der Riegel quietschte leise. Eine Windbö fegte durch den Spalt, packte die Tür und riss mir den Knauf aus der Hand. Die Tür verschwand im Dunkel.
Ganz kurz presste ein Gefühl der Angst meinen Brustkorb zusammen. Aber es verflog sofort, als ich an die Tote drei Stock tiefer dachte und an den Kerl, der sie so zugerichtet hatte. Wahrscheinlich hockte der Schweinehund jetzt zitternd hinter einem Lüfteraufsatz. Vielleicht war er froh, wenn ich ihm die Handschellen verpasste.
Die Lampe über der Tür war zwar nicht hell, doch ihr Schein genügte, um alles, was sich außerhalb des Rechtecks der Tür befand, wie eine schwarze Decke aussehen zu lassen.
Ich musste hinaus.
Ich sprang mit einem Satz schräg über die Schwelle und warf mich sofort nach links. Mit der Schulter prallte ich gegen eine Wäschestange. Ich ging in die Hocke und schob mich von dem Treppenaufsatz weg.
Allmählich traten die Einzelheiten meiner Umgebung deutlicher hervor.
Da waren links und rechts die dunklen Massen der fensterlosen Nachbargebäude, vorn und hinten die hüfthohen Brüstungen, hinter denen es zwölf Stockwerke in die Tiefe ging. Da waren Lüftungsrohre und Teppichstangen, das Maschinenhaus über dem Liftschacht, das kantige, metallisch schimmernde Endstück der Klimaanlage.
Die hohen Nachbargebäude zogen den Wind an. Er pfiff an den Fassaden hinauf und fiel dann auf das Dach des kleineren Bruders hinab, wo er an den losen Endstücken der Lüftungsrohre rüttelte oder in den Wäscheleinen sang.
Ich kroch im Watschelgang rückwärts, um mir einen besseren Blickwinkel für die Ecken am Treppenaufsatz zu verschaffen. Die geteerte Dachpappe knirschte unter meinem Gewicht. Ich würde also auch den Killer hören, wenn er sich bewegte.
Ein Windstoß heulte über das Dach, klapperte mit einem Ventilatorgitter und blies mir feinen Staub in die Augen.
Vielleicht war es eine schattenhafte Bewegung, vielleicht ein scharfer Atemzug, der mich warnte. Mein Hirn schaltete von Verstand auf Instinkt um. Ich handelte nicht, ich reagierte nur, als meine Reflexe ansprachen und meinen Körper zur Seite schleuderten.
Eine blinkende Klinge, die das schwache Licht einfing, zischte an meinem Gesicht vorbei. Ihre Spitze hätte meinen Hals durchbohrt, wenn ich nur einen Sekundenbruchteil langsamer gewesen wäre.
Weil ich mich noch in der Hocke befand, konnte ich nicht verhindern, dass ich nach hinten kippte. Ich wollte mich herumwerfen, um besser auf die Beine zu kommen, als sich ein dunkler Schatten auf mich senkte. Wie ein Habicht, schoss es mir durch den Kopf.
Ich zuckte zur Seite. Dabei bewegte ich die Schulter um einen Inch. Das war mein Glück. Denn die Klinge schlitzte mir nur das Schulterstück des Jacketts auf.
Ich spürte krampfhafte Atemzüge auf meinem Gesicht und sah das Weiße in weit aufgerissenen Augen. Ich bäumte mich auf, um den Kerl abzuwerfen und meinen Revolver auf ihn zu richten.
Da traf mich ein gemeiner Fausthieb am Hals. Ich blockte den nächsten Hieb ab, dachte gerade noch rechtzeitig an die Messerhand und konzentrierte mich auf den Stich, der unweigerlich kommen musste.
Ich ahnte ihn mehr, als ich ihn wahrnahm. Ich ruckte den Kopf hoch. Ich schmetterte die Stirn dorthin, wo ich unter den Augen die Nase vermutete.
Ich spürte den Knorpel und hörte den erschreckten Schrei. Mit einem wilden Ruck warf ich den zähen Körper ab.
Der Kerl kam wie eine Katze auf die Beine. Ich sah seinen geduckten Umriss und die schwingenden Hände.
»FBI!«, sagte ich laut. »Ich bin G-man! Gib auf!«
Er sprang mich an. Anders als andere Psychopathen schien er ein Kämpfer zu sein, was einigermaßen ungewöhnlich war. Ich drehte mich nach rechts weg, beschrieb einen Halbkreis auf der Stelle und ließ die Rechte herabsausen.
Wie ein Hammer traf der Revolvergriff den rechten Unterarm des Killers. Er schrie auf. Das Messer klirrte zu Boden.
Ich stieß den Atem aus. Seinen rechten Fuß sah ich zu spät. Der Spann knallte von unten herauf gegen meine Rippen und nahm mir für Augenblicke den Atem. Dann hetzte der Schatten des Mannes davon, auf den Treppenaufsatz zu.
Ich rannte hinterher. Der stechende Schmerz in meiner Seite und die Atemnot waren keine guten Voraussetzungen für einen entscheidenden Sprint.
Der Killer war schon fast an der Tür, als ich gerade an der Seite herkam. Die offene Tür brachte mich auf einen Gedanken.
Ich packte sie und schleuderte sie mit aller Kraft herum.
Die Kante erwischte den Kerl im Kreuz und schleuderte ihn mit dem Gesicht gegen den Rahmen. Es gab einen dumpfen Laut. Der Killer taumelte, und als ich vor ihm auftauchte, hob er abwehrend die Hände vors Gesicht.
»Nicht!«, rief er. »Ich habe nichts getan! Bitte ...«
Ich packte ihn an der Schulter, schleuderte ihn herum und trat ihm die Beine unter dem Körper weg. Als er am Boden lag, legte ich ihm Handschellen an. Dann erst steckte ich meinen Smith & Wesson ein und durchsuchte meinen Gefangenen nach weiteren Waffen. Als ich keine fand, zerrte ich ihn in die Höhe.
Ich ließ ihn nicht los, als ich das Messer suchte, das er verloren hatte. Ich wickelte einen Handschuh darum, bevor ich es aufhob und einsteckte. Dann führte ich ihn nach unten.
2
Das Gedränge im Flur des zwölften Stockwerks war noch größer geworden. Einigen Reportern war es gelungen hinaufzukommen.
Alle starrten mich an, als ich den Killer vor mir her auf die offene Tür von Susan Ortmans Apartment zuschob. Blitzlicht flackerte auf.
»Lassen Sie das!«, schrie ich.
Ich wusste, dass es zwecklos war. Einem Reporter das Fotografieren oder Schreiben zu verbieten, ist ungefähr dasselbe, als wollte man einem Menschen das Atmen verbieten.
»Ist das der Täter, Cotton?«, rief einer der Journalisten, die mich kannten.
»Kein Kommentar«, antwortete ich. »Los, Leute, lasst mich mal durch!«
»Was sagen Sie zu dem Verbrechen, Cotton?«, fragte ein anderer.
»Kein Kommentar.«
»Kommen Sie, Cotton! Sie müssen eine Meinung haben!«
»Die ist jetzt nicht gefragt. Lassen Sie mich meinen Job machen, ja?«
»Finden Sie das Verbrechen nicht abscheulich?«, fragte der Reporter hartnäckig.
»Wer findet so etwas nicht abscheulich? Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe!«
Ich stieß den Mann in die Wohnung. Die tote Susan Ortman lag immer noch auf der Couch. Der Killer streifte sie mit einem gleichgültigen Blick.
Hobson, Koskas und die anderen starrten den Mann sprachlos an. Hobson erwachte als Erster aus seiner Starre. Er knallte die Wohnungstür zu und deutete auf die Tür zum Bad.
»Da rein!«, sagte er.
Die Spurensicherung war mit dem Bad bereits fertig. Ich ließ den Kerl endlich los. Es wurde eng in dem kleinen Raum, als sich Hobson und Koskas mit hineinquetschten.
Der Killer lehnte sich gegen das Waschbecken. »Ich will einen Anwalt sprechen. Ich habe nichts getan. Es ist alles ein Missverständnis.«
»Ein Missverständnis? Wollten Sie die Kleine da nebenan nicht abstechen?«, fragte Hobson böse. »Wollten Sie eine andere ...?«
»Carl«, sagte ich warnend, und der Lieutenant unterbrach sich.
»Ach, zum Teufel, ich bin auch nur ein Mensch!«, sagte er.
Während ich dem Killer die Handfesseln abnahm, erklärte ich ihm, dass er verhaftet sei, und zählte ihm seine Rechte auf. Ich vergewisserte mich, dass er sie auch verstanden hatte, und trat zurück.
»Ziehen Sie sich aus!«, befahl Hobson barsch. »Los, machen Sie schon!«
»Ausziehen? Warum das?« Angst flackerte in den dunklen Augen.
»Wir müssen Sie auf Kampfspuren hin untersuchen«, antwortete Hobson.
Der Kerl schüttelte den Kopf. Als er unsere Mienen sah, stieg er langsam aus seinen Sachen.
Hobson nahm das Hemd und hob es gegen das Licht. Es war hellrot vom verwaschenen Blut. In der Jackentasche fand ich eine Brieftasche mit Ausweisen und Kreditkarten.
»Harold Medina, einunddreißig Jahre alt, aus Paterson, New Jersey«, las ich vor. Ich sah ihn an. »Sie sind weit weg von zu Hause, wenn Sie Morde verüben, Medina.«
Medina presste die Lippen zusammen. Er hatte fülliges schwarzes Haar, das jetzt feucht an seinem Schädel klebte.
Mit seinen großen dunklen Augen und dem kräftigen, muskulösen Körper sah er gut aus. Im Moment war nur die Nase etwas geschwollen. Wo er mit dem Gesicht gegen die Türkante geprallt war, zeichnete sich eine tiefe Kerbe über dem Wangenknochen und auf der Stirn ab.
»Schreiben Sie ins Protokoll: Kratzspuren am Hals rechts«, sagte Hobson zu seinem Sergeant.
Ich sah auch die vier tiefen roten Kratzer, die hinter dem Ohr begannen und bis zum Schlüsselbein hinuntergingen.
Wenn sich unter den Fingernägeln des Opfers Hautreste fanden, die von Harold Medina stammten, würde es an seiner Täterschaft nicht den geringsten Zweifel mehr geben.
Er war der Täter, daran gab es nichts zu deuteln. Ich hatte ihn fast in flagranti erwischt. Ein Abdruck seiner Schuhsohle befand sich neben der toten Frau, und ihr Blut war auf sein Hemd gespritzt.
»Gute Arbeit, Jerry«, sagte Detective Lieutenant Hobson. »Mein Gott, wer konnte ahnen, dass er sich noch im Haus aufhielt!« Er schüttelte den Kopf. »Na ja«, sagte er dann, »gleich, ob der Bezirksstaatsanwalt oder der Bundesanwalt die Anklage vertreten wird – der Fall ist gelöst.«
Ich nickte überzeugt. In diesem Moment konnte ich nicht ahnen, dass er noch gar nicht angefangen hatte.
Für die Zeitungen waren die Fotos, die die Reporter von mir und dem Tatverdächtigen geschossen hatten, ein Leckerbissen. Entsprechend sensationell machten sie die Berichte auf.
Harry Medina sah ziemlich mitgenommen aus, wie ich ihn fest am Arm hielt und mit grimmigem Gesicht in die Kameras sah.
Kampf auf dem Hochhausdach! G-man stellt Frauenmörder nach Kampf auf Leben und Tod. So lauteten die Schlagzeilen am nächsten Morgen.
Ich kaufte mir die Zeitungen am Flughafen und ärgerte mich während des ganzen Flugs nach Washington über die fantasievoll ausgeschmückten Beschreibungen und die bis ins Einzelne gehende Schilderung der Verletzungen, die der Täter dem Opfer zugefügt hatte. Glücklicherweise war es den Fotografen nicht gelungen, Bilder der grauenvoll zugerichteten Leiche zu schießen.
Ich hielt mich die nächsten zwei Tage in Quantico auf. Die FBI-Akademie hatte mich zu einer Vortragsserie eingeladen. Taktiken in der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung, so lautete das Thema der Reihe, in der erfahrene Agents jüngeren Kollegen über ihre praktische Arbeit berichteten.
Hin und wieder mache ich so etwas gern, obwohl die Seminarform ganz schön anstrengend ist. Vom Frühstück bis zum Abendtrunk ist man mit den Seminarteilnehmern zusammen und ihren Fragen und Einwänden ausgesetzt.
Ich war froh, als ich nach New York zurückkehren konnte. Mein Freund und Partner Phil Decker holte mich am Flughafen ab.
»Wie war's?«, fragte er.
»Ich bin geschafft«, sagte ich. »Fahr mich nach Hause. Und ruf mich in den nächsten Tagen mal an.«





























