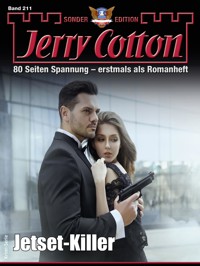
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jerry Cotton Sonder-Edition
- Sprache: Deutsch
Der Blick des Dealers flackerte. Er hob die Pistole und visierte mich an. Ich wusste, dass es ihm ernst war. Er würde abdrücken ... Ein Schuss knallte! Der Dealer brach tot zusammen. Ich suchte den Schützen, aber er war spurlos verschwunden. Und niemand konnte ahnen, dass es der meistgesuchte Verbrecher von New York war, der mir das Leben gerettet hatte - der Jetset-Killer!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Jetset-Killer
Vorschau
Impressum
Jetset-Killer
Der Blick des Dealers flackerte. Er hob die Pistole und visierte mich an. Ich wusste, dass es ihm ernst war. Er würde abdrücken ... Ein Schuss knallte! Der Dealer brach tot zusammen. Ich suchte den Schützen, aber er war spurlos verschwunden. Und niemand konnte ahnen, dass es der meistgesuchte Verbrecher von New York war, der mir das Leben gerettet hatte – der Jetset-Killer!
1
Es war ein kalter Tag Anfang November. Die Menschen, die dem Trauerzug folgten, zogen fröstelnd die Mäntel zusammen.
Dann bekam die bleigraue Wolkendecke fransige Löcher, und wenig später brach die Sonne durch. In ihrem Licht schimmerte das polierte Ebenholz des Sargs, der Mary Ellen Powells sterbliche Hülle barg, und das Laub der Zuckerahornbäume entlang des Hudsontals leuchtete in flammenden Farben.
Die Familie Powell hatte nur die engsten Freunde, gute Bekannte und wenige Nachbarn zur Trauerfeier und anschließenden Beisetzung auf dem Beekman Park Cemetery bei Rhinebeck, New York, geladen, und doch waren es an die dreihundert Personen, die Mary Ellen das letzte Geleit gaben. Es waren auffallend viele junge Gesichter unter den Trauergästen.
Mary Ellen Powell war neunzehn Jahre und zweihundertsechsunddreißig Tage alt geworden, als sie starb.
Einer der jungen Männer am offenen Grab ballte die Hände zu Fäusten. Die Sonnenbrille verbarg seine geröteten Augen. Seit er von Mary Ellens Tod gehört hatte, hatte er nicht mehr geschlafen. In den Nächten hatte er geweint.
Jetzt war sein Herz kalt, als er zwischen all den Heuchlern an Marys Grab stand. Er hörte die hohlen Sprüche des Pfarrers, und er sah Marys Mutter, die sich höchst wirkungsvoll auf Clifford Huntleys Arm stützte, von dem es hieß, er sei schwul. Aber Yvonne himmelte den Kerl an. Von ihrem schönen Gesicht waren hinter dem dichten Schleier nur ein blasser Fleck und die dunklen Löcher der Augen zu erkennen.
Sie war eine hinreißend schöne Frau. Doch unter der makellosen glatten Haut war sie verdorben wie eine weggeworfene Orange, zu keinem Gefühl mehr fähig außer Gier.
Nur er hatte Mary geliebt. Nur er.
Und alle, die an ihrem Tod schuld waren, standen jetzt an ihrem Grab und heuchelten Trauer. Sobald die Zeremonie zu Ende war, würden sie Mary vergessen und sich von ihren Chauffeuren zu ihren Villen am Hudson oder gleich in die anonymen Maisonettewohnungen oder Penthouses in Manhattan fahren lassen und sich eine Linie Koks einziehen oder worauf sie sonst gerade abfuhren.
Er würde nicht zur Tagesordnung übergehen. Das wäre undenkbar. Er wollte Mary nicht vergessen. Was immer er tun würde, er würde es für sie tun.
Ich wusste nicht, welcher folgenschwere Entschluss an Mary Ellen Powells Grab gereift war, als ich sechs Monate später durch die Halle einer Millionärsvilla an der Sheepshead Bay unten in Brooklyn strolchte und zusammen mit ein paar Dutzend blasierten Leuten Gemälde betrachtete.
Vielleicht hatte ich damals von Mary Ellen Powells Tod gelesen, aber bestimmt hatte nicht in den Zeitungen gestanden, dass diese blutjunge Frau aus dem Powell-Clan an einer Überdosis Rauschgift gestorben war. Unfälle dieser Art werden in den alten Neuengland-Familien heruntergespielt oder vertuscht.
Anders als die meisten der Blasierten, die zu dieser Vernissage gekommen waren, enthielt ich mich jeden Kommentars, hauptsächlich deshalb, weil ich keinen Gesprächspartner hatte, dem ich meine Meinung hätte darlegen können.
Als einer der livrierten Diener mit seinem silbernen Tablett in meine Reichweite geriet, schnappte ich mir ein Glas Orangensaft, der mit einigen Spritzern Champagner veredelt worden war.
Die Halle hätte gut und gern als Flugzeughangar herhalten können. Sie einem jungen Künstler als Forum zur Verfügung zu stellen, war gewiss nicht die schlechteste Verwendungsmöglichkeit für so viel Raum.
Monica Donaldson, die neue junge Frau des alten Donaldson, dem der Besitz hier unten gehörte, hatte bei ihrer letzten Europareise einen exzentrischen jungen Maler aufgetan, der Leinwand mit den verschiedensten Rottönen bedeckte.
Der Künstler, erkennbar an seinem zotteligen Haar und einem Umhang aus weichen Ziegenfellen, schlurfte mit bedächtigen Schritten neben seiner Gönnerin her. Monica Donaldson – vor ihrer Hochzeit mit William M. Donaldson hatte sie als Topmodel gearbeitet und sich Monique genannt –, zog hastig an einer dünnen, zerknautschten Zigarette, deren süßlicher Rauch sich allmählich in der Halle ausbreitete. Monica Donaldson lachte hektisch, als sie den Joint dem Künstler reichte.
Der hielt ihn mit drei Fingern an die Lippen und nahm gekonnt einen langen Zug.
Ich wandte mich einem seiner Werke zu, betrachtete das saftige Rot, spürte, wie es mich aggressiv stimmte, und ich fragte mich, was ich hier verloren hatte.
William Malcolm Donaldson hatte um eine Unterredung mit einem FBI-Beamten gebeten. Nicht mit mir, Jerry Cotton, Special Agent. Woher hätte ein Mann wie Donaldson meinen Namen kennen sollen? Wenn ein Mann wie Donaldson ein Anliegen an das FBI hat, wendet er sich an den Chef. An den obersten Chef in Washington. Und der große Chef in Washington schickt einen anderen Chef zu Mr. Donaldson. Nämlich meinen.
Ich kam mir ziemlich dumm vor, denn vor einer halben Stunde waren John D. High, der New Yorker FBI-Chef, und William Donaldson hinter der hohen doppelflügeligen Tür verschwunden.
Der süßliche Marihuanaduft wurde intensiver, und ich schob mich neben eine niedliche Brünette, die mir allerdings keine Beachtung schenkte. Ich leerte mein Glas und hielt nach einer geeigneten Stelle Ausschau, wo ich es abstellen konnte.
Mein Blick blieb kurz auf einer braunhaarigen Frau hängen, die angeregt mit einem grauhaarigen Mann sprach. Der Grauhaarige war ein weniger bekannter Kunstkritiker, der es sich nicht leisten konnte, eine Einladung der Donaldsons auszuschlagen. Auch das Gesicht der Frau kam mir bekannt vor.
Ich ließ meinen zweiten Blick etwas länger auf ihr verweilen, bis mir ihr Name einfiel. Sie hieß Marlo Thomas und war eine prominente Gesellschaftsjournalistin. Klatschtante, würden die einen sagen, aber für den Jetset waren Journalisten wie sie unentbehrlich. Der Jetset will natürlich unter sich bleiben. Nichts hasst er so sehr, wie irgendetwas – ein Stück Straße, eine Flugzeugkabine, einen Strand – mit gewöhnlichem Volk teilen zu müssen. Und nichts vermisst er gleichzeitig so sehr wie das Auge der Öffentlichkeit.
Die Klatschjournalisten leben von der Geltungssucht der Reichen und Prominenten und der Neugier der anderen, die im Schatten stehen.
Marlo Thomas war ein langbeiniges Geschöpf. Das schlichte Kostüm verbarg die vollkommenen Formen des schlanken Körpers, der sich mit lässiger Anmut bewegte, als sie sich einem anderen Besucher der Ausstellung zuwandte. Ihr Teint war zart und blass. Ein schneller Blick streifte mich aus fahlgrünen Augen, glitt weiter und ließ mich mit einem bedauernden Gefühl zurück.
Ihr Blick glitt jedoch auch über den schlaksigen jungen Mann hinweg, der in der Nähe der Tür stand und sie mit den Augen verschlang. Der junge Mann hatte welliges schwarzes Haar, eine eckige Stirn und einen eigenwilligen Mund. Sein Kinn war trotzig vorgeschoben, die blassen grauen Augen kniff er ärgerlich zusammen.
Er war Mal Donaldson, William M. Donaldsons einziger Sohn. Bevor sein Auge auf Marlo Thomas gefallen war, hatte er seine Stiefmutter mit den Augen verschlungen. Seine Stiefmutter war nur wenige Jahre älter als er.
Ich war dem jungen Donaldson nie persönlich begegnet. Seinen Namen und sein Gesicht kannte ich nur aus den Klatschspalten und Sportseiten der Zeitungen. Er galt als verwegener Abfahrtsläufer, er fuhr Motorradrennen und Schnellboote. Im vergangenen Herbst wäre er bei einem Rekordversuch mit einem Rennboot draußen in der Bucht beinahe ums Leben gekommen. Er gehörte zu den Typen, die ständig den Tod herausfordern.
Ich hatte meinen Saft ausgetrunken. Da sich in meiner näheren Umgebung keine geeignete Abstellmöglichkeit für mein leeres Glas fand, fasste ich die Snackbar ins Auge, die unter der Freitreppe aufgebaut war.
Dabei geriet ein schmales, mageres Gesicht in mein Blickfeld. Es gehörte einem schmächtigen Mann, der an der Snackbar lehnte und sich Häppchen mit Krabbenfleisch und anderen Leckereien in den Mund stopfte.
Ich wusste, dass ich den Burschen schon mal gesehen hatte, und irgendwo in meinem Kopf flammte ein Licht auf. Kein rotes, nur ein gelbes, immerhin, und das bedeutete Alarm.
Ich ging langsam auf ihn zu. Mich schien er nicht wahrzunehmen.
Er trug so etwas wie einen Gangsterlook. Einen Nadelstreifenanzug mit etwas zu breiter Krawatte, die Hosenbeine etwas zu eng und die Schuhe etwas zu spitz. Er hatte ein verkniffenes Gesicht mit kalten, kleinen Fischaugen.
Das Alarmsignal in meinem Kopf erlosch nicht. Ich konnte den Kerl nicht unterbringen, und das beunruhigte mich. Ich fragte mich, wie er an all den Aufpassern und Leibwächtern draußen vorbeigekommen sein mochte. Ich will ja nicht behaupten, dass Gesichtskontrolle eine empfehlenswerte Methode ist, um sich unerwünschte Personen vom Leib zu halten. Aber wenn ich Leibwächter der Donaldsons oder Wachmann auf Sheepshead Bay gewesen wäre, den Burschen hätte ich nicht auf die Halbinsel gelassen.
Ich wollte ihn nicht die ganze Zeit anstarren. Deshalb ging ich ans andere Ende der Snackbar, wurde endlich mein Glas los und griff nach einer Muschelschale, auf der ein Löffelchen Muschelsalat mit etwas Grünzeug und einer kleinen roten Pfefferschote angerichtet war.
Ich ließ den Happen auf der Zunge zergehen und sah dann unauffällig über die Schulter.
Der Kerl mit dem spitzen Gesicht war verschwunden.
Das Lämpchen in meinem Kopf schaltete von Gelb auf Rot.
Und die Farbe bedeutete Gefahr!
Der Butler stellte ein Tablett auf den Chippendaletisch und nahm die Whiskykaraffe in die Hand.
»Danke, Sam, das übernehme ich«, sagte William Donaldson.
Der Butler zog sich lautlos zurück.
Donaldson sah ihn an. »Eis, John?«
»Nur etwas Wasser, Bill.« John D. High nahm das Glas und lehnte sich zurück.
William M. Donaldson war ein massiger Mann Mitte fünfzig. Seine Augen waren von einem tiefen Blau, seine knappen Bewegungen verrieten Energie und Entschlossenheit.
»Kommen wir zur Sache«, sagte er. »John, ich bin beunruhigt. Innerhalb weniger Wochen hat dieser hinterhältige Massenmörder zwei Freunde meines Sohns getötet. Und ein Mädchen, das einige Zeit mit Susan, meiner Tochter, auf demselben College war.«
»Bill, ich weiß von diesen Fällen«, sagte John D. High. »Bisher war keine der Bedingungen erfüllt, die eine Zuständigkeit des FBI begründet hätten. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen Einzeltäter, es liegen also keine Bandenverbrechen vor. Die Morde fanden in einem Bundesstaat statt, es wurde kein Sprengstoff verwendet ...«
Donaldson machte eine wegwerfende Handbewegung. »John, da läuft ein gemeiner Massenmörder rum! Ein Mistvieh, das nicht irgendwelche Leute absticht! Er tötet Menschen aus ...«
»Ihren Kreisen, Bill? Wollten Sie das sagen?«
»Nein, John, das wollte ich nicht sagen. Verdammt, ich wollte sagen: aus unseren Kreisen. Aus unseren! John, die City Police ist überfordert. Das steht fest. Der Kerl ist ihnen überlegen.«
»Ermittlungen gegen Einzeltäter sind immer schwierig«, sagte John D. High zurückhaltend. »Insbesondere, wenn sein Motiv nicht erkennbar und er nicht den üblichen kriminellen Kreisen zuzuordnen ist.«
»Moment, John, Moment! Was wollen Sie damit sagen – wenn er nicht den üblichen kriminellen Kreisen zuzuordnen ist? Wollen Sie damit etwa sagen, dieser Irre stammt aus ...?«
»Unseren Kreisen«, antwortete er. Nur wer ihn gut kannte, hätte den feinen ironischen Unterton herausgehört.
»Der Direktor hat durchblicken lassen, dass es einen Weg gibt, John.«
John D. High nickte. »Amtshilfe. Wir können sie nicht anbieten. Sie muss angefordert werden, solange keine Bundesgesetze verletzt worden sind. Mir sind die Hände gebunden, Bill.«
»Ich kenne den Commissioner«, sagte Donaldson.
»Ein vernünftiger Mann«, räumte er ein.
»Ich habe bereits bei ihm angeklopft. Er meint, Sie könnten vielleicht parallel an den Fällen arbeiten. Sie mit Ihren technischen Möglichkeiten ...«
»Er müsste die Unterstützung anfordern«, wiederholte John D. High.
»Sie hätten also nichts dagegen?«
»Es wäre der legale Weg, Bill«, antwortete er zurückhaltend. »Aber versprechen Sie sich nicht allzu viel von unserer Mitarbeit. Auch wir können keine Wunder vollbringen.«
Die Villa der Donaldsons lag auf einem erhöhten Grundstück am Oriental Beach. Vom Vorplatz aus hatte man bei Dunkelheit einen atemberaubenden Ausblick auf den Rockaway Inlet und die weißen Schaumstreifen, die gegen den Strand anliefen. Die Lichter am Floyd Bennet Field, dem Navy-Flughafen auf der Ostseite der Bucht, funkelten wie Sterne.
Das Anwesen gehörte zum Millionärsviertel der Sheepshead Bay. Hier gab es so gut wie keine Gewaltverbrechen. Einmal, weil die hier ansässigen Familien eine eigene Wachtruppe unterhielten. Zum anderen, weil hier die Familien der Mafiagrößen wohnten. Die legten genauso viel Wert auf Ruhe und Ordnung wie die anderen Bürger. Und die Gangster und Ganoven hatten vor den Mafiabossen mehr Respekt als vor Cops oder Wachmännern.
Donaldsons private Wachmänner hielten sich diskret im Schatten am Fuß der Treppe. Die Wege hinunter zum Wasser und dem privaten Bootshaus, zu den Pavillons und zum Haupttor waren beleuchtet.
Von dem Kerl mit dem spitzen Gesicht war nichts zu sehen.
Einer der Wachmänner kam auf mich zu.
»Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Sir?«, fragte er.
»Da muss eben ein Gentleman aus dem Haus gekommen sein. Dunkler Anzug ...«
»Mittelgroß und schmächtig? Er ist zum Wasser hinuntergegangen. Wollte etwas frische Luft schnappen, wie er sagte.«
Ich starrte den Hang hinab und versuchte, die Dunkelheit außerhalb der Lichtkreise mit den Augen zu durchdringen. Das rote Licht in meinem Kopf flackerte aufgeregt.
Und dann erloschen die Lampen an den Wegen. Die Dunkelheit fiel wie eine Decke über das Grundstück. Die Wachmänner fluchten. Einer rannte ins Haus, um nach der Hauptsicherung zu sehen, was Blödsinn war, denn die Lichter im Haus brannten. Andere Wachmänner riefen nach Handlampen.
Ich sprang über den Aschenweg und lief den Hang hinab auf das Wasser zu. Meine Füße versanken im feuchten Gras. Die Luft schmeckte salzig.
Meine Augen gewöhnten sich schnell an die Dunkelheit. Vor den weißen Schaumstreifen erhob sich eine dunkle Masse – das Bootshaus der Donaldsons. Deutlich erkannte ich den weit ins Wasser hinausreichenden Steg, an dem mehrere Boote festgemacht waren.
Meine Schritte waren auf dem weichen Untergrund nicht zu hören, und vom Wasser aus konnte man mich gegen den dunklen Hang vermutlich kaum ausmachen.
Da bemerkte ich einen Umriss, der sich neben dem Bootssteg im Sand bewegte. Ich änderte meine Richtung und lief auf den Anleger zu.
Der Umriss streckte sich, als er auf den Steg flankte, wo er sich einen Augenblick gegen den hellen Brandungsstreifen abhob. Ich erkannte die Gestalt eines Mannes, die jetzt herumwirbelte und einen Moment starr dastand.
Er war der Schmächtige mit dem spitzen Gesicht, und er hatte mich bemerkt. Gewittert war wohl der bessere Ausdruck, denn das beständige Rauschen der Wellen, die gegen den flachen Strand anrannten, verschluckte alle anderen Geräusche.
Er krümmte sich zusammen. Mit einer fließenden Bewegung warf er den Aufschlag seines Jacketts zurück, um an die Kanone im Gürtelholster zu gelangen.
Plötzlich wusste ich, wer er war.
Nur ein Cop greift so zur Kanone. Ein Cop. Oder ein ehemaliger Cop.
Jetzt fiel mir sogar sein Name wieder ein, obwohl ich nie persönlich mit ihm zu tun gehabt hatte. Ich hatte ihn nur einmal vor Gericht gesehen, als er nach mir in den Zeugenstand gerufen wurde.
Er hieß Gene Bradlow. Bis vor zwei Jahren hatte er dem Rauschgiftdezernat angehört. Wegen einer undurchsichtigen Sache hatte er seinen Abschied nehmen müssen.
»Bradlow!«, rief ich halblaut. »Lassen Sie die Kanone stecken!«
Der ehemalige Narc verharrte in seiner gekrümmten Haltung. Vorsichtig ging ich auf ihn zu.
»Wer sind Sie?«, fragte er unterdrückt.
»Cotton, FBI.«
In diesem Moment flammten die Lichter wieder auf.
Ich stand im Schatten. Bradlow wurde vorn auf dem Steg wie auf einer Bühne angestrahlt. Der kurznasige Revolver sah wie die Verlängerung seiner Hand aus.
Er drehte sich in der Hüfte um und riss die Kanone hoch. Die Mündung wies auf die Seeseite des Bootsschuppens.
»Bleiben Sie stehen!«, schrie er.
Als Antwort krachte ein Schuss. Bradlows rechter Arm baumelte plötzlich schlaff an seiner Schulter. Der Revolver polterte auf den Steg. Bradlow taumelte und fiel dann auf ein Knie.
Ich rannte bereits über den Sandstreifen auf den Bootsschuppen zu. Im Laufen riss ich meinen Revolver heraus.
»Sie haben's vermasselt, Cotton!«, stieß der ehemalige Narc hervor.
Ich antwortete nicht. Mit dem Rücken schob ich mich an der Stirnwand des Bootsschuppens entlang.
Bradlow stöhnte. »Verdammt, Cotton, ich war hinter einem Dealer her! Sie haben's vermasselt!«
»Halten Sie endlich den Mund!«, sagte ich scharf.
Jemand hatte die Lampen ausgeschaltet. Das hatte er bestimmt nicht getan, weil ich mich dem Schauplatz näherte, sondern eher, weil er Bradlow bemerkt hatte oder eine andere Schweinerei verbergen wollte. Wahrscheinlich hatte er im Schuppen eine Steckdose kurzgeschlossen. Oben im Haus war die betreffende Leitungssicherung ausgefallen, und einer der Wachleute hatte sie wieder eingeschaltet.
An der vorderen Ecke des Schuppens brannte über dem Wasser eine helle Lampe.
Wie aus dem Boden gewachsen erschien plötzlich ein Mann in ihrem Schein.
Er war mittelgroß und stämmig. Er trug ein hellgraues Sweatshirt und dunkle Hosen, deren Beine unten nass waren. Nass waren auch die Baseballschuhe.
Mit beiden Händen hielt er eine schwere Pistole gepackt.
Über ihren Lauf hinweg visierte er mich an.
»Das ist der Schweinehund!« Bradlow keuchte und ließ sich vom Steg ins Wasser rollen.
Der Blick des Dealers flackerte. Die Pistole lag ruhig in seiner Hand, obwohl er aufs Höchste erregt war. Ich sah, dass es ihm ernst war. Er würde abdrücken, um sich zu retten. Ich erkannte es mit erbarmungsloser Klarheit.
Meine Rechte mit dem Smith & Wesson schwebte in Hüfthöhe.
Die Mündung wies nach unten.
Ich musste es versuchen.
Ich warf mich von der Schuppenwand weg zur Seite und riss den Revolver hoch.
Da peitschte ein Schuss. Ein dünner, trockener Knall.
Das Sweatshirt des Dealers hatte plötzlich ein winziges schwarzes Loch genau über dem Herz.
Die Pistole in seiner Hand zitterte. Seine Augen weiteten sich, der Unterkiefer klappte herab.
Ich sprang auf den Zusammenbrechenden zu und fing ihn auf.
Er war bereits tot, als ich ihn auf den feuchten Sandboden gleiten ließ.
Ich presste mich mit der Schulter gegen die Schuppenwand, den Revolver in der Faust. Bradlow plantschte unter dem Steg herum.
»Verdammt, Bradlow, was hat das zu bedeuten?«, rief ich.
»Er versorgte mal Donaldson und seine Clique mit Stoff«, kam die dumpfe Antwort. »Wenn Sie nicht gekommen wären, hätte ich die beiden erwischt. Was ist mit ihm?«
»Er ist tot«, sagte ich.
Bradlow fluchte. »O Scheiße, Scheiße. Er ist Lester Ingerman ...«
War, dachte ich unwillkürlich. Dann spürte ich einen Stich. »Ingerman? Doch nicht ...?«
»O doch, Cotton. Der Sohn des Senators. Vielleicht bekam er zu wenig Taschengeld, der Junge.«
Großer Gott, dachte ich. Aber wer hatte ihn erschossen und mir damit das Leben gerettet?
Plötzlich übertönte das scharfe Knattern eines Bootsmotors das Rauschen der Brandung. Fehlzündungen knallten wie Schüsse.
Ich schob den Kopf um die Ecke. An der Seeseite des Schuppens brannten keine Lampen.
Eine schräge Betonrampe führte ins Wasser. Dahinter erhob sich eine kurze Betonmole, die vielleicht als Wellenbrecher für den Schuppen diente.
Der Motor lief hoch. Das Dröhnen brach sich an der Schuppenwand. Und dann erkannte ich den flachen Rumpf eines schnittigen Motorboots, das sich jetzt von der Mole löste und den Bug in die Wellen richtete.
Ich rammte meinen Revolver ins Holster und sprang auf. Ich hetzte zwischen Schuppen und Wasserlinie her, sprang auf die Mole und rannte über die glatte Mauer, während das Boot an Fahrt gewann.
Die Wellen drückten das Boot gegen die Mauer zurück.
Ich legte noch einen Zahn zu. Das Ende der Mole war nur noch ein paar Schritte entfernt.
Das Boot rauschte um den Molenkopf herum. Ich sah es nah vor mir, nur drei Yards, mehr nicht.
Aus dem vollen Lauf heraus sprang ich.
Eine rücklaufende Welle zog es von mir weg. Meine ausgestreckten Hände schlugen auf die Bordkante, ich klatschte ins Wasser. Es war noch verdammt kalt, und ich schnappte nach Luft.
Der Motor dröhnte, aber das Boot tanzte auf den Wellen.
Mir schien, als würde es zum Strand zurückgetrieben.
Ich klammerte mich an der Bordwand fest. Wenn ich losließ, würde ich vielleicht in die Schraube geraten.
Ich zog mich mühsam höher und kam endlich mit dem Kopf über die Kante.
Unter dem Dach des niedrigen Cockpits war es dunkel. Vorsichtig arbeitete ich mich höher, bis ich ein Bein über die Bordwand schwingen konnte. Lautlos rollte ich meinen Körper hinüber.
Ich landete auf Händen und Füßen. Wasser rann aus meinem besten Anzug, den ich vermutlich abschreiben konnte.
Ich stieg über eine Bank und zog den Kopf ein. Dann trat ich gegen die dünne Tür zum Cockpit.
Das leichte Schloss brach aus dem Rahmen. Die Tür flog nach innen. Der Glaseinsatz zersplitterte.
Ich hechtete in den engen finsteren Raum, dorthin wo ich das Steuerrad vermutete.
Und den Heckenschützen, der den Sohn des Senators abgeknallt hatte.
Ich prallte gegen das Steuerrad. Alles war kantig und hart. Ich zog die Schultern hoch und schluckte meine Furcht herunter.
Hier im Cockpit war niemand. Blieb die kleine Kabine im Bug.
Ich atmete flach. Das Boot krängte schwer, als es längs von einer Welle gepackt wurde. Unwillkürlich griff ich ins Steuerrad.
Es ließ sich nicht drehen. Ich ertastete den eisernen Haken, mit dem es festgestellt war.
Eine neue Welle warf das Boot nach Steuerbord. Ich prallte mit der Hüfte gegen eine scharfe Kante.
Das Boot war leer. Ich wusste es plötzlich.
Der geheimnisvolle Killer hatte das Boot gestartet, um mich oder Bradlow von sich abzulenken und sich selbst unbemerkt und unerkannt verschwinden zu können.
Ich blickte zum Grundstück der Donaldsons hinüber. Lichtfinger tasteten zum Strand hinunter. Oben auf dem Platz vor dem Eingang zur Villa standen die Gäste, die Monica Donaldson geladen hatte, um ihnen ihre Entdeckung aus Europa vorzustellen. Die Schüsse hatten sie nach draußen gelockt.
Nur ich sah gerade noch den Schatten, der sich rechts im dunklen Teil des Parks den Hang hinaufarbeitete und neben der Villa verschwand.
Und dann fiel mir etwas ein, was nur mein Unterbewusstsein registriert hatte, als ich die Halle verließ, um zu sehen, wo Bradlow abgeblieben war.
Auch Mal Donaldson war verschwunden gewesen ...
2
Das Boot trieb breitseits auf einen dunklen Strandabschnitt zu. Ich löste den Haken von der Speiche des Steuerrads und drückte den Gashebel bis zum Anschlag.
Der Bug stieß in die Brandung, als ich das Ruder herumwarf. Gischt sprühte auf die Cockpitscheiben. Dann war das kleine Schiff hindurch und glitt über das offene Wasser. Der Bug hob sich, Wellen schlugen unter den Rumpf.





























