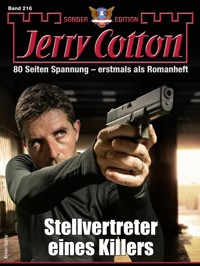
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jerry Cotton Sonder-Edition
- Sprache: Deutsch
Sogar New Yorks Presse war zur Stelle, als Emilio Masperi nach sechsunddreißig Jahren wieder den Boden der USA betrat. Er war einmal New Yorks brutalster Gangsterboss gewesen. Jetzt war er ein alter Mann. Lächelnd beteuerte er vor den Kameras: "Ich möchte hier friedlich mein Leben beschließen." Mr. High glaubte ihm kein Wort. Er fürchtete, dass Masperi nicht sein Leben, sondern das vieler anderer Bürger zu beschließen im Sinn hatte. Deshalb wurden Phil und ich auf ihn angesetzt. Das blutige Verhängnis war jedoch nicht aufzuhalten. Denn der Alte überlistete uns - durch den Stellvertreter eines Killers ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Stellvertreter eines Killers
I Gefährliche Vorbereitungen
Intermezzo Menschliches, Allzumenschliches (I)
II Der Empfang
Intermezzo Amtshilfe
III Der Horst des Adlers
Intermezzo Unbegreifliches
IV Blitze in der Nacht
V Auf den Spuren des Henkers
Intermezzo Menschliches, Allzumenschliches (II)
VI Vor dem Sturm
VII Abrechnungen
Vorschau
Impressum
Stellvertreter eines Killers
Sogar New Yorks Presse war zur Stelle, als Emilio Masperi nach sechsunddreißig Jahren wieder den Boden der USA betrat. Er war einmal New Yorks brutalster Gangsterboss gewesen. Jetzt war er ein alter Mann. Lächelnd beteuerte er vor den Kameras: »Ich möchte hier friedlich mein Leben beschließen.« Mr. High glaubte ihm kein Wort. Er fürchtete, dass Masperi nicht sein Leben, sondern das vieler anderer Bürger zu beschließen im Sinn hatte. Deshalb wurden Phil und ich auf ihn angesetzt. Das blutige Verhängnis war jedoch nicht aufzuhalten. Denn der Alte überlistete uns – durch den Stellvertreter eines Killers ...
IGefährliche Vorbereitungen
1Federal Bureau of Investigation
»Da kommt er«, sagte Phil.
Die Kühlerhaube meines Jaguar glitzerte im Sonnenlicht. Schräg über die Windschutzscheibe lief der Schatten eines Alleebaums. Ungefähr vierzig Yards vor uns kreuzte die Hauptstraße die enge Gasse, in der wir parkten. Und dort vorn war Frank G. Marlow um die Ecke gebogen.
Er trug einen hellgrauen Anzug, ein rosafarbenes Hemd und eine dunkelblaue Krawatte. Als er sich uns bis auf etwa zehn Schritte genähert hatte, blieb er stehen.
Marlow war zweiundfünfzig Jahre alt, untersetzt, kräftig und sah noch immer gut aus. Sein kurz gehaltenes schwarzes Haar war an den Schläfen grau wie gebrochener Stahl. Unter den struppigen schwarzen Brauen blickten lichtblaue Augen wachsam in die Welt.
»Los!«, sagte ich.
Wir stiegen aus. Marlow bewegte sich nicht. Seine Arme hingen locker hinab, und ich fragte mich, ob er eine Schusswaffe bei sich führte. Im Augenblick bestand unser einziger Vorteil darin, dass wir zu zweit und gut zwei Yards auseinander waren, was mindestens für einen von uns keine ausreichende Lebensversicherung darstellte, wenn Marlow eine Schusswaffe hatte, misstrauisch war und flink genug mit dem Schießeisen umgehen konnte.
Deshalb sagte ich, als wir erst drei Schritte auf ihn zu gemacht hatten: »Mister Marlow, wir sind Special Agents des FBI.«
Wenn es eine Überraschung für ihn war, verriet er sich nicht. In seinem sonnengebräunten Gesicht bewegte sich nichts.
Er ließ uns noch zwei Schritte näher kommen, dann sagte er: »Stopp! Ich möchte Ihre Ausweise sehen.«
Wir blieben stehen.
»Auch wenn wir vielleicht von Ihren Nachbarn beobachtet werden?«, fragte ich.
»Auch dann.«
»Okay«, erwiderte ich. »Zuerst ich.«
Ich wollte nicht, dass er sich in die Enge getrieben fühlte, weil vor ihm zwei Männer gleichzeitig unter ihr Jackett griffen. Mein Freund Phil Decker blieb reglos stehen, während ich betont langsam die Hand in die innere Brusttasche meines Jacketts schob und das lederne Etui hinauszog.
Ich klappte es auf und hielt es ihm hin. Auf diese Entfernung musste er zumindest die Dienstmarke deutlich erkennen können. Ich gab ihm drei Sekunden Zeit dafür. Dann ließ ich das Etui in die rechte Außentasche gleiten und brummte: »Jetzt du, Phil.«
»Nicht nötig«, sagte Marlow. »Kommen Sie.«
Er setzte seinen Weg fort, als wären wir gar nicht vorhanden. Zwischen uns hindurch ging er zu dem niedrigen Gartentor, stieß es auf und lief über die Steinplatten zur hölzernen Veranda, die drei Stufen hoch vor seinem Vorstadthäuschen entlanglief. Er zog den Schlüssel aus der Hosentasche und schloss auf.
Gleich hinter der Tür erstreckte sich das große Wohnzimmer mit einem Kamin auf der rechten Giebelseite. Dem Eingang gegenüber führte eine Holztreppe ins Obergeschoss hinauf. Weiter links gab es einen offenen Durchgang zur geräumigen Küche.
Als Phil die Tür hinter sich zudrückte, drehte sich Marlow um. »Muss ich Sie eigentlich reinlassen?«
»Nein«, antwortete ich wahrheitsgemäß. »Wir haben weder einen Haft- noch einen Durchsuchungsbefehl.«
»Muss ich mit Ihnen sprechen?«
»Auch nicht. Es gehört zu Ihren verfassungsmäßigen Rechten, vor Polizeibeamten jede Aussage zu verweigern.«
Er nickte und zeigte auf eine Sesselgruppe rings um einen großen runden Tisch, auf dem ein riesiger Marmoraschenbecher und ein klobiges Tischfeuerzeug standen. »Setzen Sie sich, G-men. Möchten Sie etwas trinken?«
»Nein danke«, sagte ich. »Wir möchten uns nur mit Ihnen unterhalten.«
Er ließ sich in einen der schweren Polstersessel fallen, wartete, bis auch wir Platz genommen hatten. »Also, was kann ich für Sie tun?«
Ich hätte mein Notizbuch hervorholen können, aber ich wollte das Gespräch möglichst wenig offiziell wirken lassen. Also sagte ich aus dem Gedächtnis: »Mister Marlow, Sie waren vor gut zehn Jahren einmal in Italien, ist das richtig?«
»Sie wissen doch, dass es stimmt. Was fragen Sie dann?«
»Wir möchten nur die Möglichkeit einer Verwechslung ausschließen.«
»Okay, ich war in Italien.«
»Sie gerieten mit einem Mietwagen südlich von Neapel in eine Polizeikontrolle. Die italienische Polizei fand eine Pistole im Handschuhfach und ein Jagdgewehr im Kofferraum. Immer noch richtig?«
»Ja.«
»Was wollten Sie so schwer bewaffnet in einem fremden Land?«
»Das habe ich der italienischen Polizei zu Protokoll gegeben.«
»Wären Sie so freundlich, es zu wiederholen?«
»Die Pistole hatte ich mir zu meinem eigenen Schutz zugelegt. Ich weiß nicht, wie weit es stimmt, aber ich hatte gehört, dass in Italien manchmal sogar Touristen entführt werden.«
»Und das Jagdgewehr?« Marlow zeigte ein dünnes Lächeln, als wollte er im Voraus um Entschuldigung bitten. »Ehrlich gesagt, ich hatte die Absicht, ein bisschen zu wildern. Ich gehe gern jagen.«
»Woher hatten Sie die Waffen?«
»In Rom gekauft.«
»In einem Waffengeschäft?«
»Natürlich nicht. Vor meinem Hotel lungerte ein Bursche rum, der sich ziemlich aufdringlich an jeden Touristen ranmachte. Er könne alles besorgen, was das Herz begehre. Rauschgift, Mädchen, unverzollten Schnaps, unverzollte Zigaretten – und alles viel, viel billiger. Das war gelogen. Ich habe für die Pistole und für das Gewehr sündhaft teures Geld bezahlt.«
»Sie wurden damals des Landes verwiesen. Ist das richtig?«
»Freilich. Warum graben Sie diese alte Geschichte aus?«
Er sah uns furchtlos an. Mir war längst klar geworden, dass uns ein Granitblock gegenübersaß.
Ich beugte mich ein wenig vor. »Wir glauben nicht, dass Sie der italienischen Polizei die Wahrheit gesagt haben.«
Er lehnte sich in dem bequemen Sessel zurück und schlug die Beine übereinander. »Was glauben Sie denn?«
Ich stand auf, denn jetzt sollte er merken, dass es hochoffiziell wurde. Auch Phil hatte sich erhoben.
»Mister Marlow, wir glauben, dass Sie damals auf dem Weg nach Sizilien waren und dort einen Mann ermorden wollten«, sagte ich betont.
Für ein paar Sekunden war es still. Seine hellblauen Augen wichen meinem Blick nicht aus.
»Was Sie glauben, ist Ihre Sache«, sagte er endlich.
»Haben Sie einen Waffenschein?«
»Ja.«
»Von wem ausgestellt?«
»Vom Bundesstaat New York und gültig für den ganzen Bundesstaat.«
»Besitzen Sie zurzeit eine Waffe?«
»Nein.«
»Tragen Sie sich mit der Absicht, demnächst eine Schusswaffe zu erwerben?«
»Im Augenblick nicht. Warum fragen Sie?«
Wir gingen zur Tür. Dort drehten wir uns noch einmal um. Frank G. Marlow saß noch genauso entspannt in seinem Sessel wie die ganze Zeit über.
»Sie können es morgen wahrscheinlich in allen Zeitungen lesen und vermutlich heute Abend schon im Radio und im Fernsehen hören, Mister Marlow: Der Mann, den Sie auf Sizilien ermorden wollten, kommt in die Vereinigten Staaten zurück ...«
2Die »Familie« Bandoglioni
Die Müllkippe war dreimal so groß wie das größte New Yorker Sportstadion. Sie lag im warmen Licht der späten Nachmittagssonne. Weit draußen tuckerte ein Hafenschlepper den East River hinauf. Ganze Heerscharen von kreischenden Möwen schwirrten lärmend über das Gelände.
Der rostrote Lincoln Continental Mark VI, den es früher nur als Prestige-Coupé gegeben hatte, war von der neuen viertürigen Serie. Er rollte fast lautlos die Fahrspur der Müllautos entlang und blieb schließlich zwischen zwei hochragenden Müllbergen stehen.
Am Steuer saß der zweiundzwanzigjährige Hank Bandoglioni, hinter ihm sein fast zwanzig Jahre älterer Bruder Joseph. Auf dem Beifahrersitz hatte sich Steven Cherucci halb nach hinten gedreht. Er war knapp fünfzig, aber so hager und knochig wie ein Junge, der zu schnell gewachsen war. Sein faltenreiches Gesicht verzog sich zu einer Grimasse, die alles Mögliche bedeuten konnte.
»Schau, Fred«, sagte er mit seiner krächzenden Stimme, »wir wollen ja nur wissen, wie du es gemacht hast. Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder?«
Der Angesprochene saß auf dem Rücksitz neben Joseph Bandoglioni. Er hieß Albert Allan, war achtundzwanzig Jahre alt und zweimal wegen Diebstahls vorbestraft. Jetzt schwitzte er außerordentlich stark, obgleich es gar nicht so warm war. Von den nassen Flecken in seinen Achselhöhlen ging ein scharfer Geruch aus.
Über die Schläfen her liefen ihm Rinnsale von Schweiß an den Wangen hinab, über den kantigen Kiefer und den Hals. Sein leichter Sommeranzug stammte von einem Maßschneider, und auch die Seidenkrawatte verriet, dass Allan gute Einkünfte gehabt haben musste. Für den Geschmack der Familie Bandoglioni zu gute.
»Fred!«, wiederholte Cherucci drängend.
»Ich heiße Albert«, stieß Allan scharf hervor. »Nichts für ungut, Steven«, setzte er lahm hinzu.
Cherucci verzog wieder einmal das faltenreiche Gesicht.
»Natürlich, Albert«, sagte er und breitete beide Hände aus. »Ich werde alt, Amigo. Nicht einmal die Namen kann ich mir merken. Fred, natürlich. Fred, das war dein Vorgänger. Ein lebenslustiger, aufgeweckter Junge! Vielleicht ein bisschen zu lebenslustig. Was meinst du, Albert?«
»Ich weiß nicht«, sagte Allan schnell. »Ich habe ihn ja kaum gekannt.«
»Das ist schade.« Cherucci seufzte. »Du hättest ihn bestimmt gemocht. Ihr beide seid euch in vielem ähnlich. Hab ich nicht recht, Joseph?«
Joseph Bandoglioni war dicht an das geöffnete Wagenfenster gerückt, um dem Schweißgeruch von Allan aus dem Weg zu gehen. Von draußen kroch der Gestank der Müllkippe in seine empfindliche Nase. Er zog ein Fläschchen Eau de Cologne aus der linken Hosentasche und schnüffelte.
»Du hast immer recht, Onkel Steven«, sagte er gelangweilt. »Können wir das nicht alles ein bisschen schneller abwickeln? Hier stinkt es ja wie die Pest.«
»Ja, wir sollten unsere Zeit nicht vergeuden«, meinte Cherucci. »Du hast es gehört, Albert. Jetzt rede nicht mehr um den heißen Brei herum. Du hast die übliche Wochenlieferung bekommen – und mehr als das Dreifache abgesetzt.«
»Nein!«, kreischte Allan. »Nein, Steven! Wie könnte ich das?«
»Nun«, sagte Cherucci, »woher soll ich das wissen? Sag es uns, Amigo!«
»Ein bisschen mehr habe ich schon abgesetzt«, gestand Allan und nestelte an seiner gelben Krawatte. »Ich habe das Zeug ein bisschen gestreckt. Ich geb's zu, Steven. Und du weißt, das machen alle!«
Cherucci nickte betrübt. »Jaja. Ich weiß. Es gibt keine Ehrlichkeit mehr. Das ist dein Fehler, Albert. Wie ich schon sagte: Du hast viel Ähnlichkeit mit deinem Vorgänger Fred. Der fing auch an, uns zu betrügen. Gott sei seiner Seele gnädig!«
Albert Allan öffnete den Mund, doch es kam nur ein heiseres Krächen aus seiner Kehle. Seit Fred verschwunden war, wurde allerlei gemunkelt. Nun hatte es Cherucci ausgesprochen. Nun gab es keinen Zweifel mehr. Sie hatten Fred umgebracht.
Albert Allans Augen irrten von Cherucci zu Hank Bandoglioni, der am Steuer saß.
Cherucci atmete pfeifend aus. »Man kann das Zeug nicht so strecken, dass mehr als die dreifache Menge herauskommt. Wer das tut, ist ein Narr, von dem keiner wieder Stoff kaufen wird. Aber was du verkauft hast, war nicht schlechter als sonst. Du kannst es also nicht allein durch Strecken auf diese Menge gebracht haben. Du musst einen zweiten Lieferanten haben. In unserem Markt einen zweiten Lieferanten, von dem du uns nichts gesagt hast, Albert! Das ist nicht schön von dir.« Cherucci schüttelte den Kopf wie ein betrübter Familienvater, der von seinen geliebten Kindern hintergangen wurde. »Steig aus, Albert«, sagte er leise und drehte sich nach vorn, als könnte er den Anblick des schweißüberströmten Mannes nicht mehr ertragen. »Erzähl es Hank. Sag ihm, wer der zweite Lieferant ist. Ich bin so traurig über deinen Betrug, dass ich dich nicht mehr ansehen kann. Steig aus!«
Allan schluckte. Vorn stieß Hank Bandoglioni die Fahrertür auf und schob sich hinaus. Er ging um das Heck des Wagens herum und zog die hintere Tür neben Albert Allan auf.
Wortlos griff er in Allans schweißnasses Haar und schlug ihm den Kopf gegen den Türrahmen.
»Hank«, sagte Joseph Bandoglioni angewidert, »nicht hier, bitte!« Von Neuem führte er das Parfümfläschchen an die Nase.
Albert Allan blutete an der rechten Schläfe. An den Haaren riss Hank ihn aus dem Wagen. Allan konnte vor Todesangst kaum gehen.
Über aufgeweichte Kartons, Tausende zerdrückter Konservendosen, weiß glitzernden Kunststoff aus Fernseh- und Waschmaschinenverpackungskisten, zersplitterte Coca- und Ketchupflaschen riss er Allan weiter und weiter am Rand der aufgetürmten Müllhalde entlang.
Er ließ Allan los und spähte abschätzend den Hang des Abfallbergs hoch.
Als Hank das Schnappmesser aus der Hosentasche zog, versagten Allans Schließmuskeln. Durch seine helle Hose sickerte ein gelber Strahl Urin, während gleichzeitig unverkennbare Geräusche anzeigten, dass sich sein Darm entleerte.
Angewidert verzog Hank das Gesicht. Widerwillig tat er, was von ihm erwartet wurde, und mit beleidigtem Gesichtsausdruck kehrte er fünf Minuten später zum Wagen zurück.
Er warf sich hinters Steuer, legte den Rückwärtsgang ein und ließ den schweren Wagen viel zu schnell die Fahrspur der Müllschlepper zurückrollen, bis sie wieder auf der Zufahrt zur Küstenstraße waren.
»Scheißer«, sagte er in inbrünstiger Wut. »Alles Scheißer! Uns wollen sie anschmieren – aber wenn's ernst wird, bescheißen sie sich selber!«
»Weißt du es?«, fragte Cherucci.
Hank riss das Steuer herum und schaltete. Es war seinem Drängen zu verdanken, dass sie einen Wagen ohne Automatic bekommen hatten.
»Was?«, fragte er heftig. »Was soll ich wissen?«
Die Reifen radierten, als er den Wagen vorwärtspreschen ließ.
»Nimm dich zusammen, Hank!«, zischte Joseph vom Rücksitz her. »Bist du wütend, weil er es nicht gesagt hat?«
»Mir sagen sie alles, was ich hören will, verflucht noch mal!«
Joseph holte hörbar Luft, doch Cherucci hatte sich nach ihm umgedreht und sagte schnell: »Kennst du deinen Bruder immer noch nicht? Er ist wütend, weil es zu schnell ging. Nicht wahr, Hank?«
»Halt's Maul!«
Joseph beugte sich vor. »Sprich nicht so mit deinem Onkel und in meiner Gegenwart. Oder ich schlage dir die Zähne ein, kleiner Bruder. Und jetzt sag uns endlich, wer der zweite Lieferant war!«
Sie fuhren die breite Küstenstraße hinauf nach Norden. Hank hatte das Tempo dem allgemeinen Verkehr angepasst, sein Gesicht wirkte jedoch noch immer verkrampft.
»Der Scheißer hat zwei Pfund aus New Jersey gekriegt!«
»Aus ...«
Joseph Bandoglioni sprach den Satz nicht zu Ende. Er runzelte die Stirn und blickte Hilfe suchend auf Cherucci, der ebenso verblüfft aussah.
»Von Jersey?«, wiederholte Cherucci. »Und so was lässt du Narr dir aufschwatzen? Von Jersey? Wir haben eine Abmachung mit der Wallisi-Familie! Das musst du doch wissen!«
»Ich sage euch!« Hank schrie es hinaus. »Ich sage euch, dass der Scheißer zwei Pfund aus Jersey geliefert bekam! Ein Kerl mit einem Muttermal auf der linken Hand hat es ihm höchstpersönlich gebracht!«
Joseph Bandoglioni ließ sich in die Lehne zurücksinken und murmelte: »Dann stimmt es. Das war Alfredo Wallisi selber.«
Cherucci schüttelte den Kopf. »Aber das ist Wahnsinn! Die müssen wissen, dass wir uns das nicht gefallen lassen können!«
»Vielleicht hat Alfredo etwas auf die Seite gebracht und wollte ein Geschäft machen, von dem seine Familie nichts erfahren durfte?«, meinte Joseph.
»Nicht bei dieser Menge«, widersprach Cherucci. »Nein, nein. Das ist eine offene Kriegserklärung.«
Es war ausgesprochen, und sie wussten alle, dass er recht hatte. Von nun an sprachen sie nicht mehr, bis der Wagen die geschwungene Auffahrt zu dem Hügel hinaufrollte, der von den vier Häusern der Familie Bandoglioni gekrönt wurde. Obgleich es ihm niemand aufgetragen hatte, hielt Hank vor dem größten Gebäude an.
»Wer soll es ihm sagen?«, fragte Joseph.
»Besser, wenn du es tust«, meinte Cherucci. »Du weißt ja, dass er dich als seinen Nachfolger sehen möchte. Dann musst du ihm beweisen, dass du auch das Unangenehmste auf deine Schultern nimmst.«
Joseph Bandoglioni schnüffelte an seinem Parfümfläschchen. Bevor er es wegsteckte, seufzte er. »Ich hasse dieses Leben.«
Er stieg aus und stapfte die Stufen der breiten Freitreppe hinauf. Noch bevor er die massive Eichentür erreicht hatte, wurde sie nach innen aufgezogen, und ein kleiner rundlicher Mann mit einer schwarzen Tasche kam heraus.
»Oh, gut, dass Sie kommen, Joseph!«, rief er lebhaft. »Ihr Vater ...«
»Um Gottes willen! Madonna! Was ist passiert?«
»Das Herz. Ich habe euch hundertmal gesagt, ihr sollt jede Aufregung von ihm fernhalten! Aber es hört ja niemand auf mich!«
Joseph Bandoglioni knöpfte sein Jackett auf und zu und wieder auf und zu. »Wer hat Papa aufgeregt, Doktor Mirelli? Wer?«
»Das verdammte Telegramm! Man hätte es ihm nicht zeigen dürfen! Ich muss weiter, Joseph. Heute Abend schaue ich noch einmal herein. Und sorgen Sie dafür: keine Aufregungen! Oder Ihr Papa braucht keinen Arzt mehr, Joseph.«
Während der kleine, rundliche Mann bemerkenswert behände die Freitreppe hinabhastete, betrat Joseph Bandoglioni die kühle Halle der großen Villa. Er eilte die geschwungene Marmortreppe hinauf ins Obergeschoss. Vorsichtig drückte er die Klinke einer großen Doppeltür auf. Er hörte das leise Weinen seiner alten Mutter kaum. Er vernahm nur die pfeifenden Atemzüge seines schlafenden Vaters. Offenbar hatte ihm der Arzt ein starkes Beruhigungsmittel gegeben.
In der linken Hand hing ein Stück Papier vom Bett herab. Joseph löste es behutsam aus den knochigen Fingern.
Es war ein Telegramm mit nur einem einzigen Satz.
Der Adler ist abgeflogen.
3»Der Pole«
Die Sonne stand schon tief im Westen, als er in den Central Park schlenderte. Er trug einen hellen Maßanzug, ein blütenweißes Hemd und eine gelbe Seidenkrawatte. An den Füßen saßen handgearbeitete, luftig geflochtene Wildlederslipper zu einem Preis, von dem eine gewöhnliche Familie einen Monat lang hätte leben können.
Vor über dreißig Jahren war er ein berühmter Mann gewesen, oder besser, ein berüchtigter. Unter seinem Spitznamen »der Pole« hatte er zu den bekanntesten Figuren der Unterwelt gehört. Sein richtiger Name war Wladimir Kerinski, aber das war für amerikanische Zungen zu kompliziert. Und so hatte sich der Spitzname aus seinen Kindertagen durchgesetzt, und überall rief man ihn nur »den Polen«.
Kerinski war etwas gelungen, was den wenigsten Verbrechern glückte. Er hatte ein kleines Vermögen zusammengerafft und gut angelegt. Als in New York kurz nach dem Zweiten Weltkrieg das große Saubermachen einsetzte, konnte er es sich erlauben, sich von seinem gefährlichen und risikoreichen Gewerbe gänzlich zurückzuziehen. Er lebte in einer schönen Wohnung am East River in der Nähe des UN-Geländes, wo sich gewöhnliche Sterbliche gar keine Wohnung mehr leisten konnten. Und niemand in seiner feinen und reichen Nachbarschaft ahnte, dass der würdige alte Mr. Kerinski der seinerzeit so berüchtigte »Pole« war.
Natürlich gab es auf der Welt noch einige Leute, die sich der alten Tage erinnerten. Zum Beispiel jenseits des Hudson River die Mafiafamilie der Wallisi, noch immer mit harter Hand regiert vom alten Enrico Wallisi, den man wie üblich den Don nannte. Es gab nicht viele Leute auf der Erde, die sich hätten rühmen können, den alten Don Wallisi zum Verlassen des von ihm regierten Gebiets zu bewegen und nach New York zu bekommen. Dem »Polen« war es gelungen, wie er schon von Weitem sah.
Don Wallisi hatte bereits in seinen jungen Jahren grundsätzlich einen Spazierstock bei sich getragen. Es war ein Stock aus französischer Eiche mit einer Büffelhornspitze und einer Krücke aus Sterlingsilber. Und er besaß den Stock, der bei ihm zu einem Markenzeichen geworden war, immer noch. Das polierte Silber blitzte schon von Weitem.
Er schlenderte einmal um den ganzen Teich herum und sah sich so gemächlich um, wie es Spaziergänger tun, denen es nicht an Zeit mangelt. Aber er tat es mit dem Blick des geschulten Mannes, der früher einmal behauptet hatte, er könne einen Polizisten selbst in der Badehose erkennen.





























