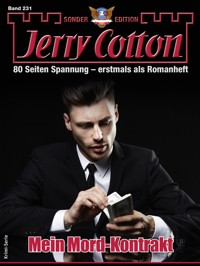
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jerry Cotton Sonder-Edition
- Sprache: Deutsch
In meinem Hotelzimmer lag ein brauner Umschlag. Ich öffnete ihn und fand fünfzehntausend Dollar! Im nächsten Augenblick schrillte das Telefon. Ich nahm ab. Eine unbekannte Männerstimme sagte: "Ich nehme an, Sie haben das Geld gefunden, Cotton. Sie werden in unserem Auftrag einen prominenten Mann töten. Das Geld gehört Ihnen. Es ist die Anzahlung auf Ihren Mord-Kontrakt."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Mein Mord-Kontrakt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Vorschau
Impressum
Mein Mord-Kontrakt
In meinem Hotelzimmer lag ein brauner Umschlag. Ich öffnete ihn und fand fünfzehntausend Dollar! Im nächsten Augenblick schrillte das Telefon. Ich nahm ab. Eine unbekannte Männerstimme sagte: »Ich nehme an, Sie haben das Geld gefunden, Cotton. Sie werden dafür in unserem Auftrag einen prominenten Mann töten. Das Geld gehört Ihnen. Es ist die Anzahlung auf Ihren Mord-Kontrakt.«
1
Henry Dyson schwitzte erbärmlich. Aber er wagte es nicht, von der Seite des hünenhaften Oliver Cervera zu weichen, dem die schwüle Hitze nichts anzuhaben schien. Seit fast einer Stunde standen sie am Rand des Vorfelds. Unverwandt war das zerklüftete Gesicht des Kolumbianers in den gleißenden Himmel gerichtet.
Der winzige Punkt, der vor wenigen Minuten am glühenden Himmel über der Karibik sichtbar geworden war, verwandelte sich allmählich in den schneeweißen Rumpf eines kleinen Jets. Weit draußen über der Bucht zog der Learjet eine Schleife, um am anderen Ende des Rollfelds zur Landung anzusetzen.
Henry Dyson sah sich um und erschrak. Rings um das Vorfeld waren Militärfahrzeuge aufgefahren, als würde ein Staatsbesucher erwartet oder als sollte eine Invasion abgewehrt werden. Dabei war es nur Cerveras Tochter, die heimkehrte. In einem eigens für sie gecharterten Jet, der in Wirklichkeit eine fliegende Intensivstation war.
Ein Klinomobil rollte zwischen den Militärfahrzeugen her und hielt mit laufendem Motor an. Die beiden Ärzte stiegen aus, blieben jedoch bei ihrem Wagen.
Henry Dyson rannte neben Cervera her, der jetzt mit ausgreifenden Schritten auf den Learjet zueilte. Das Syndikat erwartete von ihm nicht nur, dass er das Aussichtslose versuchte. Es rechnete damit, dass er Erfolg hatte.
Das schrille Pfeifen der Triebwerke erstarb. Die Kabinentür wurde von innen geöffnet. Ein Hubwagen rollte heran. Die hydraulische Plattform glitt in die Höhe und hielt genau an der Kante der Kabinentür an.
Zwei Schwestern in hellblauen Kitteln und der amerikanische Arzt, der die Patientin während des Flugs betreut hatte, schoben das Spezialgestell mit dem Bett auf die Plattform. Der Arzt blieb neben dem Bett stehen. Er gab ein Handzeichen, und die Plattform schwebte lautlos abwärts.
Oliver Cerveras Schritte wirkten plötzlich kraftlos, als er sich dem Bett näherte. Der amerikanische Arzt schob das dünne Gewebe des Gazezelts, das die Patientin vor Sonne und Staub schützen sollte, ein wenig zur Seite.
Kein Muskel zuckte in dem Gesicht des Kolumbianers, als er die reglose Gestalt betrachtete. Das eingefallene Gesicht mit der durchsichtigen Haut wies kaum Ähnlichkeit mit den Zügen seiner Tochter auf, und doch war sie es, daran gab es keinen Zweifel. Einundzwanzig Jahre lang hatte er Maria-Pilar vor allen Gefahren des Lebens beschützen können. Sie war intelligent, hochbegabt. Schweren Herzens hatte er ihrem Drängen nachgegeben und ihr erlaubt, in den Vereinigten Staaten Chemie zu studieren. Vor drei Monaten war sie abgeflogen.
Und so kehrte sie zurück. Teilnahmslos, die Augen ins Leere starrend, die Umwelt nicht wahrnehmend. Ein Wrack!
Er wandte sich ab. Dyson sah an dem Kolumbianer vorbei, dessen Augen in Tränen schwammen.
»Ausgerechnet sie«, sagte Cervera heiser. »Ausgerechnet sie ...«
Dyson räusperte sich. »Damit konnte niemand rechnen. Es war Zufall, blinder Zufall ...«
»Erzählen Sie mir jetzt keine Geschichten, Dyson!«
»Keine Geschichten, Señor Cervera. Sie war so unerfahren, und sie war versessen auf diese Musik. In dem Klub gab es Marihuana und Haschisch ...«
»Wollen Sie die Schuld etwa auf mich schieben, Dyson?« Cerveras Hals schwoll an. »Wollen Sie mir mit der verquasten Psychologie Ihres dekadenten Landes kommen? Hätte ich sie darauf vorbereiten müssen, dass es bei euch an jeder Ecke Rauschgift zu kaufen gibt? Bin ich schuld, Dyson? Wollen Sie das behaupten?«
»Der Schuldige wurde bereits zur Verantwortung gezogen ...«
»Ein kleiner Dealer! Glauben Sie, damit wäre für mich alles erledigt? Und für sie?« Er deutete auf den davonfahrenden Wagen, in dem seine Tochter nun lag. »Nein, Dyson, nein. Ich weiß, was ich zu tun habe.«
»Es war Heroin, kein Kokain«, sagte Dyson. Der Schweiß rann in Strömen an seinem Körper hinab.
»Die Hände, die das Gift verteilen, sind dieselben. Verlassen Sie die Stadt, Dyson. Verlassen Sie das Land, bevor ich es mir anders überlege!«
»Sie können die Lieferungen nicht einfach einstellen!«, sagte Dyson laut.
»Wer will mich daran hindern? Sie?«
»Es ist ein Milliardengeschäft! Auch Sie haben daran verdient, Señor Cervera. Das Syndikat nimmt es nicht hin, wenn Sie plötzlich den Saubermann spielen wollen.«
»Sie werden versuchen, einen Nachfolger für mich zu finden. Deshalb werden sie Killer schicken. Na und?« Cervera wies auf die Militärfahrzeuge, die drohend in der glühenden Sonne standen. »Glauben Sie, die können mir etwas anhaben?«
»Sie können sich nicht immer hinter Ihrer Streitmacht verstecken, Señor Cervera. Es wird einen geben, einen, der es schafft ...«
Cervera lächelte, bevor er sich umwandte. Es war ein grausames Lächeln.
»Irgendwann«, sagte er verächtlich.
»Nicht irgendwann, Señor Cervera!«, schrie Dyson. »Bald! Bald wird jemand kommen und Sie ins Jenseits befördern!«
Aus dem kalten, trüben New York, aus einem Frühling, der ein Winter war, flog ich der Sonne entgegen. Kurz nach dem Start in Houston, Texas, wo die Boeing der PanAm zu einer Zwischenladung angesetzt hatte, schepperte die Stimme des Flugkapitäns aus den Kabinenlautsprechern, während die Hochhäuser der texanischen Großstadt unter der rechten Tragfläche verschwanden.
»Mexico City liegt rund siebentausendfünfhundert Fuß über dem Meeresspiegel. Die Temperatur am Boden beträgt zurzeit sechsundsechzig Grad Fahrenheit und wird bis zu unserer Ankunft auf fünfundsiebzig oder siebenundsiebzig ansteigen. Die Flugzeit wird eine Stunde und fünfundfünfzig Minuten betragen. In etwa zehn Minuten überfliegen wir den Rio Grande. Sie werden den Fluss sehen können, wenn Sie nach links hinausblicken ...«
Die Stimme des Kapitäns übertönte das gleichmäßige Geräusch der Triebwerke, die den Jet in den klaren blauen Himmel schoben, während die fruchtbaren, grün leuchtenden Ebenen des südlichen Texas ihre Konturen verloren. In Mexico City fand ein internationaler Polizeikongress statt, auf dem die besonderen Aspekte des Terrorismus auf den amerikanischen Kontinenten Gegenstand einer Reihe von Vorträgen und Arbeitskreisen waren. Ich war dazu ausersehen, das FBI zu vertreten. Ich würde mir anhören, was die Experten an neuen Erkenntnissen über Ursachen und Bekämpfung des Terrorismus aufzubieten hatten. Ich würde selbst ein Referat über die Lebensbedingungen ethnischer Minderheitengruppen in amerikanischen Großstädten halten. Die Anpassungsschwierigkeiten vor allem der jüngeren Angehörigen dieser Bevölkerungsteile sind als Ursache eines hohen Gewaltpotenzials anzusehen, auch wenn die Grenzen zwischen terroristischer und krimineller Tätigkeit fließend sind.
Ich hätte mich auf den Trip in den Frühling freuen können, wenn da nicht eine kleine Sonderaufgabe gewesen wäre, die mir John D. High, Chef des FBI New York, kurz vor dem Abflug mit auf den Weg gegeben hätte.
»Was sagt Ihnen der Name Oliver Cervera?«, fragte Mr. High, als ich mich von ihm verabschieden wollte. Er hatte das Manuskript meines Referats gelesen. Ohne Änderungen oder Ergänzungen vorzuschlagen, schob er es mir wieder zu.
»Meinen Sie den Kolumbianer? Den Schlächter von Barranquilla?«
Mr. High schüttelte den Kopf. »Das war sein Vater, Francisco Oliver Cervera Delgado. Francisco Cervera war General im Dienst zweier Militärdiktaturen. Er hat den 49er Aufstand niedergeworfen, bei dem vierzehntausend Menschen getötet wurden. 1954 fiel er einem Attentat zum Opfer. Aber die geschichtlichen Zusammenhänge sollen uns jetzt nicht interessieren.«
Ich nickte.
»Oliver Cervera ist der Polizeipräfekt von Barranquilla, der großen Hafenstadt im Norden Kolumbiens. Weil ihm die Bekämpfung der Rebellen in seinem Amtsbereich übertragen wurde, bekleidet er in Barranquilla und dem zugehörigen Departamento Atlantico praktisch die Stellung eines Militärgouverneurs. Irgendwann wurde er mit außergewöhnlichen Vollmachten ausgestattet, die man ihm später nicht mehr streitig zu machen wagte. Denn er hatte eine paramilitärische Antiterror-Einheit aufgebaut, die praktisch seine Privatarmee ist. Und die setzt er rücksichtslos für private Zwecke ein.«
»Verstehe.«
»Nach den Erkenntnissen der Drogenbehörde steckt er ganz tief im Rauschgiftgeschäft. Achtzig Prozent des Kokains, das in die Staaten gelangt, wird in den Bergen der Küstenregionen Kolumbiens angebaut. Oliver Cervera ist der Mann, der den Transport des Kokains von den Plantagen in den Bergen bis zum Hafen von Barranquilla besorgt, wo das Gift entweder auf Schiffe oder in Flugzeuge verladen wird und in die Staaten geht.«
Ich hätte gern eine Zigarette geraucht, um den schalen Geschmack loszuwerden. Es waren Männer wie Oliver Cervera, die mit ihrer Hausmacht, mit Geld und Gewalt alle Bemühungen, die Seuche Rauschgift auch nur einzudämmen, zunichtemachten.
»Das heißt«, fuhr der Chef nach einer kurzen Pause fort, »Oliver Cervera hat sich aus dem Kokainhandel zurückgezogen. Von heute auf morgen.«
Ich stieß einen leisen Pfiff aus. Dann würde die Mafia bald auf dem Trockenen sitzen. Kokain war zur Droge Nummer eins aufgestiegen. Es gab einen ungeheuren Boom mit entsprechend großem Bedarf, und die Nachfrage stieg immer noch. Kolumbien war der Hauptlieferant. Neue Quellen ließen sich nur nach jahrelangen Vorbereitungen erschließen.
»Was war die Ursache für seinen Sinneswandel?«, fragte ich.
»Er hat eine Tochter, Maria-Pilar. Vor drei Monaten ließ er sie nach Boston gehen. Sie wollte dort Chemie studieren. Einundzwanzig Jahre lang hat sie in einem goldenen Käfig gelebt. Sie war auf das Leben außerhalb ihres Käfigs überhaupt nicht vorbereitet. Es ging blitzschnell. Sie probierte Marihuana, kam auf LSD, und ein paar Wochen später hing sie schon an der Nadel. Um ein Haar wäre sie ums Leben gekommen. Cervera hat sie nach Hause geholt ...«
»... und der Mafia den Kokainnachschub gesperrt? Lässt sie sich das gefallen?«
»Ihr wird nichts anderes übrig bleiben«, sagte mein Chef. »In Boston sind einige Dealer und Pusher auf spektakuläre Weise ermordet worden. Die Typen, die Maria-Pilar auf die Nadel gebracht haben, sind dabei. Aber das Opfer war sinnlos, wie es scheint. Cervera kommt mit einem großen Tross nach Mexico City.«
Jetzt kommt der Pferdefuß, dachte ich unbehaglich.
»Er wird über Querverbindungen und Beziehungen zwischen kriminellen und anarchistischen Täterkreisen in Südamerika sprechen ...«
»Ausgerechnet er«, sagte ich erbittert.
»Versuchen Sie, mit ihm ins Gespräch zu kommen, Jerry«, sagte mein Chef, ohne auf meinen Einwand einzugehen. »Finden Sie heraus, ob er, unter welchen Bedingungen auch immer, bereit ist, über seine Kontakte zu den Syndikaten zu sprechen. Über Geldtransaktionen, Kontaktpersonen, Mittelsmänner. Über die Großen.«
»Wäre das nicht Aufgabe der DEA?«, fragte ich.
Die DEA, die Drug Enforcement Administration, ist die international operierende Drogenbehörde der USA.
In Zusammenarbeit mit Politikern und Polizeibehörden anderer Länder versucht sie, Rauschgiftanbau und Drogenhandel bereits an der Quelle zu bekämpfen.
»Die Drogenbehörde hat zu lange gegen ihn gearbeitet«, erklärte Mr. High. »Sie hat jahrelang versucht, auf politischem Weg seine Ablösung zu erreichen und so die Voraussetzungen für Transport und Weiterverarbeitung des kolumbianischen Kokains zu erschweren. Mit DEA-Vertretern spricht er nicht. Einer vom Justizminister eingesetzten Delegation hat er unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass er eine Entscheidung getroffen habe, die ihn allein betreffe. Er will nicht den Spitzel oder Verräter spielen.«
»Aber ausgerechnet meiner Überredungskunst wird er erliegen und den Wandel vom Saulus zum Paulus endgültig vollziehen?« Ich schüttelte den Kopf. »Sie überschätzen mich. Ich bin nicht der Typ, der einem solchen Verbrecher mit diplomatischem Geschick näher kommt. Beim ersten falschen Wort gehe ich ihm an die Kehle!«
Mein Chef hatte gelächelt. »Das werden Sie nicht tun. Und außerdem, Sie stehen nicht unter Erfolgszwang. Sie sollen es nur versuchen.«
Mit dieser Hypothek im Kopf flog ich nach Mexico City ...
Neben mir am Kabinenfenster saß ein massiger Mann mit hellblonden Haaren und einem mächtigen Doppelkinn. Er stieß mich an und deutete aus dem Fenster nach unten.
»Der Rio Grande«, sagte er mit dröhnender Stimme.
Weil sein unförmiger Bauch es mir unmöglich machte, mich hinüberzulehnen, reckte ich nur den Hals und lächelte begeistert.
Mein Sitznachbar trug ein scheußliches blau-weiß kariertes Jackett und eine giftgrüne Krawatte. Seine Aufmachung und sein lautstarkes Gehabe erinnerten an den klassischen Witzblatt-Touristen. Dabei war auch er ein Kollege. Längst hatten wir uns bekannt gemacht.
Er hieß Ernest Hillerman, war Detective Captain und arbeitete bei der Einwanderungsbehörde in Key West, Florida. Unter den Einwanderern oder Asylsuchenden aus den süd- und mittelamerikanischen Staaten verbargen sich nicht nur Rauschgiftkriminelle, sondern auch Extremisten aller Schattierungen. Sie herauszufiltern und davon abzuhalten, von US-amerikanischem Boden aus anarchistische oder terroristische Aktionen vorzubereiten oder durchzuführen, war Ernest Hillermans Job.
Die Stewardessen boten Getränke an. Hillerman nahm eine Cola. Ich entschied mich für Orangensaft. Mein linker Sitznachbar bestellte Bourbon.
»Das einzig Wahre!« Ernest Hillerman lachte dröhnend, als er sich vorbeugte und dem anderen zunickte. »Für mich nur etwas zu früh. Sind Sie auch ein Cop?«
Der Mann neben mir kippte seinen Bourbon und nickte. Er machte eine Handbewegung, die den ganzen hinteren Teil der Kabine einschloss.
»Hier hinten ist doch alles für den Copkongress reserviert!« Er wandte Hillerman das Gesicht zu und streckte ihm die Hand hin. »Ich bin Stan Ladbrook aus New Orleans.«
Anschließend drückte ich ihm die Hand. Sie fühlte sich feucht und glitschig an. Die blassen Augen und die hin und wieder unkontrollierbar zuckenden Mundwinkel schienen das einzig Lebendige in dem starren fahlen Gesicht zu sein.
Er schnippte mit den Fingern und ließ sich von der Stewardess noch einen Bourbon bringen. Aus der Plastiktüte, die zwischen seinen Knien klemmte, ragte der Hals einer Viertelgallonenflasche Kentucky Straight aus dem Duty Free Shop des Houston Airport.
»Vielleicht hat er nur Angst vorm Fliegen«, flüsterte Hillerman mir zu. Aber bis die Boeing auf dem Benito Juarez International in Mexico City aufsetzte, hatte Ladbrook die Stewardess noch einige Male bemüht und darüber hinaus auch schon dem Inhalt der mitgebrachten Flasche zugesprochen.
Stan Ladbrook, der Kollege aus New Orleans, kam betrunken in Mexikos Metropole an.
»Wir können uns ein Taxi teilen«, schlug ich vor, als wir wenig später am Gepäckband standen und auf unsere Koffer warteten.
Ernest Hillerman hieb mir seine Pranke auf die Schulter. »Tut mir leid, Jerry, ich werde von einem Colonel der Grenzpolizei abgeholt. Ich bin froh, dass ich mit so einem Burschen mal auf die freundliche Tour etwas bereden kann.«
»Macht nichts«, sagte ich und sah Stan Ladbrook an, der ein schwarzes Kofferungetüm vom Band wuchtete. »Warten Sie, Stan, wir fahren zusammen.«
»Ich hab mir 'nen Leihwagen bestellt.« Ladbrook keuchte und setzte seinen schweren Koffer haarscharf neben meinen Fuß. »Aber ich kann Sie mitnehmen«, fügte er undeutlich hinzu. Seine blassen Augen schwammen bei dem Versuch, freundlich zu blinzeln.
Ladbrook nahm seinen schweren Koffer wieder auf und schwankte davon. Ich erspähte mein Gepäck, zerrte es vom Band und hastete hinter Ladbrook her.
Hillerman hatte seinen Koffer gerade geschnappt. Er blieb an meiner Seite, deutete mit dem massigen Kinn auf den vorausschwankenden Kollegen und meinte: »Wir können ihn doch nicht im Stich lassen, G-man.«
»Keine Sorge«, knurrte ich. Der Gedanke, Kindermädchen für einen Kollegen spielen zu müssen, der eine Dienstreise zum Anlass nahm, sich sofort zu besaufen, gefiel mir überhaupt nicht.
Wir kamen glatt durch die Pass- und Zollkontrolle. In der Ankunftshalle wurden einige der mitgereisten Kollegen von Bekannten oder mexikanischen Kollegen, mit denen sie mal zusammengearbeitet hatten oder die sie von anderen Tagungen und Kongressen her kannten, in Empfang genommen.
Ladbrook steuerte den Schalter einer Leihwagenfirma namens Panamericana an. Hillerman blieb zurück.
»Hi, Jerry, hi, Stan!«, rief uns der Kollege aus Florida nach. »Wir sehen uns im Hotel!«
Stan Ladbrook verhandelte bereits mit einer niedlichen, glutäugigen Mexikanerin, deren Rundungen in einer hübschen blau-roten Uniform steckten. Ladbrooks Fahne musste ihr ins gerade Näschen wehen. Aber anstandslos bekam er die Wagenpapiere und den Wagenschlüssel, nachdem sie seine Kreditkarte durch den Schlitz des Buchungsautomaten gezogen hatte.
»Felipe wird Ihnen den Wagen zeigen«, sagte sie und drückte einen Klingelknopf.
Während wir auf Felipe warteten, lächelte die Frau unentwegt zwischen Ladbrook und mir hin und her. Sie hieß Emilia Ansorena, wie das Namensschild auf der Wölbung ihrer Brust verriet. Ich versuchte, ihr Lächeln einzufangen, was mir nicht gelang, bis ich plötzlich das Gefühl hatte, als ob das Lächeln jemand anders galt.
Ich wandte den Kopf. In der Masse fiel mir kein Gesicht besonders auf. Nur ein scheußliches blau-weiß kariertes Jackett. Ernest Hillerman, gefolgt von einem schlanken Mann in einem gut geschnittenen hellen Leinenanzug, pflügte wie ein Rammbock durch die Menge. Von dem Colonel sah ich sonst nur den Rücken und glattes blauschwarzes Haar, das wie eine Kappe am schmalen Schädel haftete.
»Kommen Sie bitte mit, Señores!«
Felipe ergriff unsere Koffer und eilte zu einem Seitenausgang voraus. Das Gewicht von Stan Ladbrooks schwerem Koffer schien dem schmächtigen Mexikaner nichts auszumachen.
Ich nahm Ladbrook Arm und schob ihn vor mir her. Wir umrundeten eine Reisegruppe, deren Teilnehmer erschöpft auf ihren Koffern hockten. Hinter einer ganz in schwarz gekleideten Matrone schob sich plötzlich ein Mann hervor, dessen schwammige Gestalt in einem zerknitterten hellgrauen Anzug steckte.
Die herabgezogene Krempe eines formlosen Huts verdeckte seine Augen. Sein Gesicht konnte ich ebenfalls nicht erkennen, weil er in diesem Moment eine Kamera hochriss. Das eingebaute Blitzlicht flammte auf. Ich blinzelte kurz und wollte stehen bleiben. Doch der Mann in Grau war bereits in der Menge untergetaucht, und Ladbrook, der von dem Vorfall nichts bemerkt hatte, zerrte ungeduldig an meiner Hand.
Der Kerl hatte uns fotografiert, da war ich mir sicher.
Nur wen hatte er gemeint? Stan Ladbrook? Oder mich? Oder uns beide?
Die Luft draußen kam mir im ersten Moment heiß und stickig vor. Aber sie war trocken, und der stickige Dunst stammte von den unzähligen Autos, die den Platz vor den Abfertigungshallen umrundeten oder mit laufenden Motoren vor den Ausgängen warteten.
Felipe führte uns zu einem gelben Toyota, der unter einem schattenspendenden Dach stand. Während ich Felipe, der unser Gepäck in den Kofferraum wuchtete, hundert Pesos Trinkgeld gab, klinkte Ladbrook bereits die Fahrertür auf.
Ich packte seinen Arm und zog ihn zurück. Felipe grinste vielsagend und sprang leichtfüßig davon. Ich bugsierte Ladbrook auf den Beifahrersitz. Er protestierte nur schwach.
Ich nahm den Platz hinter dem Lenkrad ein und schnallte mich an.
»Das sollten Sie auch tun«, sagte ich.
Ladbrook brummelte nur undeutlich vor sich hin. Ich umrundete den Verteilerkreis und bog in den Boulevard Puerto Aéreo ein, der auf schnellstem Weg in die City führt.
Ich sah in den Rückspiegel, konnte jedoch nichts Auffälliges feststellen. Der Gedanke an den Kerl, der uns in der Ankunftshalle fotografiert hatte, beunruhigte mich. Mir konnte das Interesse des Fotografen allerdings nicht gegolten haben.
»Kennen Sie jemand hier?«, fragte ich. »Oder werden Sie erwartet?«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Weil Sie einen Leihwagen genommen haben. Ein Taxi wäre billiger für die paar Tage.«
»Zerbrechen Sie sich nicht meinen Kopf«, sagte Ladbrook. Er holte die Bourbonflasche aus der Plastiktüte und schraubte den Verschluss ab.
»Das sollten Sie jetzt besser lassen«, sagte ich ruhig.
»Was sind Sie für einer? Wollen Sie mir Vorschriften machen?«
»Nein ...«
»Schnallen Sie sich fest, Stan, trinken Sie nicht so viel, Stan ...« Ich spürte seinen bösen Seitenblick. »Sie sind der richtige Schnüfflertyp, was?« Er setzte die Flasche an die Lippen und ließ eine gehörige Portion in seinen Mund gluckern. »Was jetzt, Cotton? Ich bin ein freier Mann ...«
»Und ein amerikanischer Cop!«
Er lachte trocken auf. »Das verpflichtet mich, mich wie ein Musterknabe zu benehmen? Sie sind einer, Cotton. Was werden Sie tun? Mich beim Deputy Chief Commissioner von New Orleans anschießen? Nur los, der will mich sowieso feuern.«
»Ich werde nichts dergleichen tun!«, sagte ich scharf.
»Dann ist es ja gut«, sagte Ladbrook und nahm einen neuen Schluck. »Ich bin gern unabhängig, Cotton, verstehen Sie? Deshalb diese Kiste. Ich bin ein paar Tage raus aus diesem verschissenen Kaff am Golf, verstehen Sie? Da will ich Bewegungsfreiheit haben. Ich suche mir 'ne gute Nutte und ...«
»So genau will ich's nicht wissen«, unterbrach ich ihn, bevor er mir Einzelheiten seiner Freizeitgewohnheiten anvertrauen konnte. »Jeder muss selbst wissen, was er tut.«
»Sehr richtig!«
»Wir sind fotografiert worden«, sagte ich.
»Fotografiert? Wir? So schön sind wir doch gar nicht! Wo denn?«
»In der Flughafenhalle.«
»Das wird einer von den Fotografen gewesen sein, die nachher beim Abflug mit den Bildern dastehen und kassieren wollen«, meinte er und schraubte seine Flasche wieder zu.
Die Antwort war ein wenig zu glatt gekommen, wenn ich das Quantum Bourbon bedachte, das Ladbrook in sich hineingeschüttet hatte. Aber ich ließ das Thema fallen, weil ich es hasse, mir miese Ausreden auftischen zu lassen.
Die Tagung fand auf Einladung der mexikanischen Bundesregierung hin statt. Deshalb waren alle Tagungsteilnehmer Gäste der Regierung. Wir waren im Hotel Nacional untergebracht, einem Luxushotel, das zu einem neuen Kongresszentrum westlich der Pinacoteca Nacional gehört.
Ich überließ den Toyota und Ladbrooks Koffer einem Boy und nahm nur mein Gepäck mit, als ich den Kollegen aus New Orleans in die Halle bugsierte. Stan Ladbrook ging mit den steifen Schritten des Betrunkenen auf die Rezeption zu, wo er sich wie ein Ertrinkender, dem im letzten Moment ein rettender Balken entgegengeschwommen war, festklammerte.
»Danke, Cotton«, murmelte Ladbrook, »ich komme jetzt zurecht.«
Ich war ebenfalls der Ansicht, dass ich meiner Fürsorgepflicht einem Landsmann und Kollegen gegenüber fürs Erste Genüge getan hatte und mich jetzt um mich selbst kümmern konnte.
Ich schob meine Anmeldebestätigung zum Kongress über das Pult.
»Willkommen im Nacional, Mister Cotton«, sagte der Empfangschef. »Sie wohnen im zwölften Stock, Zimmer 12033.« Er wandte sich um und nahm eine weiße Karte aus dem Schlüsselfach, die er mir zusammen mit dem Zimmerschlüssel aushändigte. »Dieser Gentleman wartet in der Bar auf Sie.«
D. Manuel Tocedo Rivas, stand auf der Karte, darunter die Bezeichnung seiner Dienststelle und auf der Rückseite seine private Telefonnummer.
Manuel Tocedo war mexikanischer Bundespolizist, ein Beamter der Polícia Federal, im Volksmund Fed genannt, was dem US-amerikanischen FBI-Beamten oder G-man entsprach. Ich kannte Tocedo nicht persönlich. Doch sein Name war mir geläufig. Es kam häufiger vor, dass ich von New York aus Anfragen nach Mexiko richten musste, wegen vermisster Personen oder bei geflüchteten Verdächtigen.
Die Antworten waren meistens mit dem Namen M. Tocedo gezeichnet.
Immerhin ein bekannter Name in einer fremden Umgebung, dachte ich einigermaßen erfreut. Ich wandte mich um und schnappte nach Luft.
Das verheißungsvolle Lächeln der vollen roten Lippen traf mich mitten ins Herz. Abgrundtiefe dunkle Augen musterten mich herausfordernd. Langes schwarzes Haar umrahmte das längliche Gesicht, dessen glatte Haut wie Elfenbein glänzte.
»Kann ich Sie einen Augenblick sprechen, Agent Cotton?«, fragte sie auf Englisch mit einem leichten spanischen Akzent.
Wir zogen uns aus dem Gewühl an der Rezeption in eine ruhigere Ecke zurück. Dort wandte sie sich mir wieder zu.
»Ich bin Carmen Sanromán«, sagte sie.
Carmen! Wie konnte eine Erscheinung wie dieses Wesen auch anders heißen! Carmen! Sie trug einen schwarzen Rock und eine feuerrote Seidenbluse mit tiefem Ausschnitt. Durch das dünne Gewebe und die Spitzen des schwarzen Büstenhalters schimmerte die helle Haut ihrer vollen Brüste.
Mexiko im Frühling! Was konnte mir Besseres widerfahren! Mein Atem beschleunigte sich. Hingerissen lauschte ich ihrer dunklen, vollen Stimme.
»Ich arbeite für El Septenario





























