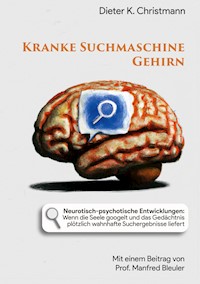Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Enttäuscht über den Film A beautiful mind beschließt Rainer Bölldorff, selbst in der Lebensgeschichte des schizophrenen Mathematikers und Nobelpreisträgers John Nash nach den Ursachen für dessen Wahnerkrankung zu suchen. Die unbekannte, aber verblüffend einleuchtende Schizophrenietheorie, die er in einer alten Diplomarbeit eines Psychologie-Studenten entdeckt hat, soll ihm dabei helfen. Beim Studium der Biografie von Nash entsteht plötzlich für ihn ein ganz anderer Film, der mit den Hollywood-Bildern kaum noch etwas gemein hat. Begeistert von seinen Entdeckungen über die Entstehungsgeschichte einer schizophrenen Erkrankung geht er daran, sie in einem spannenden Hörspiel niederzuschreiben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch
Dieses Buch beruht überwiegend auf den Angaben, die Sylvia Nasar in ihrem Buch “A beautiful mind“ (deutsche Ausgabe: “Genie und Wahnsinn“) über den schizophrenen Mathmatiker und späteren Nobelpreisträger John Forbes Nash, jr. zusammengetragen hat. Es analysiert die Vorgeschichte John F. Nashs, soweit es möglich ist, insbesondere nach den Hintergründen für dessen schizophrene Erkrankung und versucht sie als eine neurotisch-psychotische Entwicklung begreiflich zu machen.
Die Krankheitsgeschichte von John F. Nash ist insbesondere aufgrund ihres positiven Verlaufs (ab den 1990er Jahren) von ganz besonderem Interesse. Gelang es John Nash doch nach zahlreichen Klinikaufenthalten, Rückfällen und einem jahrelangen Wahnzustand sich dennoch von seinem Wahn zu distanzieren und weitestgehend in die Realität wieder zurückzukehren. Die Frage, warum ihm das gelingen konnte soll in diesem Buch ebenso beantwortet werden, wie die grundsätzliche Frage nach dem Ob und dem Wie einer Psychotherapie schizophrener Psychosen.
Über den Autor
Dieter K. Christmann, klinischer Psychologe und Autor des Buches “Schizophrenie - Kranke Suchmaschine Gehirn“ (2023), entwickelte bereits als Student in den 1980er Jahren den Ansatz zu seiner Theorie neurotisch-psychotischer Entwicklungen (Overencoding-Theorie). Sie ergab sich für ihn zwangsläufig aus seinen gedächtnispsychologischen Überlegungen zum Wesen neurotischer Störungen. Im Gedankenaustausch mit dem bekannten Schweizer Psychiater Prof. Manfred Bleuler (1903 - 1994) in den 1980er Jahren traf er auf so große Zustimmung, dass dieser ihn schließlich 1986 in einem internationalen Handbuch der Schizophrenieforschung zitierte und ihm einen Beitrag zur ersten Fassung seines Buches schrieb.
„People are always selling the idea that people with mental illness are suffering. I think madness can be an escape. If things are not so good, you maybe want to imagine something better.“
„In madness, I thought I was the most important person in the world.“
John Forbes Nash, jr.
Inhalt
Die Vorgeschichte
Das Hörspiel
1. Eine ganz normale Krankenhaus-Geburt
2. Ein auffälliger Schüler
3. Ein auffälliger College-Student
4. Ein auffälliger Princeton-Student
5. Der Wehrdienstverweigerer
6. Ein auffälliger Dozent
7. Zwischen Bürgerlichkeit und freier Liebe
8. Der Konflikt eskaliert
9. Der Tod des Vaters und eine feste Bindung
10. Flucht vor der Welt, sich selbst und der atomaren Bedrohung
11. Wer zu spät kommt den bestraft das Seelenleben
12. Ein “Weltbürger“ zwischen zwei Familien
13. Die späte Ehrung
Nachspiel
Literatur
Die Vorgeschichte
Eigentlich wollte ich mit Gabi noch eine zweite Nacht auf dem kleinen Campingplatz in den Vogesen bleiben und erst am Sonntagabend wieder nachhause fahren. Wir hätten mit dem Rad noch den nahe gelegenen Eintausender erklimmen und dann abends in unserem Lieblingsrestaurant am Ort noch was essen können. Doch schon am Samstagmorgen, als wir vor unserem kleinen Wohnmobil frühstückten, wurde das Wetter wieder zusehends ungemütlicher. Für den Nachmittag sollte eine Radler-Gruppe auf dem Platz eintreffen, hatte uns ein Pärchen erzählt, das sich uns als ihre Vorhut zu erkennen gegeben hatte. Aber auch deren Einladung, in der nächsten Nacht mit ihnen loszufahren und den Sonnenaufgang in den Bergen zu erleben, konnte uns nur wenig begeistern. Das freundliche Pärchen, beide perfekt outdoor-tauglich in schwarz-roter nordischer Markenware eingekleidet und mit einem Tandem-Rad samt riesigen Gepäcktaschen angereist, hatte uns zwar zu ihrer Nachttour freundlichst eingeladen. Aber weil uns für eine Nachtfahrt ohnehin die nötigen Fahrradlampen fehlten und unser Herdentrieb beim Gedanken an Fahrradpannen und Massenkarambolagen sich in Grenzen hielt, lehnten wir dankend ab. Angesichts des unsicheren Wetters, das gerechter Weise auch den Intensiv-Radlern drohte, zogen wir es deshalb vor, lieber nach Hause zu fahren. Auf der Fahrt hatte ich immerhin die Idee, als Entschädigung doch ein paar Freunde für den Abend einzuladen - und Gabi gab gerne ihr o.k.
Zuhause angekommen machte ich telefonisch gleich die Runde bei unseren, oder besser gesagt, bei meinen Freunden. Denn es waren überwiegend meine Freunde, die sich samstags bei uns regelmäßig im Zweiwochenabstand einfanden. Wir kannten uns von der Musik oder von gemeinsamen Filmprojekten und waren auch als Menschen untereinander angenehm kompatibel. Was das Künstlerische betraf, waren wir zwar allesamt keine Vollprofis aber dafür umso unkonventioneller und begeisterter von den Resultaten unserer künstlerischen Koproduktionen. Das und die Hoffnung auf das nächste große Projekt, das die Welt auch mal auf uns hätte aufmerksam machen können, hatte uns über die Jahre recht gut zusammengehalten.
Obwohl es nur noch wenige Stunden bis zum Abend waren hatte ich mal wieder Glück. Die Angerufenen waren ebenfalls zuhause, was angesichts des tristen Wetters auch nicht verwunderlich sein konnte. Keiner war im Urlaub oder über das Wochenende weg gefahren und alle waren froh, für den Abend ein wenig Abwechslung zu haben und die anderen mal wieder sehen zu können.
Es waren fast immer die Gleichen, von denen wir an diesen geselligen Samstagabenden “umsingelt“ waren, wie es Gabis Versprecher - zum Glück in Abwesenheit der anderen - einmal auf den Punkt gebracht hatte. Es waren bis auf wenige Ausnahmen durchweg Ü-40-Singles männlichen Geschlechts. Einer hatte eine Zweierbeziehung noch nie so richtig gewagt und schwieg auffallend zu diesem Thema, ohne dass je einer der anderen ihn dazu ins Verhör genommen hätte. Zwei hatten Ehe und Familie mehr oder weniger schon hinter sich und hatten mit wenig erbaulichen Erinnerungen für sich damit abgeschlossen. Manchmal überkam mich deshalb schon ein schlechtes Gewissen wegen meines unverschämten Glücks, die einzige Frau in der Runde stets für mich beanspruchen zu können - auch wenn ich dafür so manche Freiheit, die den anderen ganz selbstverständlich noch oder wieder gegönnt war, hatte aufgeben müssen. Trotzdem blieben doch genügend Gemeinsamkeiten, dass aus dieser mal wieder ungerechten Verteilung in der Welt nicht Neid und Missgunst unter uns aufkommen konnten. Keiner fühlte sich so sehr im Nachteil, dass er zum Ausgleich ein Großmaul hätte sein müssen. Keiner missbrauchte die anderen übermäßig als Zuhörer, weil ihm sonst niemand zuhören wollte oder die Runde ihm nicht wichtig genug gewesen wäre, auch einmal andere zu Wort kommen zu lassen. Die gemeinsamen Erinnerungen waren für alle zu wichtig. Jeder hatte mit jedem schon einmal gemeinsam einen Film gedreht, Musik gemacht, sich an einem Drehbuch oder an irgendeinem anderen Projekt versucht und die Erinnerungen daran wurden an den Samstagabenden gerne von allen auch wieder hervorgeholt. Alle waren mäßige, aber genüssliche Trinker und dankbare Esser, wenn auch einige gesundheitsbewusster und vegetarischer Prinzipien wegen, nicht unkompliziert zu bekochen waren. Ich kochte trotzdem gerne für sie, betrachtete Sonderwünsche mehr als Herausforderung an meine Kreativität und weil ich sowieso für mich und meine Frau am Samstagabend gekocht hätte, machte es auch keinen großen Unterschied ob ich für zwei oder für fünf oder sechs Personen zu kochen hatte.
Auf der Rückfahrt von unserem Vogesendorf hatte ich Rissotto-Reis eingekauft, frische Pilze, Salat, Tomaten und alle Zutaten für ein Dessert. Das sollte, um etwas mehr Sommer in den Abend zu bringen, mal wieder mein "Andalusisches Tiramisu" werden. So hatte ich irgendwann einmal meine Kreation getauft, von der ich der festen Meinung war, dass sie noch kein anderer Großmeister des Kochens vor mir je zubereitet hätte. Dahinter verbargen sich Schichten aus Löffelbiskuits, die ich immer in starkem, gesüßtem Kaffee mit Cointreau tränkte, eine Schicht aus einer süßen Mascarpone-Quark-Creme mit geriebener Orangenschale und Cointreau verfeinert, eine Schicht geschälter und in Cointreau getränkter Orangenscheiben und obenauf eine letzte Creme-Schicht. Auf die legte ich dann immer meine Schablone, die ich mir aus einem dünnen Kunststoff-Tischset einmal ausgeschnitten hatte. Ich bestreute alles mit dunklem Kakao und schon zierte nach dem vorsichtigen Entfernen der Schablone mein “Andalusisches Tiramisu“ eine prächtige mascarpone-weiße Palme.
Ab 19.00 Uhr trudelten die Pünktlichen meiner Freunde ein. Michael, der wie immer noch irgendetwas zu erledigen gehabt hatte und das mangels eines Autos zu Fuß hatte tun müssen, klingelte erst eine halbe Stunde später. Nach dem traditionellen Aperitif, einem dunklen Portwein und einem Pinot des Charentes, kam gleich gute Stimmung auf. Als dann zum Risotto die erste Flasche von dem Hauswein aus dem letzten Südfrankreich-Urlaub getrunken war, kam die Runde noch mehr in Fahrt. Man hörte von Michael erstaunt von einer neuen bezahlbaren Super-HD-Kamera mit 4K-Auflösung. Fragte sich, ob bald das Oktoberfest und andere Großveranstaltungen besser bewacht werden müssten als christliche Hochzeiten in Afghanistan. Und nach etlichen anderen Themen gab es Planungen für eine gemeinsame Wochenend-Tour. Die Tischgesellschaft wurde nochmals in gesteigerte Vorfreude versetzt, als ich mein "andalusisches Tiramisu" ankündigte und es kühl und gut durchgezogen in seiner großen gläsernen Auflaufform schließlich auf den Tisch brachte. Die freudigen Erwartungen süßhungriger Männer und der einzigen Frau wurden derart erfüllt, dass sich am Ende nur noch ein kleiner Anstandsrest des Desserts in der Schüssel verlor.
Umso zufriedener gingen wir zum traditionellen cineastischen Teil des Abends über. Ich hatte schon bei meiner Einladung am Telefon angekündigt, dass ich diesmal, gegen alle Gewohnheit, "despotisch" im Alleingang über die Filmauswähl bestimmen wollte. Des Themas wegen, das mich seit jenem Tag interessierte, der unser Leben verändert hatte. Damals war der religiöse Wahn eines Menschen in unser Leben getreten und ich hatte ihn nicht begreifen können. Niemand konnte oder wollte mir sagen, warum es geschehen war. Ich wollte wissen, was einen Menschen dazu gebracht hatte, ein Messer in den Leib einer wehrlosen Frau zu rammen, die unsere Tochter gewesen war. Doch mehr will ich dazu nicht sagen! Die Wunde ist noch immer zu tief, um darin zu rühren - schon gar nicht der Neugier anderer willen. Nur so viel noch: Zu meinem Glück hatte ich Wochen zuvor eine Diplomarbeit gefunden - oder sie hatte mich gefunden. Jedenfalls lag sie da unter dem Strauch - nach einem Bombenanschlag auf das Psychologische Institut in unserer Stadt! Sie war von der Gewalt der Explosion dorthin geschleudert worden. Ich hatte ihren Titel erkennen können und der fand sofort mein Interesse: “Schizophrenie - Irrwege der Neurose“ stand auf ihrem Deckblatt und ich nahm sie kurzentschlossen an mich. Später las ich sie - besser: ich studierte sie. So sehr fesselte mich ihr Thema, der Wahn, seine Entstehung und seine Heilung. Und mit Wahn musste es ja etwas zu tun gehabt haben, wenn ein Mensch einen anderen tötete, weil er ihn für einen “Ungläubigen“ hielt.
Ein Student, ein Thomas Radmann, hatte in dieser Diplomarbeit eine für mich verblüffend einfache, aber durchaus plausible Theorie des Wahnsinns entwickelt. Es war seine eigene Theorie und am Ende meiner Lektüre konnte ich nicht anders, als zu ihrem Anhänger zu werden. Ich muss dazu sagen, dass die Psychologie für mich bis dahin keineswegs eine unbekannte Wissenschaft gewesen war. Hatte ich sie doch ein wenig studiert und ihr Durcheinander sich bekriegender Theorien immerhin vier Semester lang ausgehalten. Bis es mir zu viel geworden war und ich mit Gabi ein Leben ohne Psychologie, aber dafür schon bald mit einer süßen kleinen Tochter, begonnen hatte. Das Durcheinander hatte ein Ende und von da an galt mein Interesse nur noch meinen Musikproduktionen und statt der theoretischen nur noch der angewandten Psychologie. Ich hatte mir nämlich einen der ersten leistungsfähigen DTP-Computer angeschafft und kurzerhand eine 1-Mann Werbeagentur “gegründet“ - für hoffentlich nützliche und möglichst unschädliche Waren und Dienstleistungen. In der Werbung ging es um Botschaften der Worte und der Bilder und die wählte ich zum Gefallen meiner Kunden intuitiv offenbar so treffend aus, dass ich damit unsere Brötchen und Annas Babynahrung verdienen konnte - auch ohne mir zuvor den Kopf über die einzig wahre psychologische Theorie zerbrochen zu haben.
Und dann zwang mich das Schicksal doch, wieder zum Studenten zu werden. Nur diesmal war es einfacher. Mein einziges Lehrbuch, die Diplomarbeit dieses Studenten mutete mir wenigstens nur eine psychologische Theorie zu. Sie sollte mir das Wesen der Neurosen und ihre Ursachen erklären und behauptete, erst wenn ich die Neurosen verstanden hätte, könnte ich auch den Wahn eines Schizophrenen verstehen. Ja, das Wesen der Neurosen wirklich begriffen zu haben, sei die Voraussetzung dafür, auch die Schizophrenie zu verstehen und das sei eben der Grund, warum die Schizophrenie den Fachleuten so viele Rätsel aufgäbe: Sie blickten halt nicht einmal bei den Neurosen durch und das läge wiederum daran, dass es ihnen auch an eine wirklich brauchbare allgemeine psychologischen Theorie fehle. Und all diese Missstände wollte Thomas Radmann auf seinen 180 Seiten Diplomarbeit aus der Welt schaffen! Eigentlich wirkte das selbst ein wenig wahnsinnig - größenwahnsinnig. Denn wenn ich etwas in meinen vier Semestern Psychologie gelernt hatte, dann das: Kein Student durfte sich erdreisten, in seiner Diplomarbeit seinem Professor eine eigene psychologische Hypothese oder gar eine eigene Theorie zu präsentieren! Wo kämen wir da hin, wo der doch selbst noch auf der Suche nach eigenen brauchbaren Hypothesen war, die ihm endlich den erträumten akademischen Ruhm einbringen sollten! Radmann schien das aber nicht interessiert zu haben. Ob es Naivität, unheilbare Arglosigkeit gewesen war, grenzenloses Selbstvertrauen oder die blinde Begeisterung des Wissenden? Ich wusste es nicht. Als sei ihm das alles egal, tischte er jedenfalls in seiner Diplomarbeit als erstes eine eigene Einstellungstheorie auf - so nannte er seinen Ansatz einer allgemeinen Psychologie zum Denken, Fühlen und Handeln. Immerhin kam sie mit den einfachsten Begriffen aus. Das Besondere war lediglich, dass Radmann alltägliche psychologische Begriffe zu Ende gedacht hatte, ihnen einen präzisen Inhalt gab und sie sehr logisch zu einer Gesamttheorie aufeinander bezog. Hätte Radmann seine Psychologie 10-jährigen Grundschülern in einem Fach “Menschenkunde“ verständlich machen müssen, hätte er wohl keine besonderen Probleme gehabt. Nach dem, was ich seinen Ausführungen entnehmen konnte, hätte Radmann den Kindern wohl zuerst die vielen Funktionen des Gedächtnisses näher gebracht. Vielleicht hätte er den Kindern von einem Jungen erzählt, der von seiner Mutter den Auftrag erhalten hatte, beim Bäcker Brot und Kuchen einzukaufen und dank seines Gedächtnisses auch im Geschäft noch wusste, was ihm aufgetragen worden war.
Das wäre aber längst noch nicht alles gewesen. Radmann hätte noch einiges mehr über das Gedächtnis zu erzählen gehabt. Stand der Junge nämlich im Laden, wären ihm wegen seines Auftrags, Brot und Kuchen zu kaufen, ganz sicher auch gleich die Brote und der Kuchen in der Auslage aufgefallen - seine Aufmerksamkeit war für die Wahrnehmung von Brot und Kuchen erhöht worden, weil die Mutter durch ihren Auftrag in seinem Gedächtnis entsprechende Bilder aktiviert hatte, die für Radmann in Einstellungsstrukturen im Gedächtnis verewigt waren - oder besser: fast verewigt waren, denn es gab ja auch noch das Vergessen von gespeicherten Erfahrungen.
Hätte der Junge auf dem Weg zur Bäckerei schon an den Kuchen gedacht gehabt, den er kaufen sollte, hätten seine Gedanken auch bereits Gefühle in ihm auslösen können. Nach Radmann hätte er also erfahren können, dass die Gefühle eines Menschen davon abhingen, womit sein Gedächtnis in Gedanken gerade beschäftigt war. Die Gedanken an die Leckereien mussten ihm nicht einmal bewusst geworden sein und dennoch konnte der Junge auf dem Weg zum Bäcker Vorfreude empfunden haben. Er konnte vielleicht sogar spüren, dass sein Herz höher schlug und anderes in seinem Körper vor sich ging, sobald er an all die leckeren Dinge dachte, die ihn erwarteten. Diese Reaktionen des Körpers wurden also nach Radmanns Psychologie psychovegetativ, also nach dem Prinzip, das die Mediziner Psychosomatik nennen, durch bewusste oder unbewusste Gedächtnisaktivitäten ausgelöst und von dem Jungen bewusst wiederum als Gefühl erlebt. Radmann hatte das in seinem Psychologen-Deutsch so formuliert:
„Die Gedächtnisstrukturen in der Hirnrinde sind verknüpft mit Funktionszentren subkortikaler Strukturen des Hirnstamms, über die bestimmte vegetative Reaktionsmuster des Organismus ausgelöst werden können. Diese unterschiedlichen, komplexen neurohumoralen Organismusreaktionen sind die körperliche Grundlage des Empfindens von Freude, Angst, Wut, Trauer und sexueller Erregung. Sie haben sich im Laufe der Evolution als überlebenswichtige Reaktionsmuster herausgebildet. Sie machen den Körper bereit, sich angenehmen Dingen zu nähern, bei Gefahr vorsichtig zu sein oder sich gar tot zu stellen, einen Angreifer wütend zu attackieren, um ihn und seine frustrierenden Einfluss zu eliminieren oder auf sexuelle Schlüsselreize mit angenehmer sexueller Erregung und Paarungsverhalten zu reagieren. Nur so hat der Einzelne dank seines seelischen Funktionierens überleben und durch seinen Affektausdruck Informationen über die Welt auch seinen Artgenossen überlebenswichtig mitteilen können.“
Ob Freude, Ärger, Enttäuschung, Angst oder sexuelle Gefühle - für Radmann waren sie alle nur unterschiedliche komplexe körperliche Zustände, die im Bewusstsein zum Erlebnis eines Gefühls wurden. Diese Auffassung vom Wesen der Gefühle war mir nicht unbekannt. Als “James-Lange-Theorie" hatte ich von ihr in meinen vier Psychologie-Semestern schon einmal gehört. Sie schien mir auch damals schon recht einleuchtend. Man brauchte sich doch nur die Sprüche zu vergegenwärtigen, mit denen der Volksmund Gefühle beschrieb. Warum sonst sagten die Leute: „Das schlägt mir auf den Magen.“ „Es verschlug mir den Atem.“ „Das ist doch alles zum Kotzen!“ „Er hat wohl weiche Knie bekommen.“ „Der macht sich doch in die Hosen.“ „Ich hab' so einen Hals!“ oder „Ich hab die Schnauze voll!“. Ein ganzer Katalog von Gefühlen wurde mit bestimmten körperlichen Zuständen identifiziert. Auch das Primat des Denkens, das das Fühlen bestimmte, war mir bereits eine vertraute Annahme. “Kognitive Psychologie“ und die “Rational-Emotive-Therapie“ fielen mir dazu dunkel aus meiner Studentenzeit wieder ein.
Das war aber immer noch nicht alles zur Bedeutung des menschlichen Gedächtnisses. Seine wichtigste Funktion kam ja noch! Für Radmann entschied das Gedächtnis letztlich darüber, wie ein Mensch über sich und die Welt dachte. So bestimmte auch der Einkaufswunsch der Mutter, im Gedächtnis des Jungen gespeichert, das Denken des Jungen. Brot und Kuchen waren ihm durch die Mutter als “kaufenswert“ vermittelt worden und das motivierte ihn, den Weg zum Bäcker zu gehen. Der Junge hatte durch den Wunsch der Mutter, so würde Radmann es in seiner Einstellungspsychologie formuliert haben, eine Einstellung zu Brot und Kuchen im Gedächtnis gebildet. Brot und Kuchen waren für den Jungen damit zu Einstellungsobjekten geworden, die mit den Einstellungsinhalten “kaufenswert, schmecken gut, werden von Mutter gewünscht“ usw. im Gedächtnis verknüpft worden waren. Für Radmann bestimmten unzählige dieser bewertenden Einstellungen die Persönlichkeit eines Menschen, seine Wünsche, seine Vorlieben aber auch seine Abneigungen, Antipathien und Befürchtungen. Sie wurden von Kindheit an im Gedächtnis gespeichert und ließen die Vergangenheit eines Menschen in jedem Augenblick seines Daseins wieder aufleben. In jeder Situation holte der Mensch unzählige vergangene Erfahrungen in Einstellungen bewusst oder unbewusst aus dem Gedächtnis wieder hervor, um sie für die Bewältigung der Gegenwart zu nutzen - oder manchmal leider auch an der Realität zu scheitern.
Blieb nur noch, den Schülern das Verhalten des Jungen psychologisch verständlich zu machen. Um zum Bäcker zu gelangen, musste der Junge natürlich durch Versuch und Irrtum, Vorbilder usw. zuerst einmal gehen gelernt haben und entsprechende Verhaltensprogramme im Gedächtnis gespeichert haben. Auch das waren für Radmann wieder Einstellungen im Gedächtnis - diesmal Verhaltenseinstellungen bestehend aus bestimmten Situationen (Einstellungsobjekt) und dem passenden Verhaltensmuster (Einstellungsinhalt). Allerdings hätte das für den Gang zum Bäcker noch nicht genügt. Der Junge musste für Radmann auch durch seine Gefühle körperlich motiviert sein, dorthin zu gehen. Sein Körper musste mit dem Gehen zum Bäcker ein angenehmes Gefühl verbinden können. Das musste ihn für eine entsprechende körperliche Aktivität auch bereit machen (motivieren) und andere Gedanken durften ihn nicht gleichzeitig ängstlich, enttäuscht oder frustriert davon abhalten. Das Lob der Mutter, die wohlschmeckenden Leckereien, die Freude am Gehen, die Vermeidung negativer Folgen bei Ungehorsam usw. - die aktivierten den Jungen durch angenehme Gefühle und ließen ihn Verhaltenseinstellungen auch mit Energie in die Tat umsetzen.
Das war schon fast die ganze Allgemeine Psychologie Radmanns. Seine Annahmen sollten sich, wie er schrieb, “sparsam“ auf möglichst wenige “seelische Funktionseinheiten“ beschränken, die jedem sofort einleuchten konnten. Ihre Auswirkungen sollte jeder beobachten können und man sollte wenigstens vermuten können, mit welchem Teil des menschlichen Nervensystems sie etwas zu tun haben konnten. Und noch etwas war für ihn wichtig: Jedes seelische Funktionieren sollte den Menschen zugleich überlebensfähig machen und seinem Wohle dienen. Für Radmann konnte es deshalb nur ein Seelenleben geben, das flexibel auf unterschiedliche Anforderungen im Leben eines Menschen reagieren konnte. Sonst hätte die Evolution auch den Menschen wie die Dinosaurier als nicht überlebensfähig aussortiert. Also konnte der Mensch konnte für Radmann nur ein möglichst lernfähiges Wesen sein! Er musste seine persönlichen Einstellungen