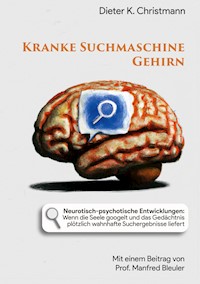
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das grundlegende Werk zu einem neuen psychologischen Verständnis schizophrener Störungen: Eine erstmals gedächtnispsychologisch fundierte kognitive Neurosenlehre führt zur Erkenntnis neurotisch-psychotischer Entwicklungen als Folge einer Überspeicherung (Overencoding) irrationaler neurotischer Einstellungsstrukturen im Gedächtnis. Sie dominieren in der Folge einseitig Suchprozesse im Gedächtnis und provozieren extrem irrationale (wahnhafte) Verarbeitungsfehler und weitere überneurotische Veränderungen im Denken, Fühlen und Handeln des Schizophrenen. Ein Vergleich mit der störbaren künstlichen Intelligenz einer Internetsuchmaschine dient der Veranschaulichung gedächtnispsychologischer Zusammenhänge. Eine auf der Overencoding-Theorie aufbauende vierstufige Psychotherapie schizophrener Störungen wird in Abgrenzung zu einer konventionellen Neurosetherapie dargestellt und in einem Beitrag von Prof. Dr. med. Manfred Bleuler diskutiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch und seinen Autor...
Dieses Buch nähert sich mit einem neuen gedächtnispsychologischen Verständnis neurotischer Störungen den Ursachen, Symptomen und der Psychotherapie schizophrener Psychosen. Das tat es auch schon vor fast 4 Jahrzehnten nachdem sein Autor, damals noch Psychologie-Student, erstmals versucht hatte, sein kognitionspsychologisches Verständnis der Neurosen auf die für ihn rätselhaften Erfahrungen zu übertragen, die er als Praktikant auf der geschlossenen Station einer psychiatrischen Klinik hatte machen müssen. Zu seiner Überraschung hatte er dabei nicht nur neurotische Vorgeschichten im Lebenslauf Schizophrener erkannt, sondern auch frappierende symptomatische Überschneidungen zwischen den gemeinhin als wesensungleich geltenden Neurosen und schizophrenen Psychosen. So begann er noch während seines Praktikums seine Entdeckungen niederzuschreiben. Doch leider sollte die daraus entstandene erste Fassung dieses Buches unveröffentlicht bleiben. Dabei war es kein Geringerer als der international bekannte, inzwischen verstorbene Schweizer Psychiater und Sohn Eugen BLEULERS, Manfred BLEULER, der das Buch in seiner Urfassung bereits vor seiner Veröffentlichung der internationalen Fachwelt vorstellte. Er tat dies, nach einem regen brieflichen Ideenaustausch mit dem Autor, in seinem einführenden Beitrag zu einem Handbuch der Schizophrenieforschung, in dem er zu seiner eigenen Dysharmonie-Theorie feststellte:
„Dieses ‘Dysharmonie-Konzept’ schizophrener Psychosen ist bei der Betrachtung unseres vielfältigen Wissens so offensichtlich, dass mehrere Kliniker und Forscher zu ähnlichen Konzepten gelangt sind, selbst wenn ihre Studien von unterschiedlichen Standpunkten aus begonnen haben. Besonders wichtig sind die Konzepte von ZUBIN, der der Anfälligkeit für schizophrene Psychosen deren Ausbruch gegenüberstellt, und von CIOMPI, der den akuten Episoden die chronische Entwicklung gegenüberstellt. Aus biologischer und genetischer Sicht sind KETY und GOTTESMAN, aus analytischer Sicht BENEDETTI und SCHARFETTER und aus kognitionspsychologischer Sicht CHRISTMANN zu ähnlichen Konzepten gelangt.“ („Introduction and overview“ in “Handbook of Studies on Schizophrenia“, BURROWS ET AL. 1986, Übersetzung des engl. Originaltextes*)
*“This ‘disharmony concept‘ of schizophrenic psychoses is so evident when surveying our manifold knowledge that several clinicians and researchers have arrived at similar concepts even when their studies have started from different points of view. Particularly important are the concepts of ZUBIN who contrasts the vulnerability to schizophrenic psychosis with their outbreak, and of CIOMPI who opposes the chronic development to the acute episodes. From a biological and genetic point of view, KETY and GOTTESMAN, from the analytical point of view BENEDETTI and SCHARFETTER and from the point of view of cognitive psychology CHRISTMANN have arrived at similar concepts.“
Doch damit noch nicht genug: Aus der Sicht eines psychologisch nach allen Seiten hin offenen Schizophrenieforschers mit jahrzehntelanger Berufserfahrung schrieb Manfred BLEULER zudem eigens für die erste Fassung des nun vorliegenden Buches auch einen Beitrag, in dem er die Kernaussagen der darin präsentierten Overencoding-Theorie neurotisch-psychotischer Entwicklungen mit denen seiner Dysharmonie-Theorie vergleicht und zu dem Ergebnis kommt, dass diese sich in keinen Belangen widersprechen.
Dennoch sollte es nicht zu einer Veröffentlichung dieses Buches kommen. Sein Autor und Noch-Student hatte zu allererst eine zweite Diplomarbeit zu schreiben, weil seine erste (“Irrationalität und Wahn“) von dem Zweitprüfer, frustriert über ihre Unvereinbarkeit mit psychoanalytischen Grundannahmen, als “mangelhaft“ abgelehnt worden war. Während der Psychologie-Professor das fachliche Urteil Manfred BLEULERS als “Freundlichkeit“ abtat und später zu dessen Zitat in einem internationalen Handbuch nur meinte: „Ich will mich dazu nicht äußern und will mich auch dazu nicht äußern, warum ich mich dazu nicht äußern möchte!“ brachten die Verzögerung des Diplomabschlusses und der damit verbundene materielle Existenzkampf den Autor dazu, sich von der Schizophrenieforschung abzuwenden und nach erfolgreicher zweiter Diplomarbeit sich anderweitig beruflich zu orientieren.
Aber immerhin: So bekam dieses Buch viel Zeit, weiter zu reifen. Denn je mehr für seinen Autor die Gewissheit wuchs, von einem elitären, autoritären und von persönlicher Engstirnigkeit bestimmten akademischen Betrieb nie mehr abhängig sein zu müssen, kehrte er zu seinem Thema zurück. Durch weitere klinische Forschungsergebnisse und Ergebnisse aus anderen Wissenschaftsbereichen, wie Befunden zur neuronalen Plastizität des Gehirns nach Lernerfahrungen (vgl. NIERHAUS, 2019) und aus dem weiten Forschungsfeld künstlicher Intelligenz (vgl. SCHMIDT-SCHAUß & SABEL, 2016), wurden die Kernthesen einer Overencoding-Theorie noch weiter gestützt und immer ausdifferenzierter.
Aber auch die Form des Buches begann sich zu wandeln. Sein Inhalt wurde nach und nach so umformuliert, dass er auch für eine nicht-akademische Leserschaft, für alle psychiatrischen Helferberufe und die Angehörigen Schizophrener verständlich und damit hilfreich sein konnte 7.127.13). Immer wieder suchte der Autor nach neuen Wegen, die zentrale Botschaft einer kognitiven Psychologie neurotisch-psychotischer Entwicklungen noch anschaulicher zu verdeutlichen.
Insbesondere mit neueren Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz von Internet-Suchmaschinen tat sich so auch ein weiteres allgemein verständliches Gebiet auf, das geeignet war, seelische Zusammenhänge kognitiv-emotionaler Informationsverarbeitung zu verdeutlichen. Überschneiden sich doch die seelische Informationsverarbeitung des Menschen und die einer Internet-Suchmaschine nicht nur in ihrer Zielsetzung, durch Wissen nützlich zu sein für die individuelle Lebensbewältigung und subjektives Lebensglück. Sie ähneln sich auch in ihren Methoden, dies zu erreichen:
Informationen seelisch auf unterschiedlichsten Sinneskanälen entsprechend ihrer Relevanz selektiv wahrzunehmen und zu speichern, um sie später situativ für eine Realitätsbewertung sowie den Abruf und die emotionale Motivierung von Verhalten wieder nutzen zu können.
So wurde dieses Buch in seiner aktuellen Fassung zugleich zu einem aufregenden Abenteuer mit etlichen Ungewissheiten. Nicht, weil es Zweifel an seinen Zielen und eigentlichen Kernaussagen gegeben hätte. Die waren seit seinen Anfängen in den 1980er Jahren klar umrissen:
Eine kognitive Psychologie menschlicher Denkfehler bis hin zu ihren neurotischen und wahnhaften Ausprägungen sollte entworfen werden. Eine, die insbesondere die nicht zu leugnende Existenz einer menschlichen Datenbank, des Gedächtnisses und seine Bedeutung für eine seelische Informationsverarbeitung berücksichtigen sollte.
Das Wagnis dieses Buches liegt vielmehr darin, dass es das Informationsreservoir des Internets einmal mit dem menschlichen Gedächtnis, diesem unermesslichen Datenbestand aus der Biografie eines Menschen, vergleicht. Bewusst oder unbewusst wird auch in ihm permanent nach Informationen gesucht, die je nach Suchergebnis über die Rationalität oder Irrationalität individuellen Denkens, Fühlens und Handelns entscheiden.
Ob dieser Vergleich auch das psychologische Verständnis neurotisch-psychotischer Entwicklungen erleichtert, mag nun die Leserschaft dieses Buches selbst beurteilen.
D.K.C. im Februar 2023
Bedeutung der verwendeten Piktogramme
neuronale Grundlagen seelischer ProzesseAbschnitt besonders interessant für Angehörige / PartnerInnen von schizophrenen MitmenschenFallgeschichten / klinische BeobachtungenPsychotherapeutisch relevante FaktenInhalt
Vorwort
1. 100 Jahre Psychiatrie-Geschichte
2. Wenn Computer schizophren werden könnten
3. Unser Gedächtnis Schaltzentrale des Denkens, Fühlens und Handeln
4. Irrationales Denken, Fühlen und Handeln in der Neurose
5. Ursachen neurotisch-psychotischer Entwicklungen
5.1 Überneurotisch häufige Erlebnisbelastungen
5.2 Neurotische Einstellungskonflikte
5.3 Extreme Erlebniskonfrontationen
5.4 Grüblerisch memorierende Gedankenaktivitäten
5.5 Einstellungsdefizite
5.6 Irrationale Indoktrinationen
6. Zur Symptomatologie schizophrener Störungen
6.1 Veränderungen im Inhalt u. in der Bewusstheit schizophrenen Denkens
6.2 Zur Emotionalität schizophrener Störungen
6.3 Zur Verhaltenssymptomatik schizophrener Störungen
6.4 Zur Aufmerksamkeitssymptomatik schizophrener Störungen
7. Die Psychotherapie schizophrener Störungen
7.1 Die unbekannte Seelenverwandtschaft von Neurose und schizophrener Psychose
7.2 Die psychiatrische Pathologisierung der neurotischen Vorgeschichte Schizophrener
7.3 Die medikamentöse Schizophrenietherapie: eine halbe Sache halbherzig umgesetzt
7.4 Klassische medizinische Behandlungsmethoden: Nur zufällig Psychotherapie
7.5 Die Psychologie schizophrener Störungen: von allen ungeliebt
7.6 Overencodingtheoretische Grundlagen einer Psychotherapie schizophrener Psychosen
7.7 Neurose- vs. Schizophrenietherapie: Fundamentale Unterschiede aus overencoding-theoretischer Sicht
7.8
Stufe 1
einer Psychotherapie schizophrener Psychosen: Die wahnsuppressive Therapiestufe
7.9
Stufe 2
einer Psychotherapie schizophrener Psychosen: Die reizkontrollierte Therapiestufe
7.10
Stufe 3
einer Psychotherapie schizophrener Psychosen: Die einstellungszentrierte Therapiestufe
7.11
Stufe 4
einer Psychotherapie schizophrener Psychosen: Die rehabilitative Therapiestufe
7.12 Die Mitarbeit der Angehörigen in der Psychotherapie schizophrener Störungen: Chancen und Grenzen
7.13 Ein Leitfaden für Familienangehörige, PartnerInnen, Freunde und Freundinnen schizophrener Mitmenschen
8. Zur Prävention neurotisch-psychotischer Entwicklungen:
8.1. Präventive Gesundheitspolitik
8.2 Präventive Bildungspolitik
8.3 Präventive Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik
8.4 Präventive Familienpolitik
9. Beiträge zu einer Psychotherapie neurotisch-psychotischer Entwicklungen
9.1 Manfred Bleuler: Overencoding-Theorie von Christmann und Dysharmonie-Theorie von M. Bleuler
Literatur / Web-links
Sachwortverzeichnis
Vorwort
Seit EUGEN BLEULER 1911 in seinem Handbuch der Psychiatrie den Begriff “Schizophrenie“ in die Welt setzte sind ganze Bibliotheken über diese rätselhafte seelische Störung gefüllt worden. Und trotzdem ist sie ein Rätsel geblieben! Warum also schon wieder ein Buch darüber? Woher nehmen wir den Optimismus oder gar den “Größenwahn“, wir könnten nicht, wie all die anderen, an den vielen offenen Fragen zur Entstehung, zu den Symptomen und zur Therapie schizophrener Störungen scheitern?
Die Antwort ist, wir haben eine Vermutung, warum die vielen Wissenschaftler in der Vergangenheit scheitern mussten! Könnte es nicht sein, dass die Schizophrenie im Kern nur zu verstehen ist, wenn man zuvor die Neurosen verstanden hat? Denn es wäre ja immerhin möglich, dass das eine, schizophrene Erkrankungen, aus dem anderen, den Neurosen, hervorgeht. Dann wäre es in der Tat nicht verwunderlich, dass Wissenschaftler, die noch nicht einmal die Neurosen verstanden haben, auch an der noch komplexeren Erscheinungswelt schizophrener Wesensveränderungen beim Menschen scheitern müssen!
Wir haben aber noch eine weitere Vermutung, die uns antreibt: Wir vermuten nämlich nicht nur, dass den vielen Schizophrenieforschern bisher ein psychologisches Verständnis der Neurosen gefehlt hat und noch immer fehlt, sondern es auch einen einfachen Grund hat, warum sie bereits mit dem Verständnis der Neurosen ihre Probleme hatten und haben. Es ist die ziemliche Konfusion und das wissenschaftliche Unvermögen, selbst das gesunde Denken, Fühlen und Handeln des Menschen widerspruchsfrei und umfassend theoretisch zu erklären und brauchbare Vorhersagen darüber zu machen! Wie kann es da verwundern, dass sie daraus bisher auch kein Verständnis für das neurotische Denken, Fühlen und Handeln beim Menschen ableiten konnten?
Mit diesen Annahmen sind auch schon unsere Etappen auf dem Weg zu einem umfassenden Verständnis schizophrener Störungen vorgezeichnet:
Unser Konzept neurotisch-psychotischer Einstellungsentwicklungen widerspricht natürlich der bisherigen Konvention der strikten Trennung von Neurose und Psychose. Schließlich hat bisher noch fast jeder Psychologe und Psychiater gelernt, dass seelische Störungen entweder neurotisch oder psychotisch sind und beide Störungsklassen nichts miteinander zu tun haben - als würden sie völlig unterschiedliche Symptome zeigen und deshalb auch unterschiedliche Ursachen haben müssen. Dieser Trugschluss ist darauf zurückzuführen, dass Mediziner sich leider noch weniger mit Neurosen beschäftigen als mit schizophrenen Psychosen. Psychologen sind wiederum selten genötigt, ihre ohnehin widersprüchlichen Vorstellungen von den Neurosen auf die Phänomene schizophrener Störungen anwenden zu müssen. Aber beide Berufsgruppen müssten eigentlich nur einmal die Vorgeschichte Schizophrener mit denen von Neurotikern vergleichen, um erkennen zu können,
Stattdessen aber überlässt die Psychologie derzeit noch die schizophrenen und depressiven Psychosen, bei denen sie allein mit ihren neurosetherapeutischen Methoden wenig ausrichten kann, der medizinischen Psychiatrie. Dort kommen dann “evidenzbasiert“ mit bescheidenem Erfolg und unangenehmen Nebenwirkungen Neuroleptika zum Einsatz, von denen bis heute niemand sagen kann, warum und wie sie eine begrenzte Wirkung auf die Wahnüberzeugtheit von Schizophrenen haben und ob sie nicht vielleicht eine noch viel bessere und sogar nachhaltige Wirkung haben könnten, wenn sie, wie wir noch darstellen werden, in Kombination mit einer anschließenden Sozial- und Psychotherapie angewandt würden.
1100 Jahre Psychiatrie-Geschichte
Kurzer Rückblick auf 100 Jahre Psychologie-Versagen und medizinisches Wunschdenken
Zusammenfassung:
Das derzeit vorherrschende psychiatrische Schizophrenieverständnis ist geprägt durch mangelhafte psychologische Grundlagen und die Dominanz biologistischer Annahmen. Dass heute die neurotische Vorgeschichte und die überneurotische Symptomatik Schizophrener unerkannt bleibt, geht auf 100 Jahre Versagen der klinischen Psychologie zurück und auf ein biologistisches Wunschdenken der Psychiatrie, mit der diese sich bis heute als medizinische Teildisziplin zu profilieren sucht.
Wenn wir auf die wenig erfreuliche Geschichte der Schizophrenieforschung zurückblicken wollen, dann tun wir das nicht, um uns schadenfroh an ihrem Scheitern zu ergötzen, sondern um aus ihr zu lernen. Dabei haben wir den Vorteil, dass wir aus der Sicht unserer eigenen wissenschaftlichen Erkenntnisse auf die Forschungsgeschichte zurückblicken können und wir schnell erahnen, warum die gängigen Antworten der Psychiatrie auf das “Rätsel der Schizophrenie“ (vgl. z.B. HÄFNER 2016) heute nicht revolutionär anders ausfallen also vor 100 Jahren zu Lebzeiten Eugen BLEULERS (vgl. E. BLEULER, 1911)
Das erste Übel, das uns in der Geschichte der Schizophrenieforschung immer wieder begegnet, ist ihre Weigerung, eine Allgemeinpsychologie menschlichen Seelenlebens auch auf das Seelenleben Schizophrener anzuwenden. Wir treffen in der Geschichte der Schizophrenieforschung immer wieder auf die Dominanz “medizinischer Hardware-Spezialisten“, die die Ursache schizophrener Erkrankungen unbedingt in “organischen Hardwarefehlern“ finden wollten (z.B. in genetischen Defekten der Hirnsubstanz oder der Hirnchemie) und sich erst gar nicht mit einer Allgemeinpsychologie befassen wollten. Ob aus Prestige trächtigem Standesdenken oder aus der Not, als Mediziner ohnehin nicht für die Beschäftigung mit psychologischen Krankheitszusammenhängen ausgebildet worden zu sein, sollte der Schizophrene nur ein “defekter Organismus“ sein, der durch Pillen, Apparaturen und Behandlungen reparierbar sein sollte.
So müssen wir von dunklen Zeiten berichten, in denen Schizophrenen kurzerhand alle Zähne gezogen wurden, weil medizinische Theorien genereller Infektionen dies nahelegten. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden, angetrieben von Theorien einer Selbstvergiftung des Organismus, Einläufe angewandt und mitunter sogar Darmresektionen an Schizophrenen vorgenommen (vgl. KLERMAN, 1978). Andere “Theorien“ angeblicher körperlicher Ursachen endeten für Schizophrene gar in Kastration oder Sterilisation - von den dunkelsten Zeiten der Ermordung Schizophrener ab den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ganz zu schweigen, als man in Schizophrenen wegen ihrer angeblichen “genetischen Belastung“ nur noch eine “Gefahr für die Volksgesundheit“ sah (vgl. BRÜCKNER, 2014).
Schon als Ende des 19. Jahrhunderts die Hirnforschung an Bedeutung gewonnen hatte, kursierte unter Medizinern die Vorstellung, oder besser: die Wunschvorstellung, auch alle seelischen Störungen, insbesondere jene der “Verrückten“, seien nichts anderes als unterschiedliche Hirnerkrankungen. Ihre einzige Aufgabe sahen Psychiater deshalb seit EMIL KRAEPELIN (1856 - 1926) nur noch darin, die angeblichen Hirnerkrankungen “gestörten Hirnarealen“ oder “biochemischen Hirnstoffwechselerkrankungen“ zuzuordnen und nach oberflächlichen symptomatologischen Ähnlichkeiten zu sortieren.
Den ersten Kategorisierungsversuch nach diesem Muster unternahm EMIL KRAEPELIN (KRAEPELIN, 1899) mit seinem Versuch, die nach seiner Meinung in frühzeitiger Demenz endenden Schizophrenien (“dementia praecox“, KRAEPELIN, 1899) von „gutartigen“ “schizo-affektiven“ Psychosen mit überwiegend emotionaler Symptomatik abzugrenzen. Am Ende musste sich KRAEPELIN jedoch eingestehen, dass sein oberflächliches Kategoriensystem nicht genügte, um die unüberschaubare Vielfalt schizophrener Symptomatik darin einzuordnen. Schließlich räumte er sogar ein, dass auch die Persönlichkeit eines Erkrankten, seine (in unseren Augen überneurotische) Lebensgeschichte, seine nicht zu übersehende materielle und soziale Lebenssituation immerhin “pathoplastisch“ sein könnten: Sie sollten also immerhin das Erscheinungsbild einer schizophrenen Erkrankung “formen“ können, durften aber unter der Herrschaft der medizinischen Hirnforschung und mangels einer brauchbaren psychologischen Schizophrenietheorie weiterhin nicht ursächlich sein.
Der nächste in der Schizophrenieforschung international bekannt gewordene Psychiater war EUGEN BLEULER, der 1911 den Schizophreniebegriff “erfand“ als er erstmals von einer “Gruppe der Schizophrenien“ sprach (E. BLEULER, 1911). Noch stärker als KRAEPELIN beschäftigte er sich mit den angeblich “krankheitsformenden“ (aber nicht verursachenden) Faktoren schizophrener Erkrankungen und griff dazu auch auf theoretische Überlegungen der damals aufkommenden und bis in die 1970er Jahre in der Psychiatrie dominierenden Psychoanalyse SIGMUND FREUDS zurück (vgl. FREUD & BLEULER, 2012). Dass diese Entscheidung die Forschungsarbeit in eine psychologische Sackgasse führen musste, bringt uns zu dem zweiten Übel in der Forschungsgeschichte der Schizophrenie: Die Unfähigkeit von Psychologie und Medizin eine brauchbare Allgemeinpsychologie zu entwickeln, von der aus auch schizophrene Störungen in ihrem Wesen erfasst werden konnten. Leider war aber gerade FREUD in seinem Bemühen, seine medizinische Qualifikation durch eine ebenso medizinisch-biologistische Allgemeinpsychologie unter Beweis zu stellen, ein Beispiel unfruchtbarer Theorieentwürfe. Ihre Nützlichkeit für die Schizophrenieforschung konnte von Anfang an nur sehr begrenzt sein, weil sie gleich zwei wesentlichen theoretischen Anforderungen an eine psychologische Theoriebildung keine Beachtung schenkte:
Leider konnte die Psychoanalyse mit ihrer biologistischen Trieblehre und ihrem “hoch medizinischen“, mechanistischen Energiemodell für EUGEN BLEULER und die gesamte Schizophrenieforschung danach deshalb auch nur wenig fruchtbar sein (vgl. FINZEN, 1984, CULLBERG, 2008). Der Mensch war für sie ein lernunfähiges Wesen, selbst im Denken Opfer sexueller und aggressiver Triebregungen. Statt aus Erfahrung zu lernen (und damit unter extremsten Lebenserfahrungen auch einer ebenso extremen wahnhaften Weltsicht verfallen zu können), statt überlebensnotwendig flexibel reagieren zu können und seine körperlichen Kräfte effektiv einzusetzen, sollte der Mensch im DauerbeTRIEB von “tierischen Instinkten“ motiviert und in seinem Denken von (teils “verdrängten“ / behinderten) Energieflüssen statt von seinen Lebenserfahrungen bestimmt sein. FREUDS Glaube an sein medizinisches Modell ominöser Energieflüsse ging sogar so weit, dass er hoffte, man könne seelische Störungen eines Tages auf direktem chemischem Wege heilen indem es gelänge “...mit besonderen chemischen Stoffen die Energiemengen und deren Verteilungen im seelischen Apparat direkt zu beeinflussen. Vielleicht ergeben SICH noch ungeahnte andere Möglichkeiten der Therapie...“ (FREUD, 2016) Natürlich konnte die Psychoanalyse auch keine Angaben darüber machen, wo denn dieses “Triebaggregat“ im Innern des Menschen zu finden sein sollte, wie es neurologisch plausibel hätte funktionieren können und wie und wo die “Energiemengen“ flossen, um so viel seelischen Schaden anrichten zu können.
Seit EUGEN BLEULER und der generell zunehmenden Bedeutung der Psychologie gerieten aber zumindest immer mehr die besonderen Lebensumstände Schizophrener in das Blickfeld klinisch forschender Psychiater. In Ermangelung einer für die Schizophrenieforschung fruchtbaren Allgemeinpsychologie entwickelte sich immerhin eine “phänomenologische Schule“ in den 1950er Jahren, die sich mit großer Genauigkeit mit dem von Schizophrenen berichteten inneren Erleben und ihren erkennbaren Gefühls- und Verhaltensphänomenen beschäftigte (vgl. SCHNEIDER, 1952, CONRAD, 1958, HUBER, 1961). Ohne ein theoretisches Modell zur Schizophrenie zu gebrauchen, beschrieben sie minutiös den Entwicklungscharakter in der Entstehung schizophrener Störungen (vgl. “Stadien des Wahns“ CONRAD, 1958), die zentrale Bedeutung wahnhafter Denkstörungen (vgl. “Symptome ersten Ranges“, SCHNEIDER, 1952) und erkannten, dass die (medizinische Wunsch-) Vorstellung einer hirnorganisch verursachten zwangsläufigen Demenz bei Schizophrenen (vgl. “dementia-praecox“, KRAEPLIN, 1899) nicht der klinischen Realität entsprach.
Die bis heute in der Schizophrenieforschung nicht aufgegebene Hoffnung auf ein medizinisches Wunder sollte aber gerade in den 1950er Jahren durch ein besonderes Ereignis doch noch einen Auftrieb bekommen. Nach Versuch und Irrtum hatten sich bis dahin bei schizophrenen Erkrankungen lediglich einige körperliche Behandlungsmethoden zum Standard entwickeln können, weil sie in der Lage waren, manche Patienten wenigstens vorübergehend von ihrem Wahn zu befreien - allerdings mit teils lebensgefährlichen Risiken (u.a. Insulinschockbehandlung, Cardiazolbehandlung, Elektroschockbehandlung, Schlaftherapie mittels Somnifen, Behandlung mit Malariaerregern, vgl. HESS, 2007, LANGER, 1983). Sie alle erzielten, wie wir noch genauer belegen werden, ihre begrenzte Wirkung letztlich ohne es zu wissen, auf psychotherapeutischem Wege durch eine mehr oder weniger tiefe und länger anhaltende schlafähnliche Unterbrechung des Wahndenkens: Auf diese Weise deaktivierte Wahnstrukturen konnten so durch ein einsetzendes Vergessen im Gedächtnis abgebaut und auf somatopsychischem Wege schizophrene Symptomatik wenigstens vorübergehend reduziert werden (bis erneute Belastungen, psychotherapeutisch ungelöste Konflikte, Traumata, Wahnerinnerungen usw. eine erneute neurotisch-psychotische Entwicklung in Gang setzten, s. Kapitel [7]). 1952 aber war durch Zufall der französische Marinearzt HENRI LABORIT auf eine neue beruhigende Substanz für Patienten vor Operationen gestoßen, empfahl ihre psychiatrische Anwendung und schon bald übernahm sie die schlaffördernde, beruhigende Funktion in den bisherigen sog. “großen Kuren“ mittels u.a. Insulin, Cardiazol, Malariaerregern (vgl. BRANDENBERGER, 2012). Man sprach von einer “pharmakologischen Wende“, einem „Meilenstein des Fortschritts“ (ANGST, 1968) und glaubte durch den begrenzt erfolgreichen Einsatz dieser Substanz (Chlorpromazin) einer organischen Krankheitsursache der Schizophrenie endlich näher gekommen zu sein. Eine um ihre gesellschaftliche Anerkennung als medizinische Disziplin so sehr bemühte Psychiatrie hoffte, endlich auch ein „modernes Medikament“ zu besitzen, um sich als Ort erfolgreicher Wissenschaft und Forschung profilieren zu können (vgl. DIVIDE & CONQUER, 2006).
Zugleich nahm aber auch der Einfluss einer primär an Absatz interessierten Pharmaindustrie auf die Erforschung und die Therapie schizophrener Störungen zu. Eine nicht enden wollende Flut ähnlich wirkender Neuroleptika, die die billigen Generika durch neue, teurere Präparate immer wieder ersetzen sollten und auf eine Langszeitbehandlung abzielten, überrollten in den nächsten Jahrzehnten, aus den Laboren der Pharmaindustrie kommend, die psychiatrischen Kliniken. Mehr und mehr trat die ohnehin psychoanalytisch blockierte psychologische Schizophrenieforschung zwangsläufig zurück, so sehr wurden PsychiaterInnen von der klinischen Erprobung immer neuer Neuroleptika in Atem gehalten, mussten durch Medikamentenwechsel und -kombinationen ihren vielfältigen Nebenwirkungen ausweichen (u.a. Muskelkrämpfen, Speichelfluss, Zittern, Augenleiden) und durch Versuch und Irrtum erst einmal für jeden Patienten das verträglichste Neuroleptikum in der richtigen Dosierung ermitteln (vgl. WEINMANN, 2019).
So dauerte es etliche Jahre bis die Schizophrenieforschung ihren psychopharmakologischen Höhenflug beendete und, auch unter dem Druck ihrer Kritiker, auf den harten Boden der klinischen Realität zurückkehrte. Die bestand in je nach Medikament unterschiedlichen Nebenwirkungen, individuellen körperlichen Unverträglichkeiten und insbesondere in einem Anstieg der Rückfallraten bei Absetzen der Medikamente und/oder bei Rückkehr der Patienten in ihre alte pathogene Alltagswelt (mit unveränderten existentiellen, beruflichen, familiären Belastungen, unlösbaren Konflikten, traumatischen Erinnerungen, irrationalen Indoktrinationen durch andere usw. [5]). Der ernüchternde Begriff der “Drehtürpsychiatrie“ kam auf und es dauerte nicht lange bis sich weltweit auch eine antipsychiatrische Bewegung formierte gegen eine erfolglose, konzeptionslose, nur therapeutische Zufallstreffer erzielende, menschlich wie fachlich überforderte Psychiatrie.
Innerhalb kurzer Zeit erschienen denn auch unabhängig voneinander vier Bücher, die bis heute bei Psychiatrie-Gegnern ihren Nachhall finden. Thomas SZASZ (1920 - 2012), der sich übrigens selbst nicht einer Antipsychiatrie-Bewegung zugehörig gefühlt hat, empfand unter dem Eindruck staatlicher Zwangspsychiatrie (insbesondere in den damaligen “Ostblock-Staaten“) und angesichts ohnehin unklarer psychiatrischer Diagnosekriterien jede psychiatrische Diagnose als diskriminierenden staatlichen “Mythos“ (SZASZ, 1961). Wegen der Gefahr des politischen Missbrauchs sprach er von “medizinischen Zwangsbehandlungen“, was noch heute von wütenden Psychiatrie-Gegnern einer fachlich überforderten, personell unterbesetzten und chronisch unterfinanzierten Psychiatrie gerne aufgenommen wird (s. auch UN-Behindertenrechtskonvention (UNITED NATIONS, 2016)). In seinem späteren Buch “Schizophrenie das heilige Symbol der Psychiatrie“ (SZASZ, 1973) formulierte er speziell die grundlegende Kritik an einem medizinischen Verständnis der Schizophrenie. Er prangerte den Glauben an ein Krankheitsmodell an, das für Leib und Leben der Betroffenen in der therapeutischen Praxis zu einer Lebensgefahr werden konnte und dabei nicht einmal seine Annahmen belegen und zuverlässig erfolgreiche therapeutische Hilfen anbieten konnte. Angesichts dieses „größten wissenschaftlichen Skandals des Jahrhunderts“ sollte der Schizophreniebegriff wegen seines Missbrauchs durch die Psychiatrie gleich ganz verschwinden. Es sollte nicht genügen, ihn von seinen unbelegten medizinischen Annahmen zu befreien, mit einem neuen z.B. psychologischen Verständnis zu füllen und seine therapeutische Umsetzung im Interesse der Betroffenen zu verbessern. Es dominierte der Wunsch, auch von enttäuschten Psychiatrie-Betroffenen, mit dem Schizophreniebegriff der medizinischen Institution “Psychiatrie“ ihr diagnostisches Machtinstrument aus den Händen zu reißen. Unbewusst auch, um die eigene Betroffenheit, das Rätsel der Schizophrenie und die Aufgabe, es lösen zu müssen, aus der Welt zu schaffen. Katastrophale psychiatrische Fehlleistungen lieferten und liefern noch heute den Vorwand, auch schizophrene Ängste und Depressionen nicht länger in die Hände medizinischer Helfer zu geben. Lieber sollten und sollen sie zur belanglosen Normalität erklärt werden, die zu akzeptieren ist als eine Möglichkeit, die Wirklichkeit nach den eigenen Bedürfnissen für sich zu verarbeiten.
Aus diesem Blickwinkel konnte auch MICHEL FOUCAULT (1926 - 1984) eine wissenschaftlich dubiose Psychiatrie nur noch als gesellschaftliches Machtinstrument sehen, das repressiv und aussondernd definieren würde, was “Wahnsinn“ sei und was nicht (vgl. FOUCAULT, 1961). Eine Aussage, die in ihrer Pauschalität natürlich das für jeden erkennbare Leid jener ignorierte, die wegen ihrer wahnsinnigen Ängste und Entmutigungen auch ein Recht auf eine adäquate Diagnose und auf therapeutische Hilfe haben (die angesichts psychopathogener gesellschaftlicher Zustände oftmals leider nur in einem geschützten stationären Milieu gegeben werden kann!) Denn die wenigsten Menschen sind in einer psychiatrischen Klinik aufgewachsen und dort in den Wahn getrieben worden, sondern “gemeindenah“ in u.a. auseinander gebrochenen, sozial benachteiligten Familien, in seelisch wenig förderlichen Schulen usw. und haben danach einen Großteil ihres Lebens arbeitend in sozialen Gemeinschaften verbringen müssen, deren Regeln zu ihrem Lebensglück und zu ihrer seelischen Gesundheit auch nicht unbedingt beigetragen haben (s. Kapitel [8]).
Auch RONALD D. LAING (1927 - 1989) formulierte, nach gescheiterten psychoanalytischen Therapieversuchen mit Schizophrenen, sein Unbehagen an einer “verdinglichenden Psychiatrie“. Er forderte, der Therapeut habe mit dem Patienten zu leben, um dessen “Ausleben“ sozial verursachter, schizophrener Symptome begleiten zu können (LAING, 1960).
ERVING GOFFMAN (1922 - 1982) schließlich übte radikale Kritik insbesondere an der Psychiatrie als einer für ihn “totalen Institution“ (GOFFMAN, 1961) und beeinflusst damit noch heute die Gegner einer ebenso teuren wie in ihren Augen nutzlosen “Drehtürpsychiatrie“. Neuroleptika sind für sie nur die “Waffen“ der “Täter“ gegen “wehrlose Patienten“. Eine verständliche Reaktion von tief enttäuschten Psychiatrieerfahrenen. Sie wird sich wohl erst ändern können, wenn die Psychiatrie durch therapeutische Erfolge belegen kann, dass ihre “Waffen“ nicht gegen die Kranken, sondern gegen deren Krankheit gerichtet sind! Wenn sie dann auch noch die gesellschaftlichen Missstände erkennt und kritisiert, die Menschen in den Wahn treiben können (s. [8]), werden sich sicher noch mehr Menschen ihr vertrauensvoll zuwenden können.
2Wenn Computer schizophren werden könnten…
Ein Computermodell zum Verständnis neurotisch-psychotischer Entwicklungen
Zusammenfassung:
Seelisches Geschehen konnte nur durch eine immer leistungsfähigere Informationsverarbeitung zur Evolution des Menschen beitragen. Um überlebensförderliche und -gefährdende Realitäten rechtzeitig aufgrund früherer Erfahrungen zu erkennen, wuchs so die menschliche Fähigkeit zur sensorischen Aufnahme von Informationen, die Kapazität zu ihrer Speicherung und kognitiven Verarbeitung zur Steuerung eines überlebensförderlichen Verhaltens und dessen psychovegetativer (emotionaler) Motivierung. Eine Einstellungspsychologie, die diese Zusammenhänge abbildet, soll funktional anhand der Parallelen zur künstlichen Intelligenz informationsverarbeitender Systeme veranschaulicht werden. Insbesondere anhand jener, die, wie Internetsuchmaschinen, ebenfalls Informationen zu sammeln und relevante Daten für bestimmte Anforderungssituationen (Suchanfragen) zur Verfügung zu stellen haben. So lässt sich anhand von seelischen Algorithmen auch demonstrieren, unter welchen Bedingungen es beim Menschen zwangsläufig zu irrationalen, neurotischen bis psychotischen Informationsverarbeitungen kommen muss.
Stellen wir uns vor, wir sitzen vor unserem Computer und der ist wie immer mit seinem“weltweiten Gedächtnis“, dem Internet, verbunden. Weil wir etwas von ihm wissen wollen, geben wir unsere Frage in Stichworten in die Suchmaske der Internet-Suchmaschine ein und warten gespannt. Doch statt der sonst so klugen und passenden Fakten, erhalten wir diesmal nur Suchtreffer, die entweder seltsame, unlogische Behauptungen enthalten oder auf unsere eigentliche Frage gar nicht eingehen. Plötzlich öffnet sich auch noch ein pop-up-Fenster und eine fremde Stimme spricht zu uns...
Wir würden denken: „Mein Computer ist wohl verrückt geworden! Ich frage ihn nach dem Wert der britischen Kronjuwelen mit den Suchbegriffen ‚England, Queen, Krone, Wert‘ und er informiert mich über Corona-Erkrankungen im englischen Königshaus! Und nun auch noch diese seltsame Stimme, die mir von den Corona-Inzidenzwerten in England berichtet!“ Unwillkürlich fragen wir uns da, ob wir oder unser Computer Halluzinationen hat.
Wären wir Psychiater, die die Schizophrenie für einen angeborenen Defekt der Hirnchemie halten, würden wir auch die Ursache für die seltsamen Suchtreffer und die “Halluzinationen“ unseres Computers eher in dessen Hardware suchen („Wlan-Fehler?“ oder „Speicherprobleme?“). Wir würden den Computer vielleicht zuerst einmal herunterfahren, wie wir das auch mit unseren schizophrenen Patienten tun, deren Gehirn und deren verwirrte Denktätigkeit wir ja schließlich auch nur mehr oder weniger lange und mehr oder weniger vollständig medikamentös “abschalten“. Genauso wie es auch schon unsere Kollegen und wenigen Kolleginnen in den letzten 100 Jahren getan und für alternativlos gehalten haben: Ob es die Schlaftherapie mittels “Somnifen“ war zu Zeiten, nachdem Egon BLEULER 1911 gerade den Schizophrenie-Begriff eingeführt hatte, oder heiße Bäder, die Insulin-Schockbehandlung oder gar die sog. “Elektro-Konvulsionstherapie“. Sie alle hatten, wie die heutige Behandlung mit Neuroleptika, nur eines gemeinsam, das als ihr einziger therapeutischer Wirkfaktor in Frage kommt: Sie unterbrachen das wahnhafte Denken des Schizophrenen (meist durch ihre Behandlungsprozedur und insbesondere durch einen anschließenden Terminalschlaf)! Das taten sie solange und so oft, bis das wahnhafte Denken sich bis zu einer sog. “Wahndistanzierung“ abgebaut hatte, d.h. der Betroffene selbst sein wahnhaftes Irren kritisch hinterfragen und sich von ihm distanzieren konnte. Warum diese körperlichen Behandlungsmethoden schizophrene Symptome reduzierten, wussten frühere Psychiatergenerationen allerdings genauso wenig, wie ihre KollegInnen heute, die mit Antipsychotika ihre Patienten in einen mehr oder weniger tiefen Dauer-Halbschlaf versetzen und über eine biochemische Ursachenbekämpfung spekulieren.
So wenig erfolgreich ein längeres Abschalten bei einem Computer mit “wahnhaften Internet-Suchergebnissen“ sein dürfte, so wenig nachhaltig waren allerdings auch schon immer die medizinischen Behandlungsmethoden bei schizophrenen Psychosen (“Drehtürpsychiatrie“). Dauerhaft konnten sie i.d.R. nur sein, wenn das Gehirn des Betroffenen medikamentös oder in anderer Weise ein Leben lang mehr oder weniger in Inaktivität (oder gar Funktionsunfähigkeit, wie bei der 1949 Nobelpreis prämierten Lobotomie!) versetzt wurde - leider mit all den körperlichen, intellektuellen, emotionalen und sozialen Beeinträchtigungen, die dies bis heute mit sich brachte. Andernfalls ist nach einer ersten erfolgreichen Wahndistanzierung in den meisten Fällen mit einem psychotischen Rückfall zu rechnen. Denn sobald ein Mensch danach wieder bewusst auf sein Gedächtnis zugreifen kann und dieses immer wieder mit Informationen über neurotisch machende Belastungen, Konflikte, Abhängigkeiten, irrationale Indoktrinationen usw. “überfüttert“ wird, werden ihm erneut wahnhafte Suchfehler unterlaufen.
Nicht anders erginge es einem Computer, der, wie in unserem Gedankenexperiment, nach einem menschlichen Suchalgorithmus auf das globale Internetgedächtnis zugreifen würde. Würde es noch mehr als bisher mit ängstigenden Corona-Informationen einseitig überfüttert und würde deren Relevanz für Suchanfragen nach einem menschlichen Algorithmus und nicht nach dem eines regulären Internetsuchdienstes bestimmt werden, müssten wir wirklich, wie in unserem Beispiel, mit wahnhaften Suchergebnissen rechnen.
Wäre für uns die Schizophrenie allerdings kein neuronaler Hardwarefehler, dann müssten wir, um Denkfehler zu begreifen, uns zuerst einmal genauer anschauen, wie Menschen Informationen überhaupt verarbeiten, um sie im Sinne evolutionärer Überlebensstrategie richtig zu erkennen und auf sie rational reagieren zu können. Der Alltagserfahrung am nächsten ist wohl die Annahme, dass Menschen (und Computer) nur aus jenen Informationen ihre Antworten, Schlussfolgerungen und Bewertungen der Realität ziehen können, mit denen sie zuvor “gefüttert“ wurden. Also gibt es im Falle fehlerhafter neurotischer oder gar wahnhafter Informationsverarbeitung nur zwei Möglichkeiten:
(1) Entweder wurde das Gedächtnis eines Menschen oder eines Computers mit irrationalen oder gar wahnhaften Informationen (Meinungen/“Einstellungen“) “gefüttert“ (das Internetgedächtnis z.B. mit fake-Informationen oder emotional abhängige Menschen z.B. mit sozial ängstlich-misstrauischen oder hypochondrischen Einstellungen durch enge Bezugspersonen oder -gruppen, s. auch die sog. “folie à deux“ und “induzierter Wahn“) und/oder
(2) Denkfehler gehen (u.U. auch zusätzlich) auf die übergeneralisierende und deshalb fehlerhafte Verarbeitung von neuen Informationen durch im Gedächtnis überrepräsentierte alte Datenbestände zurück: Der Computer würde in diesem Falle eine Suchanfrage weniger nach ihrer eigentlichen Bedeutung interpretieren, sondern z.B. auf der Grundlage übergroßer, extrem häufig verlinkter und abgrufener Datenbestände (deshalb z.B. die wahnhafte Corona-Antwort auf die Frage nach dem Wert der britischen Kronjuwelen). Menschen unterlaufen solche Denkfehler in neurotischer oder gar wahnhafter Weise, wenn sich bei ihnen in neurotischem oder gar überneurotischem Umfang emotional belastende Vorerfahrungen angesammelt haben, die die individuelle Verarbeitung nachfolgender Informationen, wie ein schwarzes Loch, verzerrend an sich ziehen. Dann sind es Gedächtnisstrukturen (“Einstellungsstrukturen“) aus überneurotisch häufigen und dramatischen Traumata, chronischen Konflikten, hilflos erlebten Demütigungen und Misserfolgen, Abhängigkeiten, irrationalen (z.B. religiösen, sozial ängstlich-misstrauischen) Indoktrinationen usw., die durch den menschlichen Suchalgorithmus des Gehirns eine derart extreme Relevanz in der Informationsverarbeitung erreichen, dass es zu neurotisch-irrationalen, selbst- und/oder fremdschädigenden und schließlich sogar wahnhaften Fehlschlüssen (Übergeneralisierungen) kommen muss von einer z.B. ängstigenden Vergangenheit auf eine ebenso bedrohlich erscheinende Gegenwart.
Beim Menschen ist es also letztlich ein einseitig und mit irrationalen Informationen überfüttertes Gedächtnis, das wir als Ursache einer neurotischen und nach einer neurotischpsychotischen Entwicklung wahnhaften Informationsverarbeitung ansehen müssen.
Bei unserem Computer und seinem Internet-Gedächtnis wird eine solche einseitige “Überfütterung“ mit vielleicht sogar irrationalen Informationen zu einem bestimmten Thema weitaus unwahrscheinlicher sein angesichts des globalen Informationsangebotes zu alternativen Themen mit unterschiedlichen Meinungen dazu. Sein Gedächtnis ist (noch?) nicht von irrationalen politischen und kommerziellen Informationen vereinnahmt, wie etwa das eines Neurotikers z.B. von ängstigenden Einstellungsstrukturen, dass Internet-Suchanfragen in die immer gleiche Richtung in die Irre gehen müssten. Bliebe die Frage: Könnte es sein, dass ein Computer auch dank seines weniger “schizophrenieanfälligen“ Suchalgorithmus weniger psychotisch gefährdet ist?
Informationen im Gedächtnis eines Menschen, die seine Einstellungen zu sich und der Welt bestimmen (Einstellungsstrukturen), können jedenfalls infolge wiederholter Lerndurchgänge und memorierender Denkschleifen (siehe das endlose, auch nächtliche irrationale Grübeln Schizophrener vor psychotischen Krisen) eine derart hohe Enkodierungsstärke und synaptische Vernetzung erreichen, dass mit einer ganzen Palette überneurotischer Symptome gerechnet werden muss (vgl. Kapitel 5). Von überneurotisch enkodierten Einstellungskomplexen geht nicht nur eine überneurotisch extreme Verarbeitungsbereitschaft aus, die aus aktuellen Erlebnissen und Gedanken, die logisch mit ihnen nichts zu tun haben, phantasievolle erste erlebnisreaktive Wahnwahrnehmungen und gedankliche Wahneinfälle generieren. Der Übergang des Neurotikers zum wahnhaften Schizophrenen nach einer neurotischpsychotischen Entwicklung ist ebenso zu erkennen:
Wie aber ist die Heilung schizophrener Menschen möglich, wenn deren Informationsverarbeitung durch extrem überspeicherte wahnhafte Einstellungsstrukturen bestimmt wird, die mitunter von Kindheit an ihrem Gedächtnis eingebrannt wurden? Tatsächlich ist dies bei Menschen einfacher, als bei einem Computer und dessen Internetgedächtnis, denn das vergisst nie! Es sei denn man könnte seine irrationalen fake-Informationen aus politischer Propaganda und kommerziellem Werbepopulismus weltweit auf allen Servern löschen und alle Internet-user davon abhalten, die gelöschten Datenbestände durch den upload privater back-ups wieder aufzufrischen.
Wie gut, dass das menschliche Gedächtnis zu seiner Bereinigung alter, überholter und womöglich auch noch irrationaler oder gar wahnhafter Einstellungsstrukturen extra über einen neuronalen Löschautomatismus verfügt. Dieser evolutionär bedeutsame, Vergessen genannte zeitabhängige Löschvorgang für alte Gedächtnisstrukturen, die durch ähnliche Informationen nicht wieder bestätigt und aufgefrischt wurden, sorgt dafür, dass diese kontinuierlich mit der Zeit in ihrer Speicherstärke und Relevanz für die individuelle Informationsverarbeitung abnehmen. Genau diesen Vergessensmechanismus kann sich auch eine Psychotherapie schizophrener Psychosen zunutze machen. Ihr erstes Ziel muss deshalb darin bestehen, alles zu tun, dass wahnhafte Einstellungsstrukturen durch Inaktivität Zeit haben, auf eine “nur“ noch neurotische Speicherstärke und Relevanz abgebaut (vergessen) zu werden. Genau dies haben alle bisherigen, mehr oder weniger erfolgreichen medizinischen Behandlungsmethoden auch getan. Sie sind sozusagen die “psychotherapeutischen Zufallstreffer“ der klassischen biologistischen Psychiatrie! Ihr war und ist der somato-psychische Effekt ihrer aus Therapieerfahrungen abgeleiteten pragmatischen Behandlungsstrategie zwar nicht bewusst. Aber so grotesk es klingen mag: Die traditionelle Psychiatrie hat ihre bescheidenen Erfolge ihrer somatischen (u.a. medikamentösen) Psychotherapie zu verdanken.
Manchen wird es vielleicht wundern, dass wir damit aus psychologischer Sicht eine anti‐psychotische Medikation empfehlen und diese im Rahmen einer gestuften Psychotherapie schizophrener Psychosen (vgl. Kapitel [7]) ebenfalls als Psychotherapie verstehen. Doch:
Psychotherapie ist nach unserem Verständnis jedes systematische therapeutische Vorgehen, das geeignet ist, durch individuelle Einstellungsveränderungen das kognitiv-emotionale Erleben eines Menschen im Einklang mit seiner Umwelt nachhaltig zu verbessern.
So können z.B. die verbalen Suggestionen eines Therapeuten beim Klienten Einstellungsänderungen psychotherapeutisch bewirken, aber ebenso können das auch antipsychotische Substanzen auf ihre besondere Weise tun. Sie vermitteln zwar keine neuen z.B. vertrauensvollen sozialen Einstellungen oder Kompetenzen, wie z.B. eine Therapeut-Klienten-Kommunikation, ein soziales Rollenspiel oder eine erfolgreiche in-vivo-Verhaltensübung. Sie vermitteln metakognitiv auch keine einsichtige negative Einstellung zu bisherigen neurotisch-irrationalen, selbst- und/oder fremdschädigenden persönlichen Denkmustern. Eine antipsychotische Medikation kann aber gerade beim Schizophrenen noch etwas erreichen, was keine sonst erfolgreiche konventionelle Neurosetherapie bei ihm erreichen kann:
Eine neuroleptische Medikation unterbricht durch eine Reduktion aller kognitiven Prozesse auch das wahnhafte Denken des Schizophrenen und kann Wahnstrukturen so durch ein einsetzendes natürliches Vergessen mit der Zeit in ihrer Überzeugtheit (Wahngewissheit) schwächen.
So wie es auch der Psychotherapeut beim Neurotiker bewusst oder unbewusst u.a. tut, wenn er durch die Beschäftigung mit rationalen, gesunden Einstellungen dessen neurotisches Denken unterbricht, irrationale Einstellungsstrukturen damit automatisch in Vergessenheit bringt und seine vorhandenen rationalen Einstellungsstrukturen durch neue rationale Denk- und Verhaltensvorbilder stärkt. Leider ist aber genau dies beim Schizophrenen mit konventionellen neurosetherapeutischen Mitteln nicht mehr möglich!
Seine überneurotische Einseitigkeit im Denken würde auch therapeutische Botschaften unweigerlich in den übergeneralisierenden Strudel einseitig wahnhafter Realitätsverarbeitung geraten lassen (Überinklusivität).
Sie würden den schizophrenen Wahn eher noch vergrößern und zu erneuten psychotischen Krisen reaktivieren! Hier können nur wahnneutrale, nicht problembezogene therapeutische Methoden, wie eine antipsychotische Medikation, die psychotherapeutische Unterbrechung selbst- und/oder fremdschädigenden wahnhaften Denkens, Fühlens und Handelns erreichen, ohne selbst eine Wahnreaktivierung und -expansion zu provozieren. Nur so kann ein Vergessensabbau mit der Zeit Wahnstrukturen im Gedächtnis so sehr reduzieren, dass der Betroffene seine wahnhafte Weltsicht selbstkritisch ablegt und kognitiv in die Realität zurückkehrt (Wahndistanzierung).
Letzteres ist nun aber gerade für den weiteren Verlauf einer Psychotherapie schizophrener Psychosen von allergrößter Bedeutung. Schafft ein medikamentöser Abbau überspeicherter Wahneinstellungen (wahnsuppressive Therapiestufe I, s. Kapitel [7.8]) und eine zusätzliche reizkontrollierte Therapiestufe II (s. Kapitel [7.9]), in der auf die Vermeidung von wahnreaktivierenden Stressreizen im Umfeld des immer noch vulnerablen Postschizophrenen geachtet wird, doch erst die Voraussetzung dafür, dass nachfolgend gefahrlos an der neurotischen Ausgangsproblematik einer neurotischpsychotischen Entwicklung neurosetherapeutisch gearbeitet werden kann (einstellungszentrierte Therapiestufe III, s. Kapitel 6.8). Erst dann ist die Gefahr einer wahnhaften Fehlinterpretation therapeutischer Kommunikation reduziert. Den Abschluss einer gestuften Psychotherapie kann dann schließlich eine rehabilitative Therapiestufe IV (s. Kapitel [7.11]) bilden. Sie bereitet die Betroffenen nach deren neurosetherapeutischen Stabilisierung mit neuen Verhaltenskompetenzen und einem von Konflikten und chronischen Belastungen bereinigten Lebensumfeld auf eine (Re-) Integration ins Alltagsleben vor.
3Unser Gedächtnis - Schaltzentrale des Denkens, Fühlens und Handelns
Gedächtnispsychologische Grundlagen einer kognitiven Einstellungspsychologie
Zusammenfassung:
Zentral für unsere Einstellungspsychologie neurotisch-psychotischer Entwicklungen ist die Funktion des menschlichen Gedächtnisses. Es speichert und vernetzt untereinander bewertende (konnotative) Einstellungsstrukturen und ruft über diese situationsgerecht verhaltenssteuernde (konative) Einstellungsstrukturen ab. Zugleich sorgt es durch die Kopplung von Denken und Fühlen psychovegetativ für eine emotionale Bewertung der im Gedächtnis abgerufenen Informationen und sorgt mit der entsprechenden Gefühlslage für eine angenehm motivierte Annäherungsreaktion, für eine Angstblockade des Verhaltens oder für eine nach aggressiver Bewältigung verlangende Ärger- und Wutreaktion.
Müssten wir unsere nun folgende Einstellungspsychologie (vgl. ROKEACH, 1972) 10-jährigen Grundschülern in einem (sicherlich längst überfälligen) Fach “Menschenkunde“ verständlich machen, könnten wir das wohl am einfachsten tun, indem wir mit der Bedeutung des menschlichen Gedächtnisses beginnen. Wir könnten den Kindern von einem Jungen erzählen, der von seiner Mutter den Auftrag erhalten hat, beim Bäcker Brot und Kuchen einzukaufen und dank seines Gedächtnisses auch im Geschäft noch weiß, was ihm aufgetragen worden war. Der Junge steht also im Laden und wegen seines im Gedächtnis gespeicherten Auftrags, Brot und Kuchen zu kaufen, wären ihm ganz sicher auch gleich die Brote und der Kuchen in der Auslage aufgefallen - seine Aufmerksamkeit war für die bewusste Wahrnehmung von Brot und Kuchen durch seine im Gedächtnis gespeicherten Informationen erhöht worden, weil die Mutter durch ihren Auftrag in seinem Gedächtnis entsprechende Bilder zuvor aktiviert hatte. Hat der Junge schon auf dem Weg zum Becker an den Kuchen gedacht, den er kaufen sollte, haben seine Gedanken auch bereits Gefühle in ihm ausgelöst. Er hat also erfahren, dass die Gefühle eines Menschen davon abhängen, womit sein Gedächtnis in Gedanken gerade beschäftigt ist. Die Gedanken an die Leckereien müssen ihm nicht einmal bewusst geworden sein und dennoch könnte er auf dem Weg zum Bäcker bereits Vorfreude empfunden haben. Der Junge konnte vielleicht sogar spüren, dass sein Herz höher schlug und anderes in seinem Körper vor sich ging, sobald er an all die leckeren Dinge dachte, die ihn erwarteten. Diese Reaktionen des Körpers (vgl. BÖSEL, 1981) werden nach unserer Einstellungspsychologie psychovegetativ durch bewusste oder unbewusste Gedächtnisaktivitäten ausgelöst und von dem Jungen bewusst wiederum als Gefühl erlebt. Wir könnten das auch so formulieren:
Die Gedächtnisstrukturen in der Hirnrinde sind verknüpft mit Funktionszentren subkortikaler Strukturen des Hirnstamms, über die bestimmte vegetative Reaktionsmuster des Organismus ausgelöst werden können. Diese unterschiedlichen, komplexen neurohumoralen Organismusreaktionen sind die körperliche Grundlage von bewusst als Gefühl erlebter Freude, Angst, Wut, Trauer und sexueller Erregung. Diese Annahmen sind verwandt mit emotionstheoretischen Grundlagenvorstellungen, wie sie erstmals unter der JAMES-LANGE-Theorie (JAMES, 1884, vgl. COFER, 1975) bekannt geworden sind: Gefühle werden letztlich als körperliche Selbsterfahrungen verstanden. Zusätzlich bringen wir die Rolle subkortikaler Bereiche in‘s Spiel, die quasi als Vermittlungszentrale zwischen gedanklichen Prozessen und peripheren physiologischen Folgezuständen fungieren. Sie gewinnen durch die biochemische Beeinflussbarkeit ihrer Funktionsabläufe gerade im Zusammenhang mit der medikamentösen Veränderbarkeit schizophrener Erregungszustände an erklärender Bedeutung. Liegt doch die Annahme nahe, dass somit einschließlich dieser subkortikalen Umschaltzentren emotionales Erleben gleich auf zwei Ebenen psychopharmakologisch beeinflussbar wird:
Unser psychosomatisches Emotionsverständnis wird anschaulich belegt durch die vielen Redensarten, mit denen der Volksmund die Körperlichkeit von Gefühlen beschreibt. Warum sonst sagen wir: „Das schlägt mir auf den Magen.“ „Das bringt mich auf 180!“ „Es verschlägt mir den Atem.“ „Das ist doch alles zum Kotzen!“ „Er hat wohl weiche Knie bekommen.“ „Ich hab‘ so einen Hals!“ „Ich hab die Schnauze voll!“ oder „Meine Schulden bereiten mir Kopfzerbrechen“? Ein ganzer Katalog von Gefühlen wird mit bestimmten körperlichen Zuständen identifiziert! Auch ist der bedingende Zusammenhang zwischen Denken und Fühlen in der kognitiven Verhaltenstherapie längst eine in der Praxis angewandte psychologische Erkenntnis (vgl. u.a. “rational-emotive-Therapie“ ELLIS, 1977, BECK, 1979, LAZARUS, 1980).
Werden gesunde physiologische Prozesse dauerhaft emotional gestört, kann es gar zu psychosomatischen Erkrankungen kommen (vgl. ADLER et al., 1996). Chronische emotionale Zustände (z.B. permanente ängstliche Anspannung, wutneurotische Zustände mit Aggressionsbereitschaft) können z.B. das Herz-Kreislauf-System oder Magen-Darm-Funktionen derart stören, dass auch krankhafte Über- oder Unterfunktionen zum Dauerzustand werden (z.B. Bluthochdruckerkrankungen bei chronisch wutneurotischen Gefühlslagen) und schließlich sogar krankhafte Veränderungen insbesondere an konstitutionellen Schwachpunkten des Körpers zu erwarten sind (z.B. Schädigungen der Mageninnenwand / Magengeschwür infolge Magensäureüberproduktion bei chronischen Ärgerzuständen mit unterdrückter Aggressionsbereitschaft).
Wenn wir recht haben und komplexe physiologische Reaktionsmuster des Organismus für uns zu Gefühlserfahrungen werden, müssen wir für sie auch die gleichen Verarbeitungsmöglichkeiten gelten lassen, wie für alle unsere Erfahrungen. Also werden Gefühlserfahrungen in assoziativer Verknüpfung mit den zu ihnen gehörigen Reizerfahrungen, gedanklichen Phantasien und mit ihrem sprachlichen Ausdruck auch gespeichert (z.B. Prüfungsangst mit der Erfahrung der Prüfungssituation und das Gefühl der Angst mit dem Wort “Angst“). Die im Gedächtnis festgehaltenen Gefühle können so auch mit Worten und durch die Erinnerung an die Situationen und Auslöser ihres Auftretens wieder bewusst erlebt werden. (z.B. verbale Suggestionen von „Ruhe und Entspannung“ rufen Erinnerungen an ruhige Situationen, bereits erlebte Ruhe und Entspannung und über diese wiederum auch originäre psychovegetative Entspannung ab). Auch wenn Gefühlen durch besondere Umstände, wie z.B. nach einer Querschnittslähmung, die physiologische Basis ganz oder teilweise entzogen wurde (je nachdem ab welchem Rückenmarkssegment die Verbindung zu körperlichen Gefühlsreizen unterbrochen wurde), sind weiterhin Gefühle erlebbar: Gedächtnisstrukturen mit emotionalem Erlebnisgehalt aus der Vergangenheit können assoziativ abgerufen werden (z.B. in einer erneuten Prüfungssituation oder verbal durch „Angst“). So kommt es zwar bei vollständigen Querschnittslähmungen oberhalb des Lumbalmarks, trotz intaktem Erektions- und Ejakulationsreflex, zu keinem originären orgastischen Gefühlserleben mehr, da die afferenten Nervenverbindungen des Genitalbereiches mit dem Gehirn unterbrochen sind. Dennoch kann sich ein erinnerndes Sexualerleben (z.B. im Traum) u.U. sogar bis zu einem erinnerten Orgasmus steigern, ohne allerdings genitale Auswirkungen zu haben (ORTHNER, 1955). Allerdings wird das erinnerte Wiedererleben von Gefühlen die Intensität körperlichen Gefühlserlebens kaum erreichen können. So konnte HOHMANN (1966) z.B. zeigen, dass Querschnittsgelähmte je nach Höhe der Läsion ein Absinken der Emotionalität berichten. Bei unverändertem sprachlichmotorischem Verhalten in emotionalen Situationen ist ihr Gefühlserleben demgegenüber reduziert („eine Art kalten Ärgers“, „Ich sage, ich fürchte mich, aber ich fürchte mich doch nicht so richtig, nicht so gespannt...“, HOHMANN, 1966, zitiert nach BIRBAUMER, 1975).
Die Stärke und die Art einer emotionalen Reaktion ist eindeutig festgelegt durch die Intensität und die Art des physiologischen Reaktionsmusters, das von kognitiven Verarbeitungsprozessen ausgelöst wurde. Es kann zwar z.B. eine Beschleunigung der Herzfrequenz sowohl am physiologischen Muster eines Angstgefühls als auch am Reaktionsmuster eines angenehmen, euphorischen Gefühls beteiligt sein (vgl. BIRBAUMER, 1975), aber das Insgesamt aller übrigen physiologischen Parameter schafft sehr wohl noch Unterschiede genug, dass sich ein Angstgefühl von Glücksgefühlen in unserem Erleben deutlich unterscheidet.
Gefühle nach unserem Verständnis haben, wie alle seelischen Funktionen, die wir theoretisch für plausibel halten, gleich in mehrfacher Hinsicht eine überlebenswichtige Bedeutung. Zunächst einmal sind körperliche Gefühlsreaktionen beim Menschen stets mit einem entsprechenden, für die soziale Umgebung meist erkennbaren nonverbalen Affektausdruck verbunden. Artgenossen konnten so schon immer wertvolle Informationen über die Gefühle eines anderen erhalten, über dessen Bewertung des eigenen Verhaltens und über die gemeinsame Umwelt. Der unwillkürliche körperliche Ausdruck von Gefühlslagen war eine Art erste Sprache, umz.B. durch Mimik, Körperhaltung und unterschiedliche stimmliche Lautäußerungen die Artgenossen vor eventuellen Gefahren zu warnen, aber auch auf Arterhaltendes, wie etwa Nahrungsquellen oder die eigene Paarungsbereitschaft, hinzuweisen.
Zugleich ist die Vorfreude unseres Jungen, etwas Leckeres zu kaufen und dafür (hoffentlich) von seiner Mutter auch noch gelobt und von seinen Eltern geliebt zu werden, noch von weiterer (überlebenswichtiger) Bedeutung: Brot und Kuchen waren von der Mutter im Gedächtnis des Jungen nicht nur mit dem Einstellungsinhalt “kaufenswert“ verknüpft worden (s. unten) und lösten daraufhin Vorfreude in ihm aus. Dieses Gefühl motivierte ihn zugleich, überhaupt zum Bäcker zu gehen (vgl. Anreiztheorien der Motivation, u.a. YOUNG, 1959, MCCLELLAND et al., 1953, COFER & APPLEY, 1964). Nur ein angenehmes Handlungsziel, das letztlich im eigenen Interesse ist, kann menschliches Verhalten motivieren. Auch ein angeblich “selbstloses“, “aufopferndes“ Sozialverhalten eines Menschen braucht zu seiner Umsetzung letztlich persönliche Motive, um in die Tat umgesetzt werden zu können (z.B. unbewusste Erwartungen sozialer Gegenleistungen / Anerkennung, religiöse “Sündenvergebung“, “paradiesische Belohnungen“, Verhinderung von “Höllenstrafen“). Bei unserem Jungen hatte sich durch den Wunsch der Mutter, so müssen wir es einstellungspsychologisch formulieren, eine aktuelle Einstellung zu Brot und Kuchen und zum vielleicht anstrengenden Gang zum Bäcker im Gedächtnis gebildet: Brot und Kuchen waren für den Jungen zu Einstellungsobjekten geworden, die mit den Einstellungsinhalten “kaufenswert / werden von Mutter gewünscht“ usw. im Gedächtnis verknüpft worden waren. Formelhaft lässt sich dies etwa folgendermaßen darstellen:
Inhalt: Wunsch der Mutter, leckeres Brot /Kuchen...
Unzählige dieser bewertenden (konnotativen) Einstellungen, im Gedächtnis verewigt, bestimmen die Persönlichkeit eines Menschen. Sie werden von Kindheit an im Gedächtnis gespeichert (enkodiert) und lassen die Vergangenheit eines Menschen in jedem Augenblick seines Daseins wieder aufleben. In jeder Situation holt der Mensch unzählige vergangene Erfahrungen, in Einstellungen abgelegt, bewusst oder unbewusst aus dem Gedächtnis wieder hervor, um sie überlebenswichtig für ein rationales Erkennen, eine emotionale Bewertung und verhaltensmäßige Bewältigung der Gegenwart zu nutzen.
Bleibt nur noch, im Fach “Menschenkunde“ den Schülern die Fähigkeit des Jungen, ein Verhalten zu zeigen, einstellungspsychologisch verständlich zu machen: Um zum Bäcker zu gelangen, muss der Junge selbstverständlich durch Versuch und Irrtum, durch Vorbilder usw. zuerst einmal das Gehen gelernt haben. Er muss entsprechende Verhaltensprogramme (konative Einstellungsstrukturen) im Gedächtnis gespeichert und sie mit den passenden Handlungssituationen verknüpft haben. Dann muss der Junge nur noch motiviert und körperlich aktiviert werden, ein Verhaltensprogramm auch auszuführen. Diese Aufgabe übernehmen angenehme motivierende Gefühle, wie die Vorfreude auf Leckereien, die Erwartung sozialer Anerkennung und sonstige positive Erwartungen, die mit einer Verhaltenseinstellung im (Verhaltens-) Gedächtnis verknüpft sein können:
Belohnungserwartungen
EZum Bäcker gehenZuneigung der Eltern, Brot / Kuchen
So verbindet sich mit dem Gehen zum Bäcker ein angenehmes Gefühl, das ihn für eine entsprechende Handlung in eine körperliche Aktivierung versetzt und ihn nicht ängstlich, (depressiv) enttäuscht oder frustriert im Verhalten blockiert. Das Lob der Mutter, die wohlschmeckenden Leckereien, die Freude am Gehen, die Vermeidung negativer Folgen (z.B. die Enttäuschung der Mutter) motivieren den Jungen, seine Verhaltenseinstellungen auch in die Tat umzusetzen.
Das ist fast schon die ganze Allgemeinpsychologie, die wir brauchen, um darauf unsere Neurosenlehre und danach unser Verständnis neurotisch-psychotischer Einstellungsentwicklungen aufbauen zu können. Wir haben uns auf möglichst wenige seelische Funktionseinheiten beschränkt, die allein schon anhand unserer Alltagserfahrung jedem einsichtig sein können. Sie sind in ihren Auswirkungen für jeden beobachtbar, können zumindest hypothetisch jeweils einem Organ des menschlichen Nervensystems und dessen Funktionsweise zugeordnet werden und dienen überlebenswichtig der Auseinandersetzung des Menschen mit den Herausforderungen seiner Umwelt.





























