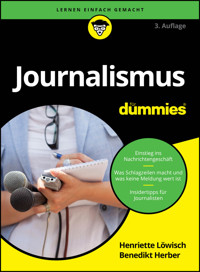
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Für Dummies
- Sprache: Englisch
Vom Recherchieren bis zum Publizieren
Wie kommt eine Nachricht zustande? Wie sieht ein Tag in der Redaktion aus, und was macht einen guten Journalisten aus? Henriette Löwisch und Benedikt Herber lüften die Berufsgeheimnisse der Journalisten und erklären Ihnen das Nachrichtengeschäft von der Recherche bis zur Publikation. Sie erfahren, welchen Regeln sich Journalisten unterwerfen und welche sie immer wieder gern verletzen. Sie lernen die Tricks des Gewerbes kennen und erhalten Tipps für den Berufseinstieg. Außerdem erfahren Sie, wie die Zukunft des Journalismus aussieht und ob Chatbots die besseren Redakteure sein werden.
Sie erfahren
- Warum eine schlechte Nachricht für Journalisten die bessere ist
- Wie die besten Stories entstehen
- Welche Eigenschaften bei Journalisten gefragt sind
- Wie Ihnen der Einstieg in den Journalismus gelingt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Journalismus für Dummies
Schummelseite
DIE SIEBEN W-FRAGEN
Wer eine Meldung formuliert, muss schon in den ersten Sätzen die wichtigsten Fragen des Publikums beantworten. Denn die Leute wollen sich möglichst schnell und doch komplett informieren. Redakteurinnen und Redakteure kennen die sieben W-Fragen im Schlaf.
Was?Wer?Wo?Wann?Warum?Wie?Woher?DER UMGANG MIT WIDERSPENSTIGEN PRESSESTELLEN
Eigentlich sind Pressestellen dazu da, Auskünfte zu erteilen. Oft betätigen sie sich eher als Informationsverweigerer. Diesen Ausreden ist jeder Journalist schon begegnet:
»Stellen Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail.«»Alle Pressesprecher sind zu Tisch.«»Sie stehen schon auf der Rückrufliste.«»Das darf ich aus Datenschutzgründen nicht weitergeben.«»Aus einem schwebenden Verfahren darf ich nichts berichten.«»Unser Archiv wird gerade digitalisiert.«Gut, dass sich auch Vorzimmerdrachen zähmen lassen. Man sollte sich den Namen zu Beginn eines Telefonats notieren und ihn dann im Gespräch auch benutzen. Das schafft Verbindlichkeit und erhöht die Chance, dass das eigene Anliegen erfüllt wird.
Noch besser ist es aus Reportersicht allerdings, die Pressestelle zu umgehen und einen direkten Draht zu Verantwortlichen und Beteiligten herzustellen. Handynummern und persönliche E-Mail-Adressen von Politikern, Gewerkschaftsfunktionären oder Anwälten sind für Journalisten daher ein nützliches und überaus kostbares Gut.
TIPPS FÜRS INTERVIEW
Verraten Sie bei Ihrer Interviewanfrage nicht gleich den ganzen Fragenkatalog. Die Anbahnungsmail nennt das Thema und höchstens eine Lockfrage.Erkundigen Sie sich vor dem Interview über Ihren Gesprächspartner. Aus Anekdoten und Widersprüchen können Sie Fragen oder Hypothesen entwickeln.Kleiden Sie sich angemessen. Jeans passen nicht in eine Firmenzentrale, hochhackige Schuhe nicht auf einen Bauernhof.Seien Sie pünktlich. Wer zu spät zu einem Interviewtermin erscheint, bekommt in neun von zehn Fällen keine Gelegenheit mehr zum Gespräch.Rücken Sie Ihren Gesprächspartnern nicht allzu sehr auf den Leib. Am besten ist es, sich über Eck zu setzen, damit man sich nicht gegenseitig anstarren muss.Hüten Sie sich davor, Wissenschaftlern oder Politikern allzu offene Fragen zu stellen. Die Antwort fällt oft so langatmig aus, dass die erste Frage die letzte bleibt.Locken Sie zögerliche Interviewpartner aus der Reserve, indem Sie Gesprächslücken zulassen. Oft wird Ihr Gegenüber das Schweigen brechen.Verlassen Sie sich nicht blind auf Ihr Aufnahmegerät. Machen Sie auch Notizen.AUSDRÜCKE, DIE SIE MEIDEN SOLLTEN
Asylant: Abwertendes Wort für Geflüchtete und Asylsuchende.Blondine: Sexistisch. Schließlich nennen Sie den Firmenchef auch nicht Glatzkopf.Bußgeldbescheid: Behördendeutsch für Strafzettel.Durchführen: Mit diesem Verb verschleierten die Nazis ihre Taten.Ethnische Säuberung: Menschen sind kein Dreck. Besser: Vertreibung.Explodierende Benzinpreise: Da muss man wohl besser in Deckung gehen.Kriegsausbruch: Kriege sind keine Naturgewalten, sondern von Menschen gemacht.Opferbilanz: Menschen werden nicht bilanziert. Besser: Opferzahl.Sintflutartige Regenfälle: Dann lieber gleich ab in die Arche.Zigeuner: Mit Vorurteilen geladener Ausdruck für Sinti und Roma.Journalismus für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
3. überarb. u. aktualis. Auflage 2025
© 2025 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This book published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Dieses Buch wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: wellphoto - stock.adobe.comKorrektur: Lena-Maria Denu, München
Print ISBN: 978-3-527-72308-9ePub ISBN: 978-3-527-85172-0
Über die Autoren
Nachtredakteurin, NATO-Korrespondentin, Nachrichtenchefin – Henriette Löwisch kennt den Journalismus von innen. Ihre Laufbahn begann ganz klassisch bei der Badischen Zeitung. An der Deutschen Journalistenschule in München lernte sie weiter, studierte Journalistik in Deutschland und den USA. Mit Mitte zwanzig hatte sie bereits bei einer Zeitschrift, beim Fernsehen und in einer Pressestelle gearbeitet. Dann lockte die weite Welt: Im Team der Nachrichtenagentur AFP erfüllte sie sich den Traum, als Auslandskorrespondentin die Welt kennenzulernen.
Ihre erste Station im Ausland war Brüssel, später berichtete sie als Washington-Korrespondentin über die USA. Nach Berlin zurückgekehrt, verantwortete sie als AFP-Chefredakteurin drei Jahre lang die Berichterstattung der Agentur. Bis ihr aufging, was ihr am meisten Freude macht: anderen zu vermitteln, was Journalismus bedeutet, und es dabei selbst immer wieder neu herauszufinden. Sie wurde Journalismusprofessorin an der Universität von Montana in den USA.
Seit 2017 leitet Henriette Löwisch die Deutsche Journalistenschule in München. Sie diskutiert mit dem Nachwuchs ebenso wie mit ausgebufften Profis. Journalismus für Dummies ist das Ergebnis ihrer Lieblingsbeschäftigung: Fragen stellen und Antworten suchen – denn wer nicht fragt, bleibt dumm.
Seine Leidenschaft: lange Texte. Benedikt Herber recherchiert am liebsten monatelang an nur einer Geschichte. Als freiberuflicher Reporter veröffentlicht er regelmäßig Reportagen für Print und fürs Radio, seine Beiträge erscheinen bei überregionalen Medien wie etwa der ZEIT, dem Stern oder Deutschlandfunk. Dafür sitzt er stundenlang in deutschen Gerichtssälen oder reist um die Welt, um aus Ländern zu berichten, die im journalistischen Tagesgeschäft ansonsten weniger vorkommen, wie Nigeria, Marokko oder Montenegro. Für eine Reportage über die Restitution der Benin-Bronzen wurde er 2023 für den Deutschen Reporter:innenpreis nominiert.
Davor hat er in München Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre studiert, über eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule fand er in den Journalismus. Er ist Mitgründer von Hermes Baby, einer Autorengemeinschaft, die sich der Weiterentwicklung des Erzähljournalismus in Deutschland widmet. Im Rahmen der Reporter-Akademie, die er nebenberuflich leitet, unterrichtet er die Grundlagen guten Erzählens im Journalismus. Er ist davon überzeugt: Geschichten können eine Ebene des Wissens vermitteln, die mit reinen Fakten nicht erreicht wird.
Über die Anderen
Spaß hat dieses Buch hoffentlich auch all jenen Journalistinnen und Journalisten gemacht, die dafür bereitwillig Auskunft über ihre Arbeit gaben, obwohl – oder gerade weil – sie nicht befürchten mussten, namentlich genannt zu werden. Für ihre Hilfe und ihren Humor sei ihnen allen, besonders aber Georg Löwisch, herzlich gedankt.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autoren
Über die Anderen
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Über dieses Buch
Konventionen in diesem Buch
Törichte Annahmen über die Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie es weitergeht
Teil I: Überblick
Kapitel 1: Wozu Journalismus gut ist
Was man unter Journalismus versteht
Wo der Journalismus herkommt
Was den Beruf des Journalisten ausmacht
Kapitel 2: Das ist guter Journalismus
Gute Journalisten wollen es genau wissen
Gute Journalisten behandeln Quellen sorgfältig
Gute Journalisten machen sich verständlich
Gute Journalisten stellen Zusammenhänge her
Gute Journalisten sind unabhängig
Gute Journalisten wecken Interesse
Kapitel 3: Das ist schlechter Journalismus
Schlechte Journalisten verbreiten Falsches
Schlechte Journalisten verlieren die Distanz
Schlechte Journalisten verleugnen sich selbst
Schlechte Journalisten pfeifen auf ihr Publikum
Schlechte Journalisten schüren Vorurteile
Schlechte Journalisten kennen keine Grenzen
Kapitel 4: Was Journalisten nicht dürfen
Die Presse und der Staat
Die Presse und die Bürger
Die Presse und die Promis
Teil II: Die Nachricht
Kapitel 5: Wo die Nachricht herkommt
Ein Tag bei der Zeitung
Nachrichtenagenturen als Sicherheitsnetz
Die Zeitung geht an den Start
Mittags wird es bei der Zeitung ernst
Abends läuft die Zeitung gegen die Uhr
Wir unterbrechen unser Programm …
Kapitel 6: Was die Nachricht wert ist
Die Dummies-Theorie der Nachrichtenbewertung
Eine Nachricht muss neu sein
Eine Nachricht muss wichtig sein
Eine Nachricht muss bewegen
Kapitel 7: Recherche
Mit Hintergrund ausrüsten
Das Recherche-Interview
Recherche vor Ort
Investigative Recherche
Kapitel 8: Nachrichten schreiben
Wie eine Nachricht aufgebaut wird
Die sieben W-Fragen
Wie eine Nachricht formuliert wird
Teil III: Journalisten als Geschichtenerzähler
Kapitel 9: Wie die besten Storys entstehen
Quellen der Inspiration
Aufhänger und Dreh
Der erfolgreiche Themenvorschlag
Kapitel 10: Geschichten und ihre Genres
Darstellungsformen der Wirklichkeit
Die Meldung
Die Reportage
Das Feature
Das Porträt
Der Korrespondentenbericht
Der Hintergrundbericht
Der Report
Das Interview
Visuelle Darstellungsformen
Kapitel 11: Wie eine Geschichte erzählt wird
Vor dem Schreiben
Der Einstieg
Der Hauptteil
Der Schluss
Die Sprache
Nach dem Schreiben
Kapitel 12: Hilfe vom Chatbot
ChatGPT
Recherche mit dem Chatbot
Die Schreibsekretäre
Die Bildkünstlerinnen
Grenzen des KI-Journalismus
Kapitel 13: Geschäfte mit Geschichten
Die Massenmedien und ihr Publikum
Die Presseverlage
Aufmerksamkeit ist Geld wert
Die Presselandschaft
Funk und Fernsehen
Das Internet
Teil IV: Journalisten als Meinungsmacher
Kapitel 14: Kommentare und Kampagnen
Ohne Umschweife die Meinung sagen
Reporter enthüllen Fehler im System
Journalisten als Themensetzer
Kapitel 15: Druck und Gegendruck
Die Machtlogik der Medien
Die Manipulation der Medien
Medienmacht als Wissenschaft
Die Machtlosigkeit der Medien
Teil V: Journalistenausbildung
Kapitel 16: Gefragte Eigenschaften
Gut kommunizieren können
Sammeln, Ordnen und Verstehen
Charakterstudien
Testen Sie sich selbst
Kapitel 17: Journalist werden
Erste Gehversuche
Journalist in Ausbildung
Kapitel 18: Als Journalist arbeiten
Wer ein Journalist ist
Das Innenleben der Redaktion
Einen Job ergattern
Was Journalismus einbringt
Topjobs im Journalismus
Verwandte Berufe
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 19: Zehn Wege zum Journalismus
Die klassische Journalistenschule
Die Verlagsschule
Das öffentlich-rechtliche Volontariat
Das Volontariat bei der Überregionalen
Das Volontariat bei der Regionalzeitung
Das Volontariat bei der Nachrichtenagentur
Kombination mit Tradition
Grundausbildung an der Uni
Journalistikstudium als Meisterklasse
Spezialstudium für Technikfreaks
Kapitel 20: Zehn Filme über Journalisten
Citizen Kane
Die verlorene Ehre der Katharina Blum
Die Unbestechlichen
Schreiendes Land
Nachrichtenfieber
Schtonk!
Der Insider
Good Night, and Good Luck
Spotlight
Bodkin
Kapitel 21: Zehn Journalistenpreise
Die Pulitzer-Preise
Der Theodor-Wolff-Preis
Der Stern-Preis
Der Reporter:innenpreis
Der Wächter-Preis der Tagespresse
Der Otto Brenner Preis
Der Grimme-Preis
Pressefoto des Jahres
Die schönsten Zeitungen der Welt
Deutscher Podcast Preis
Kapitel 22: Zehn Webseiten für Journalisten
ChatGPT
Spiegel.de
BBC
Wikipedia
Newsroom
BILDblog
DeepL
Perlentaucher
Bundesregierung im Netz
Glossar
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autoren
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Fangen Sie an zu lesen
Glossar
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
5
6
7
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
339
340
341
342
343
344
345
346
347
349
350
351
352
Einführung
Wenn Sie dieses Buch in die Hand nehmen, handeln Sie praktisch schon wie eine Journalistin oder ein Journalist: Respektlosigkeit ist eine journalistische Tugend, und ohne sie gäbe es Journalismus für Dummies nicht. Die Faszination, die der Journalistenberuf ausübt, fordert Skepsis geradezu heraus. Journalisten nehmen sich selbst oft ernster als die Sachverhalte, über die sie berichten. Es tut ihnen gut, wenn ihnen jemand auf die Finger schaut, und genau dabei hilft dieses Buch.
Denn das Schöne am Journalismus ist ja, dass er sich in der Öffentlichkeit abspielt. Alle dürfen mitreden, ob sie ihn studiert haben, beruflich ausüben oder ihm nur ausgesetzt sind. Ereifern Sie sich also ruhig darüber, dass die Presse zu tendenziös oder zu negativ ist. Nehmen Sie sich das Recht heraus, Journalisten zu kritisieren und ihnen ihre Fehler um die Ohren zu hauen.
Zu leicht will es Journalismus für Dummies den Skeptikern allerdings nicht machen. Denn so lästig die Medien auch sein mögen, so unverzichtbar und allgegenwärtig sind sie auch. Ein bisschen Sachverstand kann also gerade Kritikern des Journalismus nicht schaden. Ganz zu schweigen von Leuten, die selbst mit einer journalistischen Laufbahn liebäugeln: Es ist nützlich zu wissen, welche Untiefen auf einen warten, bevor man kopfüber ins Wasser springt.
Im Übrigen setzen sich Wissenschaftler seit Jahren ernsthaft mit Journalismus, Sprache und Medien auseinander. Es lohnt sich, ihre Werke zu lesen, vorausgesetzt, man hat die Zeit dazu. Sie wiederum haben es eilig? Dann handeln Sie ja schon wieder ganz wie ein Journalist.
Über dieses Buch
Journalismus ist kein staatlich geprüfter Beruf. Jeder kann sich auf seiner Visitenkarte als Journalist oder Journalistin bezeichnen. Nicht nur Zeitungsredakteure, auch Pressereferenten, Talkmaster oder Podcaster wenden bei ihrer Arbeit journalistische Kenntnisse an. Ein Buch über Journalismus könnte also leicht aus dem Ruder laufen. Einige sinnvolle Einschränkungen sind daher angebracht.
Was Journalisten wie und warum tun, wird am Beispiel der Zeitung dargestellt. Nicht weil die Zeitung das Medium der Zukunft ist, sondern weil jeder vor Augen hat, was gemeint ist, wenn von Zeitungsartikeln, Titelseiten und Schlagzeilen die Rede ist. Die meisten Informationen in diesem Buch lassen sich auf Zeitschriften, Rundfunk und Onlinejournale, ja mitunter sogar auf Social Media übertragen. Nur wenn es unbedingt nötig ist, gehen wir auf die Eigenheiten dieser anderen Medien ein.
Die Geschichte der Presse wird ebenso kursorisch behandelt wie Spezialgebiete des Journalismus. Die Kommunikationswissenschaft wird nebenbei erwähnt, nämlich dann, wenn gewisse Theorien so bedeutend sind, dass Sie von ihnen mal gehört haben müssen, um mitreden zu können. Wenn Ihnen dieses Buch stellenweise vorkommt wie eine Sendung mit der Maus für Erwachsene, ist das volle Absicht.
Ausführlich informieren wir über praktische Aspekte des Journalismus. Erfahren Sie,
weshalb Washington-Korrespondenten immer so dunkle Augenringe haben,
warum eine schlechte Nachricht aus Journalistensicht die bessere Nachricht ist,
welche Ausreden sich Pressesprecher ausdenken, um Journalisten abzuwimmeln,
was es beim Verfassen einer Bewerbungsreportage zu beachten gilt.
Zwar ist Journalismus für Dummies kein Lehrbuch im traditionellen Sinne. Es enthält jedoch viele praktische Tipps, ob für Interviews und Recherche oder zum Umgang mit der Presse. Selbst Profis werden womöglich noch den einen oder anderen nützlichen Hinweis entdecken. Gerade Journalisten wissen, dass sie nie aufhören dürfen zu lernen. Wer zur Selbstkritik nicht fähig ist, übt den Beruf nicht im Sinne des Erfinders aus.
Konventionen in diesem Buch
Keine Sorge: In diesem Buch verlangen wir an keiner Stelle von Ihnen, dass Sie mitschreiben oder irgendetwas auswendig lernen sollen. Wir wollten auch kein wissenschaftliches Werk schreiben – also erwarten Sie keine seitenlangen Zitate, einen Fußnotenteil oder einen voluminösen Anhang. Wir haben sogar auf die journalistische Grundregel verzichtet, zu jeder Information die Quelle anzugeben. Das fiel zwar schwer, doch anders wäre es kaum möglich gewesen, Ihnen in der gebotenen Kürze den Überblick zu bieten, den dieses Buch verspricht.
Zahlen nennen wir in Journalismus für Dummies immer dann, wenn dadurch Größenordnungen deutlich werden. Tabellen haben wir auf ein Minimum beschränkt. E-Mail-Adressen und Web-Adressen erkennen Sie daran, dass sie in dieser besonderen Schrift gedruckt sind. Fachbegriffe und Branchenjargon gebrauchen wir nur, wenn Sie sie im nächsten Moment entschlüsseln können. Im Interesse der Lesbarkeit und der Barrierefreiheit verwenden wir zwar das generische Maskulinum, stoßen Sie aber mit Doppelnennungen ständig darauf, dass Journalismus kein Beruf nur für Männer ist.
Törichte Annahmen über die Leser
Dass Sie gerade jetzt dieses Buch in der Hand halten, muss ja gute Gründe haben. Wir jedenfalls unterstellen Ihnen als Leserin oder Leser, dass Sie wenig Zeit und sicher noch andere Interessen haben. Der Journalismus muss sich Ihnen also förmlich aufgedrängt haben. Jetzt wollen Sie den Affen wieder loswerden. Dabei können wir helfen, das bilden wir uns jedenfalls ein.
Töricht wie wir sind, sind wir beim Schreiben dieses Buches außerdem davon ausgegangen, dass noch mindestens einer der folgenden Punkte auf Sie zutrifft:
Sie verfolgen die Nachrichten und greifen zuweilen zu einem Magazin.
Sie haben einen Sprössling, der plötzlich verkündet, er wolle Journalist werden.
Sie haben schon mit Presseleuten zu tun gehabt und sich über sie geärgert.
Sie verfassen heimlich oder gezwungenermaßen in Ihrer Freizeit manchmal Artikel.
Sie kennen die Autoren persönlich und wollen wissen, was die denn so schreiben.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Das Buch gliedert sich in sechs Teile, die originellerweise fortlaufend nummeriert sind. In den jeweiligen Teilen finden Sie folgende Inhalte:
Teil I: Überblick
Wie der an Eindeutigkeit kaum zu übertreffende Titel schon vermuten lässt, erhalten Sie hier erst einmal einen Überblick: In wirklich bündiger Form wird sichergestellt, dass Sie und wir unter dem Schlagwort Journalismus dasselbe verstehen. Und weil wir schon dabei sind, die Karten auf den Tisch zu legen: Sie erfahren in diesem Teil auch, was wir für guten und was wir für schlechten Journalismus halten.
Apropos schlechter Journalismus: Was Journalistinnen und Journalisten besser sein lassen, wird hier ebenfalls thematisiert. Nach dem Motto »Feind hört mit« erhalten Sie Tipps, wie Sie sich notfalls gegen die Medien zur Wehr setzen können – als wären Sie eine Prinzessin, die aus einem kleinen Fürstentum im Süden Frankreichs stammt und deren Name mit C beginnt.
Teil II: Die Nachricht
Journalistinnen und Journalisten handeln mit Informationen. Nachrichten sind ihr Kerngeschäft. Wer mitreden will, muss also wissen, wie eine Nachricht zustande kommt. In diesem Teil erfahren Sie das Notwendigste über den Produktionsprozess, von der Rohware Information bis zur Publikation. Wenn Sie sich öfters fragen, warum es manche Meldungen auf die Titelseite, die anderen nicht mal in den Lokalteil schaffen, werden Ihnen hier einige Lichter aufgehen.
Falls es Sie interessiert, können Sie außerdem einiges über Recherche lernen und darüber, wie man eine Nachricht formuliert. Alles keine Zauberei: Eignen Sie sich einfach die wichtigsten Regeln an, sammeln Sie ein paar Insidertipps ein und üben Sie so lange, bis Sie jeden Fehler mindestens einmal gemacht haben. Vor den vermeintlichen Profis müssen Sie sich dann bald nicht mehr verstecken, behaupten wir, und eine von uns beiden war immerhin lange Zeit selbst Nachrichtenjournalistin.
Teil III: Journalisten als Geschichtenerzähler
Wer öfters mit Profis zu tun hat, dem wird schon aufgefallen sein, dass Journalistinnen und Journalisten nicht etwa von Berichten oder Artikeln sprechen, wenn sie über ihre Arbeit reden. Ihre Welt besteht aus Geschichten, womit keineswegs gemeint ist, dass deren Inhalt erfunden ist. Sie sollen nur so spannend erzählt sein, dass das Publikum von Anfang bis Ende gefesselt ist.
In diesem Teil werden Sie auf schonende Weise in die Fachsprache des Journalismus eingeweiht. Wer schreiben will, erhält einige Tipps für die ersten Gehversuche. Sie erfahren, wie Sie Künstliche Intelligenz dabei als Hilfe nutzen können – und wo die Grenzen der Technologie liegen. Für prosaischer eingestellte Leser gibt es Informationen, wie das Geschäft mit den Geschichten funktioniert. Wer die wichtigsten Player im Mediengeschäft sind, wie sich Zeitungen und Onlinejournale rechnen und wie viel Geld dabei im Spiel ist – die wichtigsten Zahlen und Fakten erfahren Sie hier.
Teil IV: Journalisten als Meinungsmacher
Harte Fakten sind im Journalismus nicht alles. Mindestens genauso wichtig sind Meinungstexte wie Glosse, Leitartikel und Kommentar. Die wiederum bilden nur die Spitze des Eisbergs. Denn auch unter der Oberfläche tun Journalistinnen und Journalisten einiges, um die öffentliche Debatte zu beeinflussen. Das betrachten sie nicht nur als ihr gutes Recht, sondern als ihren Auftrag in der Demokratie.
Wenn Sie gerne über Journalismus streiten, erhalten Sie in diesem Teil jede Menge Material. Aber seien Sie gewarnt: Dabei werden sich auch einige lieb gewonnene Argumente als stumpf erweisen. Dass die Medien allmächtig sind, wird in diesem Teil ganz gehörig infrage gestellt. Denn auch die andere Seite, sprich Politik und Wirtschaft, rüstet kräftig nach. Nur gut, dass die Journalisten ihr dabei allmählich auf die Schliche kommen, wie dieses Buch immerhin beweist.
Teil V: Journalistenausbildung
Wer in Erwägung zieht, selbst Journalistin oder Journalist zu werden, der sollte sich in diesen Teil vertiefen. Wir behaupten einfach, dass Sie nirgendwo sonst derart kompakte Informationen erhalten, um zu entscheiden, ob Sie dem Thema nähertreten wollen oder nicht. Es geht dabei weder darum, den Beruf zu glorifizieren, noch Sie von einer journalistischen Laufbahn abzuschrecken. Wir haben einfach aufgeschrieben, was die Erfahrung uns gelehrt hat. Dabei ist sicherlich nicht ganz unerheblich, dass eine von uns beiden inzwischen Leiterin einer Journalistenschule ist.
Auch für Leser, die gar nicht die Absicht haben, sich beruflich zu verändern, hat dieser Teil einiges zu bieten. Denn wer wüsste nicht gerne, wie der Alltag eines Modeberufs so aussieht, nicht zuletzt, wie viel man dort verdient. Wenn Sie außerdem zu den Leuten gehören, die in den Hochglanzzeitschriften immer zuerst den Test ausfüllen, ist hier für Ihr Amüsement gesorgt.
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Für versierte … für Dummies-Leser ist dieser Teil nichts Neues. Er stellt noch einmal kurz und übersichtlich die besten Wege in den Journalismus vor. Es wird verraten, welche Websites Journalisten und Journalistinnen gerne bei der Recherche benutzen. Für Kinofreaks gibt es eine Liste mit Filmen über Journalismus, die Sie garantiert noch nicht alle gesehen haben. Und wer nach den Sternen greifen will, der kann sich die Liste mit renommierten Journalistenpreisen ansehen.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Sie finden über das ganze Buch verteilt verschiedene Symbole, über deren Bedeutung wir Sie hier kurz aufklären:
Wenn Sie dieses Symbol sehen, heißt das, dass es sich hier um einen praktischen Tipp handelt, der Ihnen den Umgang mit dem Journalismus erleichtern kann.
Hinter diesem Symbol verbirgt sich eine Erklärung oder eine Definition von neu eingeführten Fachbegriffen.
Bei diesem Symbol ist Vorsicht geboten. Es könnte ein Stolperstein auf dem Weg liegen, vor dem wir Sie gerne warnen möchten.
Dreimal dürfen Sie raten, was Sie bei diesem Symbol erwartet – richtig, ein übersichtliches Beispiel zum jeweiligen Thema.
Hier wird aus dem Nähkästchen geplaudert. Kleine Anekdoten sollen zum Schmunzeln oder Stirnrunzeln anregen, sind für das Gesamtverständnis aber nicht nötig.
Wie es weitergeht
Dieses Buch ist so aufgebaut, dass Sie es nicht zwingend wie einen Roman von vorn nach hinten durchlesen müssen. Wollen Sie zum Beispiel wissen, wie man einen erfolgreichen Themenvorschlag macht, können Sie direkt und ohne Umwege Kapitel 9 aufschlagen. Sie werden dort alles verstehen, auch ohne Kapitel 1 bis 8 gelesen zu haben.
Wenn Sie sich also nur für ein bestimmtes Thema interessieren, dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis oder in das Stichwortverzeichnis. Wie und in welcher Reihenfolge Sie was lesen und warum, liegt ganz bei Ihnen. Wenn Sie das Buch doch von vorn bis hinten durchlesen möchten, sind wir Ihnen auch nicht böse. Ob Sie selbst in den Journalismus streben oder sich nur gegen Besserwisser zur Wehr setzen wollen: Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Teil I
Überblick
IN DIESEM TEIL …
Sich mit Journalismus zu beschäftigen ist ein bisschen, wie sich auf ein neues Kartenspiel einzulassen. Jeder hat schon mal 52 Spielkarten in der Hand gehabt, aber auf die Regeln müssen sich die Mitspielenden erst einmal verständigen.
In diesem Teil wird das Blatt offen auf den Tisch gelegt. Sie erfahren, was man unter Journalismus versteht, wie er entstanden ist und wozu er gut sein soll. Zu den Spielregeln, die man kennen muss, gehört auch zu wissen, wie viel die einzelnen Karten wert sind, was man also unter gutem oder schlechtem Journalismus versteht. Kapitel 4 schließlich handelt davon, was im Journalismus keinesfalls erlaubt ist.
Kapitel 1
Wozu Journalismus gut ist
IN DIESEM KAPITEL
Informieren, Bewerten, UnterhaltenDie Macht des PublikumsDer erste JournalistJournalismus lauert im Alltag an jeder Ecke.
Die Schlagzeile auf der Startseite des E-Mail-Portals. Die Modezeitschrift im Wartezimmer. Die Instagram-Story des Enthüllungsjournalisten. Das Ratespiel aus dem Autoradio. Das Blättchen, das die Apothekerin mit in die Tüte packt. Der Zeitungsstapel im Altpapiercontainer. Die gerunzelte Stirn auf dem Fernsehschirm. Das Laufband am Times Square in New York.
Nachrichten wollen gelesen, Interviews gehört, Kommentare angeklickt und Talkshows gesehen werden. Information, Meinung und Unterhaltung in riesiger Auswahl. Mancher findet im Überfluss, würde den Fernseher am liebsten zum Sondermüll bringen, seine Social-Media-Accounts kündigen oder das Zeitungsabonnement loswerden.
Dieses Kapitel stellt einige Thesen darüber auf, was Journalismus ist, wie er zustande kommt und wer davon etwas hat. Natürlich nicht objektiv, denn wir gehören selbst zum Gewerbe. Aber wie viele Journalisten grübeln wir oft über Sinn und Unsinn unseres Berufs.
Was man unter Journalismus versteht
Journalismus ist, was Journalisten und Journalistinnen tun. Diese Definition liegt nahe und ist doch unvollständig. Schließlich recherchieren und berichten Redakteure nicht im luftleeren Raum. Ihre Erzeugnisse existieren als journalistische Leistung nur, wenn sie ein Publikum erreichen. Dieses Publikum reagiert, kritisiert, applaudiert und ignoriert – während gleichzeitig über es berichtet wird.
Journalismus besteht nicht nur aus Berichterstattung über Politik. Unterhaltung und Service gehören genauso zum Metier.
Auch der Übertragungsweg spielt beim Zustandekommen von Journalismus eine entscheidende Rolle. Ohne die Medien stünden Journalisten da wie Redner, denen der Ton abgedreht wurde. Der Medientheoretiker Marshall McLuhan meinte sogar, dass die journalistischen Inhalte im Vergleich zur technologischen Entwicklung völlig unwichtig seien. »Das Medium ist die Botschaft«, verkündete er.
Zahlen und Fakten über das Publikum
Deutsche nutzen die Massenmedien im Schnitt rund elf Stunden am Tag, das Internet, Musikstreaming, Kino und Bücher eingeschlossen. Das heißt jedoch nicht, dass sie ihnen tatsächlich mehr als die Hälfte ihrer wachen Zeit ihre volle Aufmerksamkeit schenken. Denn da die Leute ja auch noch arbeiten und essen müssen, verfolgen sie oft nur mit halbem Ohr, was im Radio oder Fernsehen läuft. Oder sie swipen beim Bahnfahren beiläufig durch ihre Instagram-Storys.
Deutsche lesen im Schnitt täglich 15 Minuten lang Zeitung oder Zeitschriften – meist morgens am Frühstückstisch oder auf dem Weg zur Arbeit.Rund 35 Millionen Menschen in Deutschland nehmen täglich eine Tageszeitung in die Hand, fast die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung. Die Reichweite unterscheidet sich nach Altersgruppen. Trotz Studentenabos und Jugendseiten wird das Zeitungspublikum im Durchschnitt immer älter. Weniger als ein Drittel der Jugendlichen liest regelmäßig eine Zeitung. Über 60 Prozent sind mindestens 50 Jahre alt.Das Radio läuft in deutschen Haushalten gute drei Stunden am Tag, exakt 179 Minuten. Genutzt wird es vor allem tagsüber. Die wichtigste Sendezeit, neudeutsch auch Primetime genannt, ist vormittags zwischen 8 und 12 Uhr. Rund drei Viertel der Deutschen schalten täglich das Radio ein.Kein Massenmedium wird so intensiv genutzt wie das Fernsehen. In den deutschen Haushalten läuft der Apparat im Schnitt mehr als drei Stunden am Tag. Nimmt man Bewegtbilder im Allgemeinen dazu (etwa in Form vom Internetvideos oder Videospiele), sind es sogar fast sechs Stunden. Der höchste Fernsehkonsum wird abends gemessen. Deutschlandweit gibt es 62 Millionen angemeldete Fernsehgeräte. Praktisch jeder Deutsche hat Zugang zum TV-Programm.Die Zeit, die Deutsche im Internet verbringen, nimmt rasant zu. Waren es 2019 noch 109 Minuten pro Tag, sind es 2023 schon 190 Minuten, also mehr als drei Stunden. Rund 67 Millionen Menschen hierzulande nutzen das weltweite Datennetz. Die Internetnutzung verteilt sich gleichmäßig über den Tag. Auch am Arbeitsplatz ist der Computer oft eingeschaltet.Die Möglichkeiten der Kommunikation im Internet haben die Diskussion darüber, wer sich eigentlich als Journalist bezeichnen darf, neu beflügelt. Content Creators, Blogger und andere Kommentatoren fordern die Pressefreiheit auch für sich. Sie plädieren daher für einen weit ausgelegten Journalismusbegriff.
Die Bloggerin Rachel Blood kommentierte diese Debatte lakonisch mit den Worten:
Mit dem Journalismus, so scheint es, verhält es sich wie mit der Pornografie. Die exakte Definition hängt vom Betrachter ab, aber im Allgemeinen erkennt man ihn auf Anhieb.
Der Presseausweis macht noch keinen Journalisten
Journalist ist in Deutschland keine geschützte Berufsbezeichnung. Gewerkschaften und Verlegerverbände geben jedoch an ihre Mitglieder einen Ausweis heraus, der ihnen die Zugehörigkeit zur Presse bescheinigt. Auch Nichtmitglieder können das Dokument im Scheckkartenformat gegen eine Gebühr erhalten, solange sie ihre hauptberufliche Tätigkeit als Journalist nachweisen können. Der Ausweis gilt jeweils ein Jahr und wird auch Journalistikstudierenden und Volontären gewährt. Aussteller sind die Gewerkschaften, Journalisten- und Verlegerverbände. Der Presseausweis kann helfen, Polizeiabsperrungen zu überwinden und zu Veranstaltungen zugelassen zu werden. Außerdem ermöglicht er Rabatte, etwa beim Besuch eines Museums. Pressevertreter sollten sich allerdings genau überlegen, ob sie solche Rabatte überhaupt in Anspruch nehmen. Wie Vergünstigungen schlechten Journalismus hervorbringen, erfahren Sie in Kapitel 2.
Gesellschaft im Selbstgespräch
Bezieht man die Rolle des Publikums und der Medien mit ein, gelangt man zu einer breiteren Definition: Journalismus ist das Gespräch der Gesellschaft über sich selbst. So ähnlich formulierte es 1845 schon der Literaturwissenschaftler Robert Eduard Prutz, der seinerzeit wegen Majestätsbeleidigung angeklagt wurde, weil er das Herrschaftssystem in Deutschland satirisch aufs Korn genommen hatte.
An dieser Unterhaltung sind wir alle beteiligt. Bewusst oder unbewusst verhandeln wir darüber, was erlaubt und was verboten, was belanglos und was bedeutend ist. Damit 83 Millionen Menschen sich über solche Fragen nicht täglich persönlich unterhalten müssen, gibt es Nachrichten und Leitartikel, Quizsendungen und Reality-TV.
Journalistinnen und Journalisten sind also nichts anderes als Dienstleister.
Sie speisen neue Informationen ins Gespräch ein.
Sie lenken Aufmerksamkeit auf ein Thema.
Sie moderieren den öffentlichen Diskurs.
Sie wecken Gefühle und befeuern Debatten.
Sie weisen auf Grenzüberschreitungen hin.
Sie ermöglichen das Austesten von Grenzen.
Damit sie diese höchst unterschiedlichen Leistungen erbringen können, müssen Journalisten vertrauenswürdig sein. Ihr Publikum muss nachvollziehen können, welche Aufgabe sie gerade wahrnehmen. Diese Klarheit hängt von der Einhaltung der Regeln ab, die sich der Berufsstand auferlegt hat.
Fakt ist nicht gleich Fiktion
Jeder weiß aus zahllosen Gesprächssituationen, wie wichtig der Unterschied zwischen Fakten und Fiktion ist. Auch Journalisten müssen offenlegen, wann sie über tatsächliche Geschehnisse berichten und wann über Annahmen, die sich bewahrheiten können oder auch nicht. Gerade in Zeiten von Fake News ist es wichtig, dass sich Qualitätsmedien strikt an gewisse Standards halten, um das Vertrauen ihrer Leserschaft nicht zu verspielen.
Fotomontagen müssen in der Zeitung klar als solche benannt werden. Bilder stimulieren Gefühle weit stärker als ein Text, sodass die Manipulation eines Fotos zugleich die Manipulation von Gefühlen bedeutet. Weil diese Regel nicht konsequent genug gehandhabt wird, lässt die Glaubwürdigkeit von Fotos insgesamt nach.
Ob es um Fakten oder Fiktion geht, erkennt das Publikum übrigens auch am Format. Nur Leute mit stark gestörtem Wahrnehmungsvermögen verwechseln Computerspiele und Realität. Auch die Leser der Regenbogenpresse ahnen zumindest, dass sie dort verbreitete Neuigkeiten über Promis nicht ganz ernst nehmen müssen.
Von der Tagesschau erwarten die Zuschauer, dass sie von Tatsachen handelt. In Krisenzeiten, wenn dringender Informationsbedarf besteht, steigt daher die Einschaltquote der ARD-Nachrichtensendung, die sonst von vielen als zu trocken empfunden wird.
Meinung ist nicht gleich Information
Journalismus ist immer wertend. Je mehr Informationen zur Verfügung stehen, desto wichtiger wird es, die Dinge zu entzerren und zu vereinfachen. Wer Zeitung liest, nutzt wie selbstverständlich den Service, dass ein Journalist für ihn die Topnachrichten ausgewählt, Schwerpunkte gesetzt und weniger Wichtiges aussortiert hat.
Zwischen Einordnung von Fakten und Meinungsmache besteht jedoch ein himmelweiter Unterschied. Die öffentliche Auseinandersetzung verläuft störungsfreier, wenn die Teilnehmer wissen, ob sie es gerade mit einer Meinungsäußerung oder mit einer neu eingespeisten Information zu tun haben.
Beziehen Journalisten in einer Debatte eindeutig Position, sollten sie das ihrem Publikum unmissverständlich mitteilen. In der Zeitung sind Kommentare deshalb immer an der gleichen Stelle und zum Teil in einer anderen Schriftart als die Nachrichten zu finden.
In den USA wird zwischen Meinungs- und Nachrichtenredaktionen weitaus schärfer getrennt als in Deutschland. Eine Gerichtsreporterin der New York Times wurde von ihren Chefs abgemahnt, weil sie bei einem Vortrag ihren Standpunkt in Streitfragen zu erkennen gab, die vor dem Obersten Gerichtshof anhängig waren.
Ende einer Hexenjagd
Von Zeit zu Zeit erfüllen Journalisten ihre Aufgabe so gut, dass daraus ein Lehrstück für die Nachwelt entsteht. Ein Beispiel dafür lieferte der amerikanische Reporter Edward Murrow. Während des Zweiten Weltkriegs berichtete er als Radiokorrespondent aus London über die Standhaftigkeit der britischen Bevölkerung während der deutschen Bombardements. Danach kehrte er in die USA zurück und startete See It Now, eine politische Magazinsendung im US-Fernsehen.
Murrows Meisterstück war eine Sendung, in der er dem berüchtigten Senator Joe McCarthy das Handwerk legte. McCarthys Hexenjagd auf vermeintliche Kommunisten drohte in den 1950er-Jahren die Meinungsfreiheit in den USA in ihren Grundfesten zu erschüttern. Bei Anhörungen, die stundenlang im Fernsehen übertragen wurden, forderte der Senator die Zeugen auf, »Rote« in ihrer Umgebung zu denunzieren. In Hollywood setzten die Studios in Verdacht geratene Schauspieler und Regisseure in vorauseilendem Gehorsam auf eine »Schwarze Liste«. Manche so drangsalierte Menschen begingen Selbstmord.
Die Öffentlichkeit in den USA war in ihrer Einstellung zu McCarthy gespalten. Murrow genoss über die Parteigrenzen hinweg großes Ansehen. Er zögerte lange, bevor er öffentlich Position bezog. Schließlich tat er es mit bestechender Schlichtheit, indem er die geifernden Auftritte des Senators kommentarlos zusammenschnitt. McCarthy diskreditierte sich auf diese Weise selbst und musste seine Kampagne nicht lange danach aufgeben, wie im Film Good Night, and Good Luck zu sehen ist.
Seine Sendung schloss Murrow mit einem selbstanklägerischen Kommentar. McCarthy habe das herrschende Klima der Angst in den USA nicht selbst erzeugt, sondern nur geschickt ausgenutzt. Die Gesellschaft habe sich selbst an einen Abgrund manövriert. »Die Schuld, lieber Brutus, liegt nicht in den Sternen, sondern in uns selbst«, zitierte er Shakespeare. Und endete mit seiner charakteristischen Grußformel: »Gute Nacht, und viel Glück.«
Avantgarde und Mainstream
Damit sich die Gesellschaft effektiv mit sich selbst unterhalten kann, muss der Journalismus frei sein. Bestimmt der Staat, worüber geredet werden darf, wird das Gespräch einseitig. Es dreht sich im Kreis oder verstummt. Gerüchte können nicht mehr entkräftet werden. Regeln werden nicht mehr überprüft, Fehlentwicklungen nicht mehr korrigiert.
In der Demokratie haben Journalistinnen und Journalisten die Aufgabe, Politik zu hinterfragen, innovative Vorschläge zu erläutern und immer wieder neue Formen von Kommunikation zu erfinden. Sie sind gleichzeitig Teil der Avantgarde und des Mainstreams, denn indem sie die ständige Erneuerung des Systems ermöglichen, tragen sie zum Systemerhalt bei.
Journalismus für alle
Journalismus ist nicht nur etwas für Leute, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Er beruht auf einer Geisteshaltung, die jedem wachen Bürger und jeder wachen Bürgerin gut ansteht. Sie besteht aus Neugier, gepaart mit einer gewissen Skepsis. Journalisten suchen nach Informationen und ziehen daraus Schlüsse. Sie wollen aufdecken, wachrütteln und Ereignisse in einen Zusammenhang stellen.
Recherchieren, Vermitteln und Einordnen sind Fähigkeiten, mit denen jeder etwas anfangen kann.
Wer eine Urlaubsreise buchen will, muss recherchieren, welche Auswahl er hat. Bevor er bei einem Veranstalter anruft oder eine Reservierung auf einer Website tätigt, muss er sich im Klaren darüber sein, welche Informationen er braucht, um seine Wahl zu treffen.
Das Alltagsleben erfordert die Fähigkeit, sich klar und knapp auszudrücken. Das gilt für Bewerbungsschreiben ebenso wie für Beschwerdebriefe.
Bevor Wähler ihre Stimme abgeben, müssen sie sich über die Pläne und Ansichten der Kandidaten informieren und diese dann einordnen können. Die schönsten Versprechen sind nichts wert, wenn ihre Einhaltung illusorisch ist oder wenn der Politiker, der sie macht, als Aufschneider bekannt ist.
Wo der Journalismus herkommt
Die Ursprünge des Journalismus gehen bis in die Antike zurück. Lange bevor die erste Zeitung gedruckt wurde, gab es Barden und Herolde, Philosophen und Spione. Eine Mischung aus diesen Strömungen prägt den Journalismus heute mehr denn je.
Der griechische Historiker Thukydides (etwa 460 bis 399 vor Christus) achtete in seiner Geschichte des Peloponnesischen Krieges peinlich darauf, Mythen und Realität zu trennen. Er schrieb nur auf, was er selbst erlebt hatte oder was ihm von möglichst mehreren zuverlässigen Augenzeugen geschildert worden war. Sein Buch war so gesehen keine geschichtliche Abhandlung, sondern ein aktueller Bericht, weshalb Thukydides mit Fug und Recht als erster Journalist bezeichnet wird.
Julius Caesar und die Barden
Aktuelle Veröffentlichungen zum Tagesgeschehen entstanden im Römischen Reich schon zu Zeiten von Julius Caesar. Handschriftliche Amtsblätter wurden in Rom und den Provinzen angeschlagen. Sie enthielten Proklamationen und Entscheidungen des Senats, Militärnachrichten, Resultate von Volksabstimmungen, Ergebnisse von Gladiatorenkämpfen, astrologische Vorhersagen sowie Kunde von Hochzeiten, Geburten, Todesfällen, Gerichtsprozessen und Hinrichtungen.
Im Mittelalter lag das schriftliche Festhalten von Informationen fest in der Hand der Kirche. Nur die wenigsten Menschen konnten lesen und schreiben. Wichtige Nachrichten wurden mündlich unters Volk gebracht. Herolde verkündeten die offizielle Linie auf den Marktplätzen. Barden zogen mit Liedern über wichtige Vorkommnisse von Ort zu Ort. Erst als in der Neuzeit der Handel florierte und der Buchdruck erfunden war, wurden die ersten Zeitungen in Umlauf gebracht.
Die Geburt der Reportage
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts berichtete Heinrich Heine für die Augsburger Allgemeine Zeitung aus Paris. In seinen Artikeln beschrieb er die »französischen Verhältnisse« mit viel Liebe zum Detail. Reportageelemente wechselten sich bei Heine mit analytischen Passagen ab.
Auch der legendäre Kriegsreporter William Howard Russell, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für die Londoner Times über den Krimkrieg berichtete, begnügte sich nicht mit der Wiedergabe von Fakten. Seine Schilderung des verlustreichen Angriffs einer britischen Kavallerieeinheit auf die russischen Stellungen von Sewastopol triefte vor Pathos und wertenden Adjektiven.
Der Kampf um die Pressefreiheit
Autoritäre Systeme fürchten Veränderungen. Als die Französische Revolution in Deutschland einen Zeitungsboom auslöste, verschärften die deutschen Teilstaaten die bisher laxe Handhabung der Zensur. In den Karlsbader Beschlüssen setzte Fürst Metternich 1819 für alle deutschen Lande ein einheitliches Zensursystem durch. Liberale Pressegesetze in Teilstaaten wie Württemberg oder Baden wurden kassiert.
Zensur findet statt, wenn staatliche Stellen die Vorauswahl treffen, ob ein Artikel, ein Buch oder ein Film überhaupt erscheinen darf. In Deutschland wurde diese Art von Vorzensur zuerst von der Kirche praktiziert, die damit verhindern wollte, dass abweichende theologische Deutungen verbreitet wurden. In Kriegszeiten rechtfertigen Staaten die Kontrolle von Nachrichten heute noch damit, dass dem Gegner militärisch wichtige Informationen vorenthalten werden müssten.
Je schärfer die Repression, desto lauter forderten Reformer und Revolutionäre die Freiheit der Presse. 1848 wurde die Vorzensur in der Paulskirchen-Verfassung offiziell abgeschafft.
Ein Deutscher in Amerika
Während in Deutschland die Pressefreiheit noch nicht einmal auf dem Papier stand, erzielte ein deutscher Einwanderer in den USA den Durchbruch für die freie Presse. Der Drucker John Peter Zenger ging 1734 acht Monate ins Gefängnis, weil seine Zeitung, das New York Weekly Journal, den Gouverneur der britischen Kolonie heftig kritisiert hatte. Die Anklage lautete aufrührerische Verleumdung, und ein Freispruch schien unmöglich, nachdem Zenger vor Gericht zugegeben hatte, die beleidigenden Passagen gedruckt und veröffentlicht zu haben.
Dass der deutsche Einwanderer trotzdem freigesprochen wurde, lag am genialen Plädoyer seines Verteidigers. Andrew Hamilton argumentierte, es hänge vom Wahrheitsgehalt der Artikel ab, ob eine Verleumdung vorliege oder nicht. Die Bürger müssten das Recht haben, die Wahrheit über ihre Regierung zu sagen. Die Geschworenen sprachen Zenger frei. Bis heute sind Verleumdungsklagen in den USA nur erfolgreich, wenn die Kläger nachweisen können, dass die über sie verbreitete Information tatsächlich falsch war.
Bismarcks Reptilienfonds
Die uneingeschränkte Pressefreiheit blieb in deutschen Landen auch nach 1848 lange ein schöner Traum. Denn in der Realität ließen sich die Mächtigen einiges einfallen, um Verleger und Journalisten unter Kontrolle zu behalten. Wer eine Zeitung herausbringen wollte, musste ab 1850 eine hohe Kaution für »eventuelle Pressevergehen« hinterlegen.
1866 richtete Bismarck seinen berüchtigten Reptilienfonds ein: Um seine politischen Gegner zu bekämpfen, schmierte er regierungstreue Blätter und zettelte Pressekampagnen an. 1874 wurde zwar ein liberales Reichspressegesetz beschlossen. Doch andere Regelungen, wie das Sozialistengesetz von 1878, schränkten die dort verankerte Pressefreiheit flugs wieder ein.
Der Krieg bringt die Zensur zurück
Im Ersten Weltkrieg wurde die Zensur in Deutschland wieder eingeführt. Das Kriegspresseamt gab ein Zensurbuch mit immer wieder neuen Bestimmungen und Verboten heraus. Die Kriegsberichterstattung der Zeitungen bestand im Wesentlichen aus Propagandameldungen. Selbst Feldpostbriefe wurden zensiert. Erst Jahre nach dem Ersten Weltkrieg erfuhren die Menschen vom ganzen Ausmaß des Grauens. Ein Ausspruch des griechischen Tragikers Aischylos hatte Konjunktur:
Im Kriegist die Wahrheit das erste Opfer.
Die Weimarer Verfassung verbriefte das Recht auf freie Meinungsäußerung. Die Zeitungslandschaft blühte. In ihr gediehen legendäre Journalisten wie Kurt Tucholsky, Egon Erwin Kisch und Theodor Wolff ebenso wie das Zeitungsimperium des rechtsnationalen Verlegers Alfred Hugenberg. Die Nationalsozialisten machten beidem ein Ende: Ab 1933 wurde die Presse gleichgeschaltet. Nach und nach wurden Tageszeitungen und Wochenblätter geschlossen, bis nur noch die nationalsozialistische Parteipresse übrig war, gefüttert vom Propagandaapparat von Joseph Goebbels.
Auch wenn sich die Pressefreiheit in demokratischen Ländern weitgehend durchgesetzt hat, wird sie immer wieder herausgefordert. Die Organisation Reporter ohne Grenzen berichtete 2021 von einer ansteigenden Zahl an Angriffen auf Journalisten in Deutschland, die sich im Rahmen der Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen ereigneten. Einschüchterungen wie diese sind eine Gefahr für die Pressefreiheit: Wenn sich Journalistinnen nicht trauen zu schreiben, was sie eigentlich zu berichten haben, setzt die Schere schon im Kopf an.
Was den Beruf des Journalisten ausmacht
In der gesellschaftlichen Debatte spielen Journalisten und Journalistinnen eine wichtige Rolle. Dasselbe gilt aber auch für Lehrer, Historiker, Politikerinnen, Schriftsteller und andere Meinungsführerinnen. Was unterscheidet den Beruf des Journalisten von anderen Professionen? Dass er bei der Arbeit immer mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen muss. Diese Eigenschaften machen den Journalistenberuf aus:
öffentlich
distanziert
wirklichkeitsnah
verständlich
aktuell
Der Fluch der Öffentlichkeit
Dass sich die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten in der Öffentlichkeit abspielt, unterscheidet sie nicht nur von Tagebuchschreibern, deren Gedanken nie jemand anderes erfährt. Es verhindert auch, dass sie sich ungestraft die Rolle völlig neutraler Beobachter anmaßen können. Die wünschenswerte Distanz zu den Verhältnissen, über die sie berichten, müssen Journalisten ständig aufs Neue künstlich herstellen. Oder sie geben offen zu, wie sie selbst verwickelt oder betroffen sind.
Die Früchte ihrer Recherchen öffentlich zu machen, bedeutet für Journalisten, sich ständig der Kritik anderer auszusetzen. Was in der Zeitung steht oder im Fernsehen kommt, wird kommentiert, ob am Stammtisch, in den Leserbriefspalten oder im Internet. Weist ein Artikel einen Fehler oder eine Lücke auf, findet sich rasch ein Experte aus dem Publikum, der den Finger auf die Wunde legt.
Während Journalisten sich über Kritik aus dem Publikum oft mokieren, reagieren sie empfindlich auf Kommentare der Mächtigen. Denn die wehren sich, wenn sie sich von der Berichterstattung auf den Schlips getreten fühlen – ob sie nun mit der Stornierung von Anzeigen drohen, eine Gegendarstellung verlangen, auf Unterlassung klagen oder den Journalisten vom Informationsfluss ausschließen. Ein Beispiel dafür war Exbundeskanzler Helmut Kohl, dessen Fehde mit dem Spiegel in Kapitel 15 noch genauer beleuchtet wird.
Der Zensor auf dem Interviewsessel
Für angelsächsische Journalisten ist es eine der Merkwürdigkeiten des deutschen Mediensystems: die Autorisierung von Interviews durch den Interviewten. Sie wird von Politikern oft genutzt, um ihre Äußerungen zu korrigieren oder zu entschärfen. Häufig zögern die Interviewten dabei die Vorlage ihrer Änderungswünsche so lange wie möglich hinaus. Die Zeitungen stehen dann kurz vor dem Redaktionsschluss vor der Wahl, eine zensierte Fassung entweder zu akzeptieren oder auf die Veröffentlichung des Interviews ganz zu verzichten.
Die Autorisierung von Interviews hat einen positiven Hintergedanken: Politiker würden sich im Gespräch offener äußern, wenn sie hinterher noch einmal Gelegenheit hätten, die eigenen Worte nachzulesen, lautete die ursprüngliche Hoffnung. Zudem gab das Verfahren den Journalisten mehr Freiheit, Fragen und Antworten zu straffen und langweilige Passagen zu streichen. Die bekannteste Form des durchkomponierten Interviews ist das Spiegel-Gespräch. Es soll eine Diskussion zwischen Redakteuren und Politikern widerspiegeln und wird daher stets autorisiert.
Journalisten sind weder rechtlich noch presse-ethisch dazu verpflichtet, Zitate vor der Veröffentlichung vom Gesprächspartner absegnen zu lassen. Haben sie sich jedoch einmal auf eine Autorisierung eingelassen, gibt es kein Zurück mehr. Keinesfalls sollten sich Zeitungen darauf einlassen, dass nicht nur ihre Antworten, sondern auch die Fragen redigiert werden. Um nicht erpressbar zu sein, muss die Redaktion zudem immer einen Ersatztext parat haben, für den Fall, dass ein Interview in letzter Minute bis zur Unkenntlichkeit korrigiert oder zusammengestrichen wird.
Im Schatten der Werbung
Journalisten und Journalistinnen machen Zeitung, aber nicht alles, was in der Zeitung steht, ist Journalismus. Bestes Beispiel sind die Anzeigen, die vor allem auf den Homepages mitunter gar nicht so viel anders ausschauen wie ein redaktioneller Text. Magazinseiten, auf denen Models die neuesten Kollektionen vorführen, werden von Redakteuren produziert. Dass die Leser dort auch erfahren, wo es den Mantel zu kaufen gibt und wie viel er kosten soll, ist Werbung für den Hersteller. Aus Sicht der Redaktion steckt jedoch auch eine journalistische Leistung dahinter: Der Mantel musste ausgewählt, die Information recherchiert und die Fotostrecke in Szene gesetzt werden.
Werbung ist gewissermaßen die Erbsünde des Journalismus. Journalisten sind von ihr abhängig, denn durch die Werbeeinnahmen ihrer Arbeitgeber verdienen sie ihr Brot. Und doch verschmäht jeder aufrechte Journalist die Werbung wie einen giftigen Apfel. Denn wer für ein Produkt, eine Partei oder eine Idee wirbt, droht das Vertrauen des Publikums zu verspielen.
Journalisten grenzen sich deshalb in ihrem Selbstverständnis klar von Werbeleuten und Öffentlichkeitsarbeitern ab. Anstatt die Anliegen eines Unternehmens oder einer Institution zu verkaufen, sehen sie sich im Idealfall ausschließlich dem öffentlichen Interesse verpflichtet. Sie berichten, erzählen und sprechen nicht im Dienste ihres Arbeitgebers und höchstens am Rande über sich selbst.
Diese Berufung sorgt nicht selten für Konflikte zwischen Redakteuren und Verlegern. Ihr treu zu bleiben, erfordert eine ständige Gratwanderung zwischen kurzfristigen Geschäftsinteressen und ethischen Prinzipien. Langfristig sichert diese Trennung zwischen der sogenannten Öffentlichkeitsarbeit und dem Journalismus aber das Vertrauen des Publikums und damit auch den Erhalt des Mediengeschäfts.
Auf der Suche nach der Wahrheit
Anders als Dichter befassen sich Journalistinnen und Journalisten mit Dingen, die tatsächlich passiert, gesagt oder gedacht wurden. Sie handeln mit Fakten, ob sie distanziert berichten, subjektiv erzählen oder spitz kommentieren. Ihre Behauptungen müssen nachprüfbar sein, weshalb sie tunlichst immer ihre Quellen angeben sollten.
Weil journalistische Werke auf Fakten beruhen, beschäftigen sich Journalisten einen großen Teil ihrer Arbeitszeit damit, Behauptungen und Vermutungen zu prüfen. Dieser Teil ihrer Tätigkeit wird Recherche genannt. Ob dabei die Wahrheit herauskommt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Wer jedoch die Fakten von vornherein so hindreht, dass sie ihm in den Kram passen, gehört nicht in eine Zeitungsredaktion, sondern in eine Dichterstube oder eine Propagandaabteilung.
Wichtig bei der Recherche ist es, dass sich Journalisten der Wahrheit verpflichtet fühlen. Sie müssen herausfinden, wie sich die Dinge wirklich verhalten, anstatt nur wiederzugeben, was behauptet wird. Dazu gehört eine skeptische Grundhaltung. Die besten Journalisten hinterfragen regelmäßig auch die eigene Fähigkeit, Richtig und Falsch zu unterscheiden.
Objektivität auf dem Prüfstand
Der Streit darüber, ob Journalismus objektiv sein kann, tobt seit hundert Jahren und ist damit vielleicht die älteste Kontroverse des Berufsstands. Der naturwissenschaftliche Fortschritt motivierte Journalisten zu Beginn des 20. Jahrhunderts dazu, bei der Recherche methodisch vorzugehen. Als Prinzip setzte sich durch, alle Beteiligten anzuhören, die gängige Definition von Objektivität.
Spätestens in den 1960er-Jahren haben Journalisten angefangen, dieses Prinzip kritisch zu hinterfragen. Denn wer sich sklavisch daran hielt, durfte nie über einen Skandal berichten, wenn sich die Beschuldigten weigerten, dazu Stellung zu nehmen. Die vermeintliche Objektivität diente also vor allem den Mächtigen. Zudem wollten viele Journalisten ihre subjektive Perspektive nicht mehr verleugnen.
Heute ist den meisten Berichterstattern klar, dass sie nie völlig objektiv sein können. Sie müssen aber objektive Methoden bei ihrer Arbeit anwenden: Jeder Rechercheschritt muss für das Publikum nachvollziehbar und nachprüfbar sein.
Recherchieren heißt nicht unbedingt, objektiv an einen Sachverhalt heranzugehen. Viele Journalisten fangen an zu stöbern und zu stochern, weil sie persönlich an etwas interessiert sind. Berichtenswert werden diese Informationen nur, wenn sie auch andere betreffen. Journalismus muss sich daher immer in den Dienst seines Publikums stellen. Loyal darf ein Journalist nur den Bürgern gegenüber sein.
Erzähler auf Zeit
Faktentreue ist kein Synonym für trockene Bürokratensprache. Journalisten und Journalistinnen müssen ihre Botschaften ansprechend verpacken, damit sich das Publikum tatsächlich die Zeit nimmt, sie zu verstehen. Je größer die Menge an verfügbaren Informationen, desto wichtiger wird die Präsentation. Im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit eines überfütterten Publikums setzt sich nur durch, wer seine Neuigkeiten verständlich und ansprechend vermitteln kann.
Anders als Wissenschaftler haben es Journalisten mit einer ungeduldigen Leserschaft zu tun. Sie müssen ihre Informationen verdichten und in möglichst kleine Pakete packen. Denn um sich über das Weltgeschehen zu informieren, nimmt sich das Publikum meist nur wenig Zeit.
Was weggelassen werden kann, ist im Journalismus ebenso wichtig wie das, was berichtet wird. Journalisten müssen ständig ein Maximum an Informationen anhäufen und dann die Spreu vom Weizen trennen. Der Großteil wird über Bord geworfen. Daran leiden die meisten Journalisten.
Der erste Entwurf der Geschichte
Dass Journalismus aktuell sein muss, steckt schon im Begriff selbst: Jour ist Französisch für Tag. Ein Journal ist ursprünglich nichts anderes als ein Tagebuch. Wie der Tag ist Journalismus ein vergängliches Geschäft. Journalisten täten nichts anderes, als einen ersten groben Entwurf der Geschichte zu liefern, sagte der ehemalige Verleger der Washington Post, Philip Graham.
Journalistinnen und Journalisten befassen sich mit historischen Ereignissen nur dann, wenn diese einen Bezug zur Gegenwart haben. Sie erheben den Anspruch, Neuigkeiten zu verbreiten, anstatt Altbekanntes wiederzukäuen.
Was nicht mehr ganz neu ist, muss doppelt so nützlich sein wie eine brandaktuelle Nachricht. Oder es weckt zumindest starke Gefühle – wie ein Foto von einem niedlichen Tierbaby.
Aktuell heißt nicht unbedingt tagesaktuell. Viele Journalisten schreiben für Wochenzeitungen oder für Magazine, die nur quartalsweise erscheinen. Andere arbeiten monatelang an einer Fernsehdokumentation oder planen von langer Hand die Berichterstattung über ein Großereignis wie die Olympischen Spiele.
Geschichten haben im Journalismus immer einen aktuellen Anlass. Meist werden den Zeitungen die Ideen frei Haus geliefert.
Eine Pressemitteilung weist auf eine Neuigkeit hin.
Ein Politiker lädt zu einer Pressekonferenz ein.
Ein Leser ruft an und verrät ein Ereignis.
Journalisten entscheiden, ob die aktuelle Entwicklung, die ihnen zugetragen wird, neu und für ihr Publikum interessant ist. Dann gehen sie der Geschichte nach, stellen fest, was dahintersteckt, und berichten, sobald sie genug darüber in Erfahrung gebracht haben – möglichst schon in der nächsten Ausgabe und möglichst vor der Konkurrenz.
Der Schriftsteller Truman Capote ging 1959 einer Zeitungsmeldung über einen aufsehenerregenden Kriminalfall nach: In Kansas war eine Familie bei einem Raubüberfall in ihrem Haus ermordet worden. Capote reiste wie ein Reporter sofort zum Schauplatz, spürte den Ermittlungen nach und führte Interviews, unter anderem mit den Tatverdächtigen. Mit der Veröffentlichung seines Buches Kaltblütig wartete er jedoch, bis die Mörder hingerichtet waren. Er war eben doch kein Journalist, sondern ein Schriftsteller.
Kapitel 2
Das ist guter Journalismus
IN DIESEM KAPITEL
Vertrauen ist gut, nachprüfen ist besserSo nah dran wie möglich, so distanziert wie nötigEine Sprache, die das Publikum verstehen kannJournalistinnen und Journalisten haben es nicht gerade leicht. Mal werden sie als sensationslüstern beschimpft, mal als unkritische Schergen des Establishments. Dabei gibt es immer wieder auch Reporter und Redakteure, die (fast) alles richtig machen. Leser, Hörer und Zuschauer haben dafür ein untrügliches Gespür.
Aber was unterscheidet eigentlich eine gute Zeitung von einer schlechten? Woran erkennt man einen gelungenen Fernseh- oder Radiobeitrag? Was ist es, das bestimmte Journalisten zu guten Journalisten macht?
Gute Journalisten wollen es genau wissen
Als die US-Regierung 2002 die Kriegstrommeln rührte, überschlug sich die amerikanische Presse mit Exklusivberichten über die Gefahr der Massenvernichtungswaffen des irakischen Diktators Saddam Hussein. »Hussein strebt verstärkt nach Atombomben-Teilen«, titelte am 8. September 2002 die angesehene New York Times. In vielen Details schilderte die Starreporterin Judith Miller, an welchen chemischen, biologischen und atomaren Kampfmitteln die irakische Regierung bastelte. Die irakischen Massenvernichtungswaffen wurden zum Kriegsgrund Nummer eins.
Weitgehend unbeachtet berichteten zwei Washingtoner Journalisten unterdessen das genaue Gegenteil. Es fehlten stichhaltige Beweise für die Alarmbotschaften aus dem Weißen Haus, schrieben Jonathan Landay und Warren Strobel. Landay und Strobel – das waren nicht etwa zwei Vertreter der linken Kampfpresse. Die beiden Reporter arbeiteten für Knight Ridder, einen Medienkonzern, dem damals in den USA eine Kette mittelgroßer und kleinerer Regionalblätter gehörte. Anders als Judith Miller gingen sie nicht im Weißen Haus ein und aus – und beschlossen, aus diesem Nachteil einen Vorteil zu machen. Sie zapften weniger prominente Quellen an, sprachen mit Dutzenden Mitarbeitern von Ministerien und Nachrichtendiensten. Sie hatten gar nichts gegen die Regierung. Aber sie waren hartnäckig: Sie wollten einfach ganz genau wissen, ob es diese Massenvernichtungswaffen denn nun wirklich gab.
Die Geschichte hat den beiden Reportern Landay und Strobel recht gegeben. Ein Jahr nach Kriegsbeginn wusste jeder, dass die New York Times einer Propagandalüge auf den Leim gegangen war. Ein schwerer Schlag für das Renommee der Zeitung.
Glaubwürdig ist ein Medium aus Sicht von Lesern, Hörern und Zuschauern nur, wenn die Fakten stimmen. Gründliche Recherche ist die erste und vornehmste Journalistenpflicht.
Einen Pulitzer, den begehrtesten Journalistenpreis der USA, haben die beiden Reporter der Regionalzeitungskette für ihre Berichterstattung übrigens nicht bekommen. Als sich herausstellte, dass sie recht gehabt hatten, war die Bewerbungsfrist längst vorbei.
Zwei Unbestechliche und der Watergate-Skandal
Zwei amerikanische Reporter zehren bis heute von den Früchten ihrer hartnäckigen Recherchearbeit: Hollywood verewigte Bob Woodward und Carl Bernstein von der Washington Post, die 1972 den Watergate-Skandal aufdeckten, in dem Film Die Unbestechlichen, mit Robert Redford und Dustin Hoffman in den Hauptrollen.
Angefangen hatte alles mit einem Einbruch im Parteibüro der Demokraten im Watergate, einem Apartment- und Hotelkomplex in Washington. Fünf Männer wurden bei dem Versuch, Wanzen zum Abhören anzubringen, auf frischer Tat ertappt. Woodward und Bernstein bohrten nach und fanden heraus, dass einer der Männer auf der Gehaltsliste des Wahlkampfkomitees des republikanischen Präsidenten Richard Nixon stand. Damit hatten sie den Anfang eines Knäuels von Zusammenhängen in der Hand, in das sich Präsident Richard Nixon derart verstrickte, dass ihm letztlich nur der Rücktritt blieb.
Bestärkt wurden Woodward und Bernstein in ihrer Detektivarbeit von einem Insider, den sie Deep Throat nannten – ein Wortspiel aus dem gleichnamigen Pornofilm und der Bezeichnung für streng vertrauliche Informationen. Wörtlich übersetzt heißt Deep Throat so viel wie Tiefer Rachen. 2005 gab sich Mark Felt, ein ehemaliger hochrangiger FBI-Beamter, als Quelle der beiden Reporter zu erkennen. Wer mehr darüber erfahren möchte, was nach der Aufdeckung des Watergate-Skandals aus den beiden Starreportern wurde, erfährt spannende Details über den sehr unterschiedlichen Verlauf der Karrieren von Bob Woodward und Carl Bernstein in Woodward und Bernstein – Leben im Schatten von Watergate von Alicia Shephard, erschienen bei Wiley-VCH.
Gute Journalisten behandeln Quellen sorgfältig
Jeder Zeitungsleserin, jedem Zeitungsleser sind sie schon begegnet: die geheimnisvollen Kreise, aus denen die Informationen sprudeln, mit denen Journalisten ihre Artikel würzen, ob es um hohe Politik geht oder schlicht um Klatsch und Tratsch. Hinter Regierungskreisen, Koalitionskreisen oder Justizkreisen verbergen sich Menschen, die zwar gerne reden, aber nicht öffentlich dazu stehen wollen. Manche dieser Quellen sind einfach nur feige, andere fürchten zu Recht um ihren Job. Fest steht: Ohne sie könnten Magazine ihre Publikation einstellen, und die Zeitungen wären nur halb so dick.
Dass es besser ist, seine Quellen zu nennen, ist den meisten Journalisten irgendwie bewusst. Es ist fair, denn das Publikum hat dadurch die Möglichkeit, selbst einzuschätzen, was von einer Information zu halten ist. Es sichert die Reporter ab, denn wenn sich die Information als falsch herausstellt, kann die Quelle dafür verantwortlich gemacht werden. Außerdem fördert der offene Meinungsaustausch die Demokratie.
Trotzdem hat sich gerade in der Politikberichterstattung die Tradition entwickelt, wonach bestimmte Informationen nur »unter drei« zu haben sind, das heißt, dass sie eigentlich nicht verwendet, auf jeden Fall aber nicht der Quelle zugeschrieben werden sollen. Die Ware trägt kein Herkunftsschild, und für ihre Verwendung haftet allein der Journalist.
»Unter eins«, so lautet die ungeschriebene Regel im Berliner Politikbetrieb, darf namentlich zitiert werden, wer Informationen weitergegeben hat.
»Unter zwei« darf die Quelle nicht namentlich in Erscheinung treten. Erlaubt ist lediglich anzudeuten, aus welcher Ecke die Information stammt, wobei die genaue Bezeichnung Verhandlungs- oder Erfahrungssache ist. Ist von Regierungskreisen die Rede, handelt es sich oft schlicht um einen Regierungssprecher, der nicht namentlich zitiert werden will. Koalitionskreise deuten darauf hin, dass die Quelle in einer der regierenden Parteien, nicht aber im Kabinett selbst sitzt.
»Unter drei« heißt der Tradition zufolge, dass eine Information nur für den Hinterkopf des Journalisten bestimmt ist. Spätestens seit dem Regierungsumzug nach Berlin wurde diese Formel allerdings deutlich aufgeweicht. Wer sich »unter drei« äußert, geht davon aus, dass das Gesagte irgendwie an die Öffentlichkeit gerät. Er hofft nur, nicht als Quelle der Nachricht identifiziert zu werden.
Was wirklich »unter uns« bleiben soll, bezeichnen einige Politiker daher heutzutage als »unter fünf«, »unter fünfundzwanzig« oder sogar als »unter 599«. Die Kreise ziehen sich immer weiter. Das Ganze ist ziemlich inflationär.
Die Ausdrücke »unter eins«, »unter zwei« und »unter drei« stammen aus der Satzung der Bundespressekonferenz, einer Vereinigung der Parlamentskorrespondenten. Nachlesen können Sie das unter www.bundespressekonferenz.de.
In den Publizistischen Grundsätzen des Deutschen Presserats, dem sogenannten Pressekodex, steht über die Journalistenpflicht zur Quellennennung kein Wort. Ausdrücklich wird hingegen gefordert, dass die Presse von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch macht.
»Die vereinbarte Vertraulichkeit ist grundsätzlich zu wahren«, postuliert der deutsche Presserat. Was sonst noch im Pressekodex steht, erfahren Sie im Detail in Kapitel 4.
Wie weit der Informantenschutz im Einzelnen geht, darum streiten sich Journalisten seit Jahrzehnten mit den Behörden. 1962/63 saß der Spiegel





























