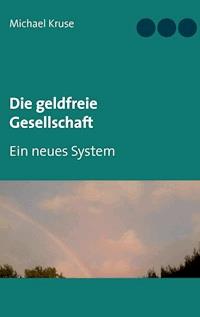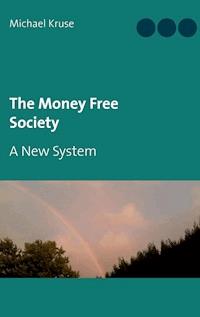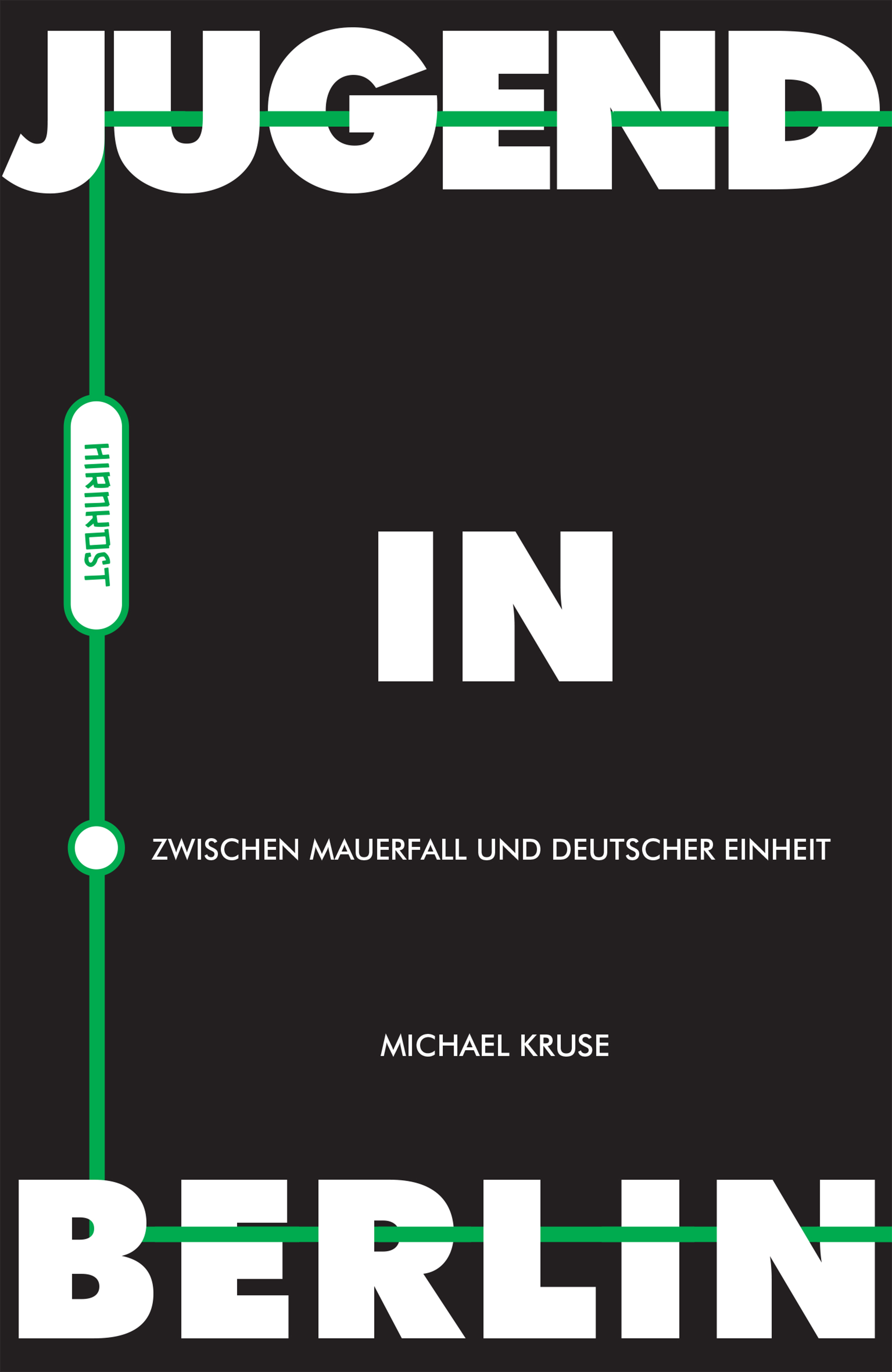
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hirnkost
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Fall der Berliner Mauer war für viele Jugendliche, und sicher nicht nur für sie, ein einschneidendes Erlebnis in ihrem Leben. Die vorliegende Untersuchung geht der Frage nach, welche Rolle die Medien für die Jugendlichen bei der Wahrnehmung der anderen Stadthälfte spielten, wie sie die Öffnung der Grenzen und den Vollzug der deutschen Einheit erlebten und wie sie die Zukunft in einem geeinten Deutschland einschätzen. Diese Regionalstudie "Labor Berlin" betrachtet die Entwicklung der Hauptstadt seit dem Fall der Mauer, wie sie als erste Region in Europa zusammenwuchs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Originalausgabe
© 2020 Hirnkost KG, Lahnstraße 25, 12055 Berlin; [email protected];
www.jugendkulturen-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage April 2020
Vertrieb für den Buchhandel:
Runge Verlagsauslieferung; [email protected]
Privatkunden und Mailorder:
https://shop.hirnkost.de/
Layout: Yunus Kleff
Lektorat: Rana Holsti
ISBN:
PRINT: 978-3-947380-65-7
PDF: 978-3-947380-67-1
EPUB: 978-3-947380-66-4
Dieses Buch gibt es auch als E-Book – bei allen Anbietern und für alle Formate.
Unsere Bücher kann man auch abonnieren: https://shop.hirnkost.de/
Der Autor
Michael Kruse, geb. 1956 in Göttingen, Studium der Erziehungswissenschaft an der Universität Bielefeld, seit 1986 wohnhaft in Kreuzberg. Seit 1995 Mitarbeiter des Deutschen Kinderhilfswerkes. Hobbys: Reisen und Fotografieren.
INHALT
Vorwort
Jugend in Berlin – Opfer der Einheit?
Berlin – 30 Jahre nach der deutschen Einheit
Jugend in der wiedervereinigten Hauptstadt – vergessen und an den Rand gedrängt?
Neukölln und Treptow
Die Interviews
Medienstadt Berlin und ihre jugendlichen Nutzer*innen
Der Besitz von Medien
Fernsehen
Radio
Kassettenrecorder
Walkman/iPod
Plattenspieler/CD-Player
Videorecorder/DVD
Computer
Handy
Jugendzeitschriften
Tageszeitungen
Zusammenfassung
Kulturstadt Berlin und ihre jugendlichen Teilnehmer*innen
Jugendclubs/Jugendzentren
Diskotheken
Konzert
Kino
Theater
Museen
Ausstellungen und Galerien
Zusammenfassung
Szenestadt Berlin
Informelle Gruppen
Stil und Mode
Feten und Partys
Öffentliche Räume
Einkaufszentren
Gaststätten, Spielhallen und Eiscafés
Jugend auf dem Weg in die deutsche Einheit
Die DDR – ein Jugendrückblick
9. November 1989: Der Tag des Mauerfalls
Perspektivischer Blick auf die deutsche Einheit
Pädagogische und politische Maßnahmen
Medienangebote
Jugendkulturarbeit und Schule
Jugendpolitik und politische Bildung
Berlin: Die Stimmungslage 30 Jahre nach der Deutschen Einheit
Literaturverzeichnis
„Aber mit Achtung und Respekt vordem Selbstgefühl der bishervon uns getrennten Landsleutewird es möglich sein,dass ohne entstellende Narbenzusammenwächst,was zusammengehört.“
Willy Brandt
VORWORT
Der Fall der Berliner Mauer war für viele Jugendliche, und sicher nicht nur für sie, ein einschneidendes Erlebnis in ihrem Leben. Die vorliegende Untersuchung geht der Frage nach, welche Rolle die Medien für die Jugendlichen bei der Wahrnehmung der anderen Stadthälfte spielten, wie sie die Öffnung der Grenzen erlebten, wie sie den Vollzug der deutschen Einheit erfuhren und wie sie die Zukunft in einem geeinten Deutschland einschätzen. Diese Regionalstudie Labor Berlin betrachtet die Entwicklung der Hauptstadt seit dem Fall der Mauer, wie sie als erste Region in Europa zusammenwuchs. Berlin wird an der Schnittstelle von Ost und West als Vorreiter für einen globalisierten Wandel gesehen, der insbesondere von den Medien vorangetrieben wurde. Denn in den letzten 30 Jahren erfolgte eine weltweite Globalisierung und Digitalisierung, die für das Kommunikationsprojekt Deutsche Einheit einen einzigartigen Umbruch darstellte. Spannend wird es sein, zu beobachten, ob die digitale Moderne ein Zeitalter des Dialogs oder eine Epoche des Aufeinanderbrüllens wird. Die vorliegende Untersuchung beschreibt im Detail, welche Medien diesen rasanten, ungesteuerten Prozess nicht nur abbildeten, sondern auch beschleunigten – und dabei auch Realitäten veränderten. Den Abschluss bilden (medien-)pädagogische und politische Anregungen, die sich aus der Untersuchung ergeben und in die Praxis umgesetzt werden sollten.
Jugend in Berlin – Opfer der Einheit?
Spricht man heute über die Hauptstadt Berlin, so stehen wirtschaftliche und politische Aspekte der deutschen Einheit im Vordergrund. Die Regierung ist nach Berlin gezogen, unzählige Wirtschafts- und Lobbyverbände haben ihren Sitz in der Bundeshauptstadt gefunden, und Medien aus aller Welt berichten über das neue Leben in der Stadt. Selten jedoch kommen Jugendliche zu Wort. Deshalb sollen hier ihren Erfahrungen und Sichtweisen breitester Raum eingeräumt werden, verbunden mit der spannenden Frage, ob diese letzte Generation der Mauerkinder sich heute als Verlierer oder Gewinner der deutschen Einheit sieht.
Berlin – 30 Jahre nach der deutschen Einheit
Berlin, Zentrum der deutschen Ost-West-Auseinandersetzung, hat sich fast beiläufig zu einer wirklichen Metropole entwickelt, und wie jede Metropole der Welt ist sie multikulturell, voller Menschen, die die innerdeutsche Beziehungskiste mit ihren gegenseitigen Kränkungen eher wenig interessiert. Bodo Morshäuser erinnert sich an das alte Westberlin so: „Ich verglich die Weltstädte mit dieser ehemaligen Halbstadt und schien in ein Dorf, nach Bad Berlin wiederzukehren, der stillsten der großen Städte, verschont vom Durchgangsverkehr und ohne erwähnenswerte Dichte. Westberlin war nicht die Stadt, die mit Modernität, sondern mit Rückständigkeit, weniger mit Geschwindigkeit als mit Betulichkeit faszinierte. Die Stadt schrie nicht, sie flüsterte, zog dich nicht in sich hinein. Sie strahlte allein dadurch, dass es sie gab, wie es sie gab: geschlossen“ (Morshäuser 1992: 164).
Heute boomt Berlin an allen Ecken und Enden. Der Potsdamer Platz, das Regierungsviertel, der Hauptbahnhof, aber auch zahlreiche neue Bürohochhäuser kündigen eine Hauptstadt an, die ihre neue Rolle als eine der wichtigsten Städte in Europa gefunden hat. Thomas Krüger, ehemaliger Jugendsenator von Berlin, drückt es so aus: „Die einst schlafende Schönheit Berlins bekommt ein junges, frisch aufgelegtes und neugieriges Gesicht“ (Krüger 1998: 22). Berlin hat seit seiner Teilung 1961 über die Maueröffnung 1989 bis 30 Jahre nach der deutschen Einheit einen dramatischen Wandel vollzogen. Nirgendwo erlebt man den epochalen Wandel so unmittelbar an der Schnittstelle von Ost und West wie am Potsdamer Platz. Auf wenigen Hektar Fläche dokumentieren Konsum und Lebensstil, wie sich die Welt verändert hat.
Nach dem Mauerfall wucherte noch Unkraut über dem öden Areal. Ein paar Schutthaufen erinnerten an den Krieg, der Deutschland und die Welt teilte – ein Niemandsland zwischen Ost und West. Heute zieht es ca. 14 Millionen Tourist*innen pro Jahr nach Berlin. Die Besucher*innen spazieren durch die zugigen Straßen einer Retortenstadt und erleben die bunte Warenwelt der globalen Wirtschaft. Der Architekt Hans Kollhoff, einer der Erbauer des Potsdamer Platzes, weist in einem Interview darauf hin, dass Berlin auch als Las Vegas eine Rolle spielt: „Das Las-Vegas-Bild hat mit der Lage Berlins zu tun. Berlin liegt in der Wüste. Sie müssen eineinhalb Stunden mit dem Auto fahren, um die Lichter einer anderen Stadt zu sehen“ (Görke/Goldmann/Nowakowski in: Der Tagesspiegel vom 11.09.2006). Nicht nur in West und Ost gab es in den letzten 30 Jahren spannende und hochinteressante Veränderungen, sondern Berlin insgesamt übt unverändert eine große Faszination aus, insbesondere auf die jugendlichen Besucher*innen aus aller Welt.
Jugend in der wiedervereinigten Hauptstadt – vergessen und an den Rand gedrängt?
Erstmalig erlebte eine Kinder- und Jugendgeneration die auch für sie völlig unerwartete Wiedervereinigung zweier unterschiedlicher Gesellschaftssysteme. Dabei bestimmten Erwachsene, nach welchen Vorstellungen sich die Stadt weiterentwickeln werde. Einzige sichtbare Zäsur im institutionalisierten politischen System für das vereinte Deutschland war der Regierungsumzug nach Berlin. Heute agiert die Politik in einem völlig neuen Umfeld und doch ist sie der Hauptstadt und ihren Bürger*innen nicht nähergekommen. Der Berliner Schriftsteller und Komponist Hans G. Helms drückt es so aus: „Zu übersehen ist freilich auch nicht, was für Kapital und Obrigkeit durchaus von Relevanz ist: Gentrification meint stets politisch-soziale Pazifizierung. Die Yuppie-Heuschrecken werden die Hausbesetzer und Autonomen, die Hooligans und Skinheads restlos vertilgen oder wenigstens verdrängen“ (Helms 1992: 11). Eine sehr pessimistische Einschätzung, die zumindest derzeit nicht geteilt werden kann, obwohl sich mit dem Projekt Mediaspree in Friedrichshain-Kreuzberg große Veränderungen in dieser Hinsicht andeuten. Denn die Gefahr, die dabei besteht, dass Jugendliche und ihre Interessen in der Hauptstadt unterzugehen drohen, ist nicht zu unterschätzen.
Und deshalb kommen in dieser Untersuchung Berliner Jugendliche selbst zu Wort: Wie sie den Fall der Mauer erlebt haben, was sie am Tag der deutschen Einheit empfanden, und wie sie ihre Perspektive 30 Jahre nach dem Mauerfall sehen. Dabei sollen Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede, wie sie die Jugendlichen selbst beschreiben, herausgearbeitet werden. Denn Ost- und Westbeziehungen waren nicht immer ganz einfach. Einigen hing das Thema zum Halse heraus, viele sind dagegen der Meinung, dass die deutsche Einheit inzwischen auch mental vollzogen ist. Deshalb will die vorliegende Studie einen Beitrag dazu leisten, nicht nur eine Bestandsaufnahme aus Sicht der Jugendlichen in Berlin vorzulegen, sondern auch zur Diskussion über Perspektiven Jugendlicher in der Hauptstadt anzuregen.
Neukölln und Treptow
Bei der Auswahl der Bezirke stehen zwei Berliner Bezirke im Mittelpunkt, die für die Entwicklung der Stadt typisch sind und geografisch nebeneinanderliegen: die Bezirke Neukölln und Treptow. Neukölln (290.300 Einwohner*innen im Jahr 1987; 2018 waren es 329.767 Menschen aus 160 Nationen), im Norden durch Altbauhäuser um die Jahrhundertwende geprägt, ferner das Rollbergviertel, eine Siedlung mit etwa 2.000 Wohnungen in Betonburgen, die nach der Kahlschlagsanierung in den 1970er Jahren entstanden ist, in der Mitte ein großes Industriegebiet und im Süden dorfähnliche Strukturen (Britz, Buckow und Rudow) und die gewaltige Hochhaussiedlung der Gropiusstadt mit Berlins größtem Einkaufscenter, bot sich als eines der beiden Untersuchungsgebiete an. Negativ in die Schlagzeilen durch einen Bericht des Spiegel gebracht, ist hier das Image trotz starker Yuppisierung („Kreuzkölln“) besonders fragwürdig. Verwahrlosung, Gewalt und sogar Hunger würden den Alltag im bevölkerungsreichsten Berliner Bezirk prägen, das Rathaus sei „das größte Sozialamt Deutschlands“, so Peter Wensierski in Der Spiegel 43/1997. Mittlerweile ist es angesagt, in den Norden Neuköllns zu ziehen, was zu einer massiven Verdrängung der ursprünglichen Bevölkerung führt. Im Süden, wo es weniger Probleme gab, ist die Lage stabil geblieben. Die Arbeitslosenquote in Neukölln liegt bei 12,1 %. Erschreckend ist der Anstieg der Kinderarmut: Sie ist von 10 % im Jahr 2001 auf 55,9 % im Jahr 2018 gestiegen. Neukölln wird als erster deutscher Slum ausgemacht. Aber es gibt auch sehr idyllische Ecken: „Ja, also ich wohne in Berlin, das ist ein Einfamilienhaus. Es ist im Blumenviertel, also etwas im Grünen, etwas ruhig, es ist ein recht großes Haus, wo wir also zu viert inklusive Hund leben, mit Garten und so … Bei uns ist also Land in Ruhe, und der Eiermann kommt einmal die Woche, das ist fast wie in Bayern“, so Thomas (20) aus Westberlin.
Gegenüberliegend befindet sich der Bezirk Treptow (267.167 Einwohner*innen im Jahr 2018) mit dem niedrigsten Anteil an Berliner*innen mit Migrationshintergrund (7,1 %), bestehend aus acht Ortsteilen und mit der längsten Grenze zwischen den Berliner Ost- und Westbezirken. Der Norden ist ebenfalls durch ein Altbauviertel geprägt, daran schließt sich der Treptower Park mit dem 1969 als Kulturpark gegründeten und seit 1991 als Spreepark fortgeführten Freizeitpark an, der inzwischen pleite ist und dessen Attraktionen bis zur Schließung weit über die Bezirksgrenzen hinaus für viele Berliner Jugendliche ein Anziehungspunkt waren. Südwärts liegen das Industriegebiet Schöneweide mit dem ehemaligen Flughafen Johannisthal sowie die eher dörflich geprägten Ortsteile Adlershof, Altglienicke und Bohnsdorf. „Da haben wir zusammen gespielt und dann war da ein Hof; auf dem Hof, da war hinten die Mauer, dann war da das Grenzgebiet, also gleich dicht am Hof war das Grenzgebiet … Na ja, da haben wir uns an die Mauer gestellt und gesagt: Die alten Omis, die dürfen jetzt da rüberfahren und sich das ankieken, und wir, wir müssen jetzt immer hier sitzen“, so Peter aus Ostberlin (zum Zeitpunkt des ersten Interviews kurz nach der Wende 13 Jahre) zu seinen Mauererfahrungen. Martina (17) aus Ostberlin erinnert sich an ihre Treptower Mauererfahrungen: „Das war früher hier Grenzgebiet. So ungefähr zehn Meter weiter war so eine rot-weiße Schranke, und da musste jeder, der da vorbeiwollte, der da gewohnt hat, so eine Karte, auch Besucher haben die immer gekriegt, und jeder, der da hin wollte, musste diese Karte vorzeigen. Also Kinder haben sie meistens nicht kontrolliert, aber Erwachsene. Und da durfte man nur mit der Karte rein. Und dann war da die Mauer und zehn Meter davor war noch mal so ein Ding, und da durfte man auch nicht hinter. Da habe ich früher immer Löwenzahn für mein Meerschweinchen gepflückt. Und dann haben da immer die Leute aus dem Wachturm gebrüllt, dass man da verschwinden soll.“ Peter (17) aus Ostberlin im Rückblick: „Meine Schule stand direkt an der Mauer; wenn ich aus dem Fenster sah, guckte ich auf das Niemandsland, und von dort aus konnte man immer gut die Grenzer ärgern, und man hat sich doch auch Gedanken gemacht, wie es wohl auf der anderen Seite sein wird. Geändert hat sich durch die Maueröffnung sehr viel.“ Martin (20) aus Ostberlin entsinnt sich: „Baumschulenweg ist früher so am Ende der Welt gewesen, war zwar ein Grenzübergang gewesen, aber ziemlich tot halt. Abends um acht waren die Bürgersteige hochgeklappt, war kein Mensch auf der Straße gewesen. Jetzt abends kann man kaum noch bei offenem Fenster schlafen … Die Sonnenallee ist jetzt Stadtautobahn von Berlin geworden.“ So weit frühe Erinnerungen aus Treptow. Diese ersten Äußerungen aus dem Osten der Stadt machen deutlich, dass die Mauer im Alltag der Jugendlichen wahrgenommen, aber auch hingenommen wurde. Sie gehörte einfach dazu. Erst der Fall der Mauer hat für die Ostberliner Jugendlichen einschneidende Veränderungen in allen Bereichen mit sich gebracht. Der Alltag wurde für sie, aber auch für ihre Eltern (80 % der Erwachsenen mussten nach der Wende eine neue Stelle antreten oder blieben arbeitslos) auf den Kopf gestellt.
Da Ostberlin bis zur Wende von mir als weißer Fleck wahrgenommen wurde, verbrachte ich die ersten Wochen nach der Grenzöffnung damit, den östlichen Teil Berlins, insbesondere Treptow, ausführlich kennenzulernen. Ich besuchte die wichtigsten Jugendclubs und unterhielt mich mit Jugendclubleitern und anderen Erwachsenen, um eine Einschätzung der allgemeinen Situation der Jugendlichen und der Strukturen der Jugendpolitik zu bekommen.
Die Interviews
Im Februar 1990 fanden die ersten Befragungen von Jugendlichen in Treptow statt. Insgesamt wurden 35 Jugendliche im Alter von 13 bis 20 Jahren befragt, 20 Mädchen und 15 Jungen. Zwei Drittel der Befragten kommen aus Ostberlin, ein Drittel der Befragten aus Westberlin, da sich im Laufe der Untersuchung herausstellte, dass sich für die Jugendlichen aus dem Ostteil der Stadt wesentlich mehr verändert hat als für die Jugendlichen aus Westberlin. Ende der 1990er Jahre wurden noch drei Wiederholungsinterviews geführt. Alle Interviews wurden in der Regel bei den Jugendlichen zu Hause durchgeführt. Die Dauer der Interviews betrug zwischen anderthalb und drei Stunden. Insgesamt wurden insgesamt ca. 800 Seiten ausgewertet. Drei Jugendliche wurden noch einmal interviewt, um so neuere Entwicklungen und Einschätzungen der Befragten festzuhalten. Alle Interviews wurden anonym durchgeführt, wobei die meisten Jugendlichen sehr offen ihre Situation schilderten. Sie geben deshalb einen tiefgehenden Einblick in die Gefühlslage der Berliner Jugend in den 1990er Jahren. Auch Klaus Farin und Eberhard Seidel betonen die Wichtigkeit, Jugendliche möglichst authentisch zu Wort kommen zu lassen (vgl. Farin/Seidel 2019: 9). Im Anschluss daran fanden oft noch Gespräche mit den Eltern statt, die eine gewisse Neugier hinsichtlich der Interviews erkennen ließen.
Aus der Zahl der Interviewten sollen beispielhaft zwei Personen kurz biografisch skizziert werden: Martina aus Ostberlin und Peter aus Westberlin. Martina, in Ostberlin geboren, schloss sich in ihrer Jugend der Gruftiszene der DDR an. In der Folge erhielt sie nicht nur Alex-Verbot, sie und ihre Eltern wurden auch von der Stasi regelmäßig überwacht. Der Vater blieb bei einem Westbesuch in Westberlin. Darauf stellte die Mutter einen Antrag auf Ausreise nach Westberlin, der überraschenderweise und kurzfristig genehmigt wurde. Die Ausreise 1987 über den S-Bahnhof Friedrichstraße war ein tiefer Einschnitt in das Leben der gesamten Familie. Martina kam relativ unvorbereitet im Westen an und fühlte sich Tag für Tag auf der Straße als Ostlerin erkannt. War sie früher in Ostberlin eher ein Ausgehtyp, so zog sie sich bis zur Wende völlig in die Familie zurück. Bei der Öffnung der Mauer traf sie ihre alten Freund*innen aus Ostberlin wieder und feierte mit ihnen an den früheren Jugendtreffpunkten. Nachdem die erste Neugier verflogen war, zog sie wieder in den Osten, traf sich gelegentlich mit früheren Freunden der Gruftiszene und gründete später eine Familie.
Peter dagegen wurde in einem bayrischen Dorf geboren. Auf Wunsch der Familie zogen sie nach Westberlin. Schnell freundete er sich mit vielen jungen Menschen an, obwohl ihm am Anfang sein bayrischer Dialekt beim Kennenlernen oft Schwierigkeiten bereitete. In der Folgezeit legte er sich eine größere Plattensammlung zu, damit er bei verschiedenen Veranstaltungen in Neukölln als DJ auftreten konnte. Den Osten kannte er nicht und hat ihn bis zur Wende, wie die meisten Westberliner Jugendlichen, nicht wahrgenommen. Den Mauerfall erlebte er nicht direkt als Bereicherung. Wirtschaftlich gesehen war es für ihn jedoch ein Glücksfall, da er nun auch im Osten bei größeren Feten als DJ auftreten konnte. Doch die jugendlichen Menschen im Osten blieben ihm fremd.
MEDIENSTADT BERLIN UND IHRE JUGENDLICHEN NUTZER*INNEN
Berlin ist die Medienmetropole Deutschlands. Zwei Trends zeichnen sich ab: Der Radiomarkt gilt als einer der härtesten in Europa, und in der vielfältigen Zeitungslandschaft ist bis heute ein Ost-West-Riss erkennbar. Dabei hat sich der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland relativ rasch und ohne lang anhaltende politische Diskussionen vollzogen. Eine inhaltliche Auseinandersetzung über das neue Deutschland fand kaum statt, weil sie auch von der westlichen politischen Elite nicht gewünscht war. Die Organisationen im Westen haben Organisationen im Osten gegründet. Eigenständig im Osten gegründete Organisationen, soweit es sie denn überhaupt gab, blieben ohne relevanten politischen Einfluss. Und so mangelt es auch heute noch an einem eigenen ostdeutschen Mediensystem, das die Interessen der Menschen aus Ostdeutschland, insbesondere der Jugendlichen, vertritt und ihnen eine Stimme im wiedervereinigten Deutschland gibt. Zudem kam und kommt es aufgrund der Abwesenheit von bedeutsamen ostdeutschen Medien bzw. deren Abwicklung nicht zum Aufbau von ost-west-übergreifenden Informations- und Kommunikationsbeziehungen. In der Folge ist die wechselseitige Wahrnehmung und Aufmerksamkeit füreinander sehr einseitig. Auch auf der Rezipient*innenseite gibt es noch Unterschiede zwischen Ost und West, die im weiteren Verlauf medienspezifisch ausführlich dargestellt werden sollen, was zur Folge hat, dass sich beide Seiten nicht immer auf Augenhöhe begegnen.
Jugendzeit ist Medienzeit. Dabei taucht die 1999 vom Freizeitforscher Horst W. Opaschowski beschriebene Generation @ in eine Multimediawelt ein, die sie gleichzeitig durch die Kanäle zappen und zugleich telefonieren lässt, ein typisches Konsumverhalten der Generation der 1990er Jahre. Seit den 1950er Jahren ist die Mediennutzung, insbesondere das Radiohören, bei den Jugendlichen neben dem Ausgehen die wichtigste Freizeitbeschäftigung. Auch Jutta Gysi weist aus DDR-Sicht darauf hin, dass Fernsehen, Rundfunk- und Musikhören die beliebtesten Freizeittätigkeiten sind (vgl. Gysi 1989). Dazu betonen Günter Lange und Hans-Jörg Stiehler einen wichtigen Aspekt der DDR-Medien: „Es ist keine Zuspitzung, sondern eine realistische Zusammenfassung vielfältiger Untersuchungsergebnisse, festzustellen, dass im Verlauf der 80er Jahre die Medien zunehmend als eines der zentralen geistigen Vermittlungsglieder zwischen Gesellschaft und Individuum (bzw. Partei, Staat und Gesellschaft) ausfielen und zunehmend nicht nur dysfunktional, sondern selbst destabilisierend hinsichtlich ihrer (reproduktiven) Leistungen für Individuum und Gesellschaft wurden. In den 80er Jahren kam es bei Rundfunk und Fernsehen zu drastischen Verschiebungen in den Relationen zwischen DDR- und BRD-Medien. In gewisser Hinsicht vollzogen sowohl die Medien als auch das Publikum eine Entkopplung von Lebensalltag und Medienrealität“ (Lange/Stiehler in: Burkart 1990: 60). Und Bernd Lindner betont in seinem Beitrag Erst die neuen Medien, dann die neuen Verhältnisse: „Die Welt stand uns schon lange offen: durch die Medien. Vergleicht man die derzeitigen Umbrüche im politischen Bereich mit den Ergebnissen der jahrelangen soziologischen Forschungen im Bereich der Kultur-, Literatur- und Mediennutzung, so muss man feststellen, dass wir gerade dabei sind, das auf der gesellschaftlichen Ebene nachzuvollziehen, was wir alle im kulturellen Bereich schon mehr oder weniger gelebt haben. […] Diese Annährung der Jugenden beider ehemaliger deutscher Staaten an einen gemeinsamen Mediennutzungslevel ist keineswegs ein Ergebnis der letzten Jahre allein. Hier ist, insbesondere von den Jugendlichen der DDR – noch zu Zeiten, in denen deren Existenz scheinbar unerschütterbar schien – kräftig ‚vorgearbeitet‘ worden. Nirgendwo wird den Heranwachsenden daher der Anschluss an bundesrepublikanischen Alltag so einfach fallen wie im Medienbereich!“ (Lindner in: Hennig/Friedrich 1991: 99; 102).
Deutlich wird gerade im Medienbereich, wie sich die DDR und ihre Medienlandschaft seit der Wende für Jugendliche geändert hat: Intensiver Zugang zum Medienmarkt der Bundesrepublik Deutschland, erweitertes Medienangebot (Video, Computerspiele usw.), Kommerzialisierung des Medienmarktes und Erweiterung der audiovisuellen Kommunikation. Hier weist Bernd Lindner auf einen wichtigen Aspekt hin: „Die Medienzentriertheit des Freizeitverhaltens wird weiter zunehmen, schon weil auf diesem Gebiet das Gros der neuen Angebote erfolgen wird. Bisher in der DDR nur wenig verfügbare technische Geräte (wie Videorecorder und -kameras, CD-Player, Computer) wollen in ihren Möglichkeiten erkundet und ausgeschritten werden. Von einem ‚West-Schock‘ ist bei den DDR-Jugendlichen gegenwärtig nur wenig zu spüren, eher ein selbstverständliches Sich-Bedienen an den neuen Möglichkeiten“ (Lindner in: Friedrich/Griese 1991: 113). Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, wie Ost- und Westberliner Jugendliche die Medien nutzen, wo es Unterschiede und wo es Gemeinsamkeiten in der Rezeption gibt.
Der Besitz von Medien
„Ich bin im Besitz von einem Radio, von einem Kassettenrecorder, einem Walkman. Meine Mutter hat ’nen Plattenspieler und auch ein Radio, gleich drüben. Wir besitzen keinen Videorecorder, keinen CD-Player, keinen Computer“, berichtet Peter (13) aus Ostberlin unmittelbar nach dem Mauerfall. Dagegen der Westberliner: „Ich habe einen ziemlichen Maschinenfuhrpark zu Hause, würde ich fast behaupten, was haben wir denn? Also zwei Fernseher stehen rum, zwei Stereoanlagen, dann eben Computer noch, alles eigens Zeug …“, so Peter (14) aus Westberlin, der sichtbar stolz auf seine Medienlandschaft ist. Unterschiedlicher könnten die Aussagen der Jugendlichen unmittelbar nach dem Mauerfall gar nicht sein.
Gut 30 Jahre später sieht es dagegen völlig anders aus. Ferchhoff bringt es auf den Punkt, wenn er von einem „elektronischen Paradies“ spricht (Ferchhoff 2007: 367). Betrachtet man bei den Jugendlichen den Umfang des Besitzes von Medien, so lassen sich heute zwischen Ost und West keine Unterschiede mehr feststellen. Laut JIM-Jugendstudie 2018 besitzen praktisch alle Jugendlichen in Deutschland ein Handy (99 %), einen Computer/Laptop (98 %) und ein Fernsehgerät (95 %) (vgl. MPFS 2018). Auch Westberliner Jugendliche besitzen heute keine umfangreichere Medienausstattung mehr als Ostberliner Jugendliche. Auffällig ist jedoch, dass sich die traditionellen Medien zum Zeitpunkt der Interviews oft fast ausschließlich im Besitz der Westberliner Jugendlichen befanden.
Hinsichtlich der Ausstattung mit Medien bei den Ostberliner Jugendlichen hat seit der Wende relativ rasch eine Angleichung stattgefunden. Es fällt jedoch auf, dass die Medien, wie z. B. das Fernsehgerät, sich zum Teil auch heute noch im Besitz der Eltern befinden. „Es gehört allen, der Kassettenrecorder gehört allen, der Fernseher gehört allen, Plattenspieler gehört allen“, so Andrea (17) aus Ostberlin. Dies hat zur Folge, dass die Auswahl der Fernsehprogramme auch von den Eltern zum Teil bestimmt und kontrolliert wird. Dieser Trend wird noch dadurch verstärkt, dass durch die Arbeitslosigkeit der Eltern diese Zeit zwangsläufig oft zu Hause vor dem Fernsehgerät verbracht wird. Auswirkungen auf den Medienkonsum haben sicher auch die beengten Wohnverhältnisse, die zu Beeinträchtigungen im Medienkonsum der Ostberliner Jugendlichen führten: „Ich habe ein Zimmer zusammen mit meinem Bruder, das muss ich mit ihm teilen“, erklärt Thomas (14) aus Ostberlin.
Ulrich Beck betont die Doppelfunktion der Medien: „Die Medien, die eine Individualisierung bewirken, bewirken auch eine Standardisierung“ (Beck 1986: 210). Hartmut Rosa weist darauf hin, „dass sich das durchschnittliche Lebenstempo seit dem Beginn der Moderne kontinuierlich, wenngleich nicht linear, sondern in von Pausen und kleineren Trendumkehrungen unterbrochenen Schüben beschleunigt hat“ (Rosa 2005: 199). Konkret zu den Medienkonsument*innen meint Rosa: „Kaum zu bezweifeln ist die Tatsache, dass eine wachsende Zahl von verfügbaren und potenziell interessanten Gütern und Informationen die Zeitspanne verkürzt, die jedem einzelnen Gegenstand gewidmet werden kann: Wenn wir einen konstanten Anteil unseres Zeitbudgets dem Lesen von Büchern, dem Hören von CDs und der Beantwortung von E-Mails widmen, sinkt die durchschnittliche Dauer, die wir jedem Buch, jeder CD und jeder E-Mail-Nachricht widmen können, parallel zur Steigerung der Zahl an Büchern und CDs, die wir pro Zeiteinheit erwerben (oder ausleihen), bzw. zur Zahl der E-Mail-Nachrichten, die wir empfangen und versenden“ (ebd.: 203). Eine Tendenz, die heute sicher nicht nur Jugendliche betrifft.
Interessanterweise kauften sich fast alle interviewten Ostberliner Jugendlichen von ihrem Begrüßungsgeld im Westen einen Walkman, der heute unbeachtet in der Ecke liegt. Nach der JIM-Jugendstudie von 2018 nutzen Jugendliche an erster Stelle das Internet und das Smartphone (vgl. MPFS 2018). Das Mediennutzungsverhalten Jugendlicher hat sich in den letzten Jahren also radikal verändert, so ist z. B. das Radiohören auf den 6. Platz zurückgefallen. Zeitungen und Zeitschriften, aber auch das Fernsehen könnten langfristig auf der Strecke bleiben. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass hinsichtlich des Besitzes von Medien in Ost- und Westberlin heute keine Unterschiede mehr zu beobachten sind. Auch die angesprochene Beschleunigung der Nutzung der Medien, die im Besitz der Jugendlichen sind, erfahren keine Ost-West-Unterschiede.
Fernsehen
„Ja, ich denke, dadurch, dass jetzt die Mauer gefallen ist, irgendwie hat sich doch schon ziemlich viel verändert. Man hat halt viel mehr Freiheiten, irgendetwas zu machen, und ich glaube, so früher, was ich da gehört habe, wo dann die Leute die Kinder ausgefragt haben, ob die Eltern Westfernsehen gucken und so. Das war damals tabu, aber als ich in diesem Alter war, durfte ich das halt machen, und da war es auch ganz normal, ZDF zu gucken und so“, sagt Petra (13) aus Ostberlin rückblickend.
Helmut Hanke betont die bedeutende Rolle des (West-) Fernsehens, wenn er die These vertritt, dass wir 1989 „Zeugen und Teilnehmer der 1. Fernsehrevolution der Welt waren“: „Die kulturelle Kommunikation in der DDR war stets gesamtdeutsch. Dafür sorgten neben den sich erneuernden und ausweitenden persönlichen Kontakten vor allem die Medien, insbesondere das Fernsehen. Fernsehen war in der DDR stets und in wachsendem Maße Westfernsehen. Jedenfalls war die DDR-Gesellschaft die einzige soziale Gemeinschaft in Europa, die selbstverständlich und alltäglich mit zwei Grundtypen von Medienkultur umging. Mehrheiten lebten in den Abendstunden schon immer im Westen, und dies umso mehr, je unglaubwürdiger die eigenen Medien, speziell das Fernsehen, wurden. Die kulturelle Erosion des alten Herrschaftssystems lief in der DDR vor allem über die Massenmedien, insbesondere über das Fernsehen. […] Jetzt erweist sich, dass ein jahrzehntelanger Umgang mit BRD-Medien langfristige kulturelle Folgen zeitigt, dass der Standard der Wünsche und Träume in allen Generationen überwiegend ‚westlich‘ war und ist, die Botschaften der Medien schon immer auf das reichere und schönere deutsche Land der Verheißung verwiesen. […] Fernsehen machte die Massenflucht öffentlich, Ohnmacht und Wut im Lande steigerten sich von Tag zu Tag. Die Verhöhnung und Verurteilung der Flüchtlinge in den eigenen Medien verstärkten die Wogen der Empörung. Der demokratische Aufbruch in der DDR war und ist wesentlich auch eine Revolution in den Medien und über die Medien“ (Hanke in: Burkart 1990: 144–148).