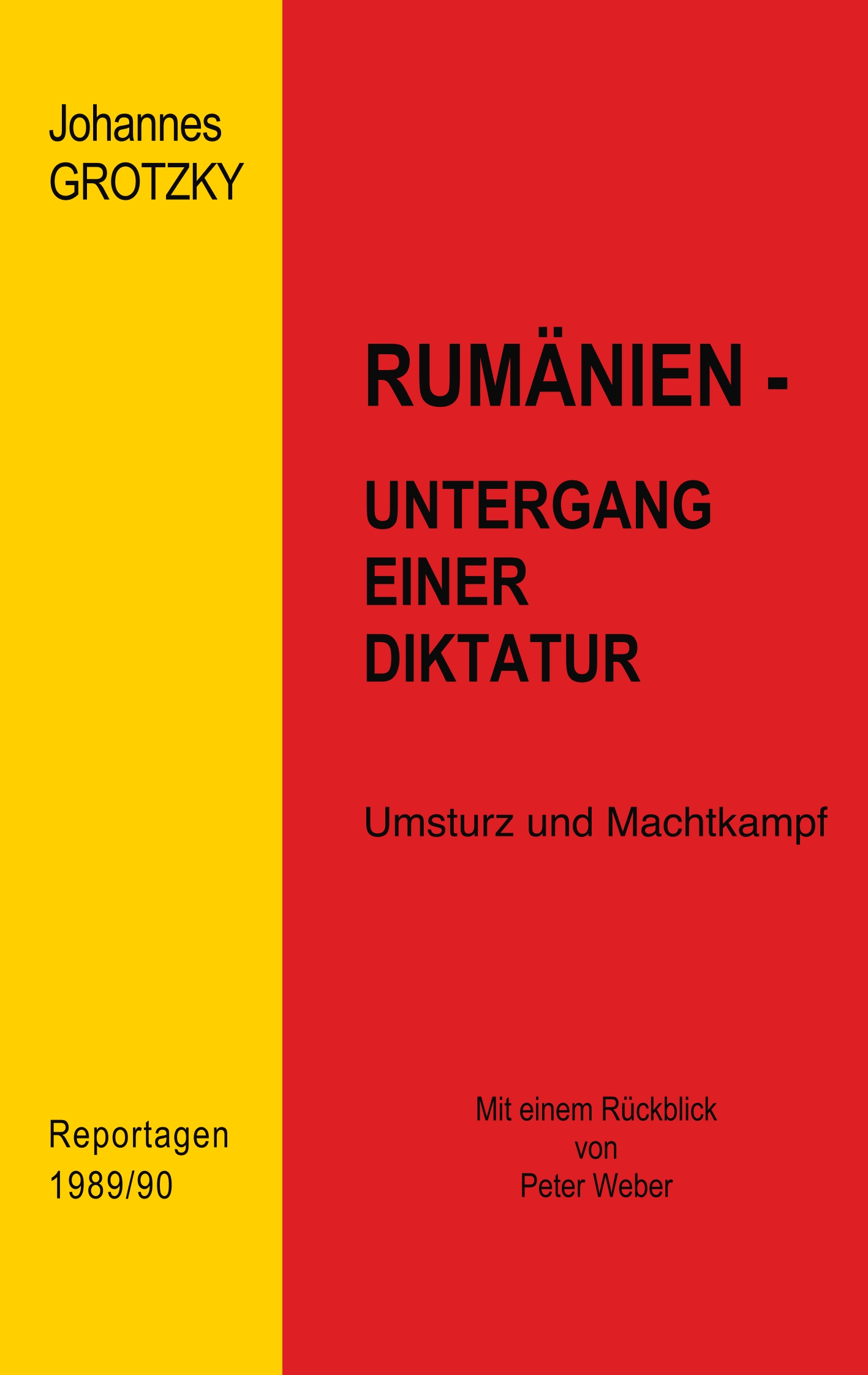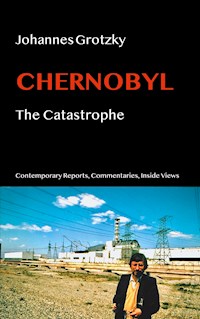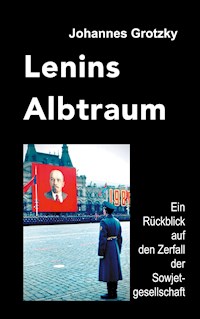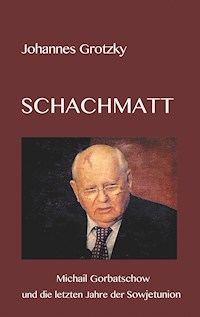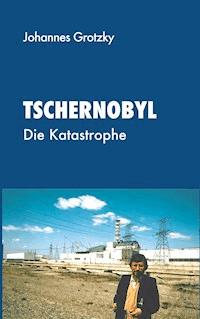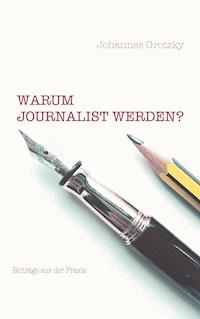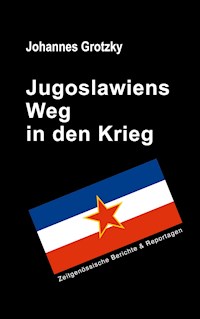
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch ist eine bedrückende Chronik der verpassten Chancen für einen friedlichen Wandel in Jugoslawien. Es schildert nicht den Kriegsverlauf selbst. Vielmehr wird der Weg des politischen Konfliktes zwischen den jugoslawischen Teilrepubliken bis hin zum Kriegsausbruch nachgezeichnet. Grundlage sind journalistische Tagesberichte, die aus der damaligen Perspektive authentisch das Geschehen schildern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Johannes GROTZKY, Dr. phil. (*1949), Studium der Slawistik, Balkanologie und Geschichte Ost- und Südosteuropas in München und Zagreb. Weitere Studienaufenthalte in Belgrad, Sarajewo und Skopje. 1983-1989 ARD-Hörfunkkorrespondent in Moskau. 1989-1994 Balkankorrespondent und Leiter des ARD-Hörfunkstudios Südosteuropa in Wien. Anschließend Chefkorrespondent, Chefredakteur sowie 2002-2014 Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks.
Honorarprofessor für Osteuropawissenschaften, Kultur und Medien an der Universität Bamberg.
Bücher über Südosteuropa: Balkankrieg: Der Zerfall Jugoslawiens und die Folgen für Europa (1993). Grenzgänge: Spurensuche zwischen Ost und West (2010). Fremde Nachbarn: Der Osten und Südosten Europas Ende des 20. Jahrhunderts (22012). Rumänien: Untergang einer Diktatur (22020).
INHALT
Vorweg ein Blick zurück
DER HERBST 1989
Slowenien wagt den ersten Schritt
Jugoslawischer Staatspräsident in Bonn
Der Schrecken der Inflation
Pluralismus als Herausforderung
DAS JAHR 1990
Ein Parteitag des Zerfalls in Belgrad
Der erste Tag
Der zweite Tag
Der dritte Tag
Eklat am vierten Tag
Streitfall Kosovo
Die Armee in Jugoslawien
Wahlkampf in Kroatien
Sloweniens weiterer Weg
Was wird aus Titos Konzeption?
Ein Moment der Solidarität
Nationale Gegensätze
Schicksalsfrage Kosovo
Explosive nationale Frage
Serben in Kroatien
Verfassungsreformen in Jugoslawien
Ist Jugoslawien noch zu retten?
Slowenien stoppt Bundesgesetze
Historische Rückbesinnung
Erste Eskalation
Später Rettungsversuch aus Belgrad
Keine Chance für Jugoslawien?
Im kroatisch-bosnischen Grenzgebiet
Rückkehr von Ban Jelačić in Zagreb
Dramatische Warnung aus Belgrad
Nationale Euphorie - nationale Spannung
Wahlen in Makedonien
Sarajewo
Religion und Nation in Bosnien
Wahlkampf in Bosnien
Wahlen in Serbien und Montenegro
Die Staatskrise
Sloweniens Zukunft
Krisengespräch vertagt
Rückblick auf ein Schicksalsjahr
DAS FRÜHJAHR 1991
Krisengipfel erneut vertagt
Erfolgloses Bemühen
Kroatien befürchtet Militärintervention
Viele Retter, keine Bewahrer
Und wieder ein Krisengipfel
Gerüchte und Propaganda
Massendemonstration in Belgrad
Umstrittener Armeeinsatz
Die Position Serbiens
Dissens in Belgrad
Demokratie und Stabilität im Widerspruch
Rückblick und Zwischenbilanz
Rücktritt des Staatspräsidenten
Mitteilung der Armee
Kroatiens Präsident spricht von Krieg
Ultimative Warnungen der Armee
Versuch einer Konflikteindämmung
Streit um die Deutungshoheit
Kompromiss wird ausgehöhlt
Serben in Kroatien
Missbrauchte Geschichte
Ein Kroate an der Spitze Jugoslawiens?
Eklat im Staatspräsidium
Die politische Blockade
Die Krise wird vertagt
Was sagt die Verfassung?
Zorn und Ratlosigkeit
Referendum in Kroatien
Kroaten für die Unabhängigkeit
Slobodan Milošević
Franjo Tudjman
Militärische Kraftprobe in Slowenien
Die Armee gibt nach
Ultimative Zuspitzung in Kroatien
Aussichten auf eine Lösung?
Jugoslawien erwartet US-Außenminister
USA will Jugoslawien erhalten
Jubel in Slowenien
Niemand glaubt an Krieg
Erste Drohungen der Armee
Der Krieg beginnt
Schlussbemerkung
Dokumente
Die Bevölkerung Jugoslawiens 1991
Literaturhinweise
Vorweg ein Blick zurück
Rückblickend werden Kriege in der Regel meist in der Zuordnung von Angreifern und Verteidigern, Opfern und Tätern, Verursachern und Leidtragenden dargestellt. Die Kriege in Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina und später im Kosovo werden dabei nicht so sehr als Ausdruck einer Erosion des politischen Systems gesehen; vielmehr steht bei den meisten Betrachtungen der nationale Aspekt der Kriegsparteien im Vordergrund, denn die nationale Frage war zweifellos ein Motor, der den Zerfall Jugoslawiens beschleunigt hat.
Ob die nationale Frage auch zwangsläufig zu einem Krieg hätte führen müssen, wird nur sehr selten hinterfragt. Stattdessen empfinden sich die vom Konflikt betroffenen Völker Jugoslawiens aus der jeweiligen eigenen Sicht als Opfernation und betrachten die jeweils anderen als Täternation. Die neu gegründeten Nationalstaaten beharren auf diesem Narrativ, egal ob es sich um Kroatien, Serbien, Montenegro oder Kosovo handelt. In Bosnien-Herzegowina stehen drei Nationen gegeneinander und blockieren das Funktionieren ihres Kunststaates. Und in Makedonien, jetzt Nordmazedonien, steht die wachsende albanische Minderheit einer einheitlichen nationalstaatlichen Identität entgegen.
Noch während des Jugoslawienkrieges haben es zwei andere Völker im östlichen Mitteleuropa geschafft, ihren bis dahin gemeinsamen Staat aufzulösen und sich friedlich zu trennen. Aus der Tschechoslowakei entstanden am 1. Januar 1993 die Tschechische Republik und die Slowakische Republik. Anlass dafür war auch die nationale Frage, die aber auf der Grundlage gemeinsamer demokratischer Werte gelöst werden konnte – und dies, obwohl die vorherige kommunistische Herrschaft in der Tschechoslowakei totalitärer war als in Jugoslawien.
Wie also kam es zu diesem Selbstvernichtungskrieg in Jugoslawien? Eine Antwort darauf geben heute Fachhistoriker, Politologen, Soziologen.1 Journalisten hingegen berichten das aktuelle Geschehen, Tag um Tag, Stunde um Stunde. Sie können aber nicht vorhersehen, wie sich die Ereignisse entwickeln werden, die erst im Nachhinein von Fachhistorikern endgültig bewertet werden.
Journalisten liefern zwar Informationen als Bausteine für eine spätere Geschichtsschreibung. Sie selbst aber schreiben keine Geschichte. Das entlastet den Journalismus jedoch nicht von der Verantwortung, nach bestem Wissen und Gewissen Fakten genau zu recherchieren sowie vorschnelle Urteile oder gar Vorurteile zu vermeiden. Gleichwohl liefert auch der Journalist Erlebnisberichte, Reportagen und Kommentare, in denen er sich selbst und seine Sichtweise einbringt.
Von diesen Elementen, dem sachlich recherchierten Bericht sowie der Reportage und den Kommentaren, ist das vorliegende Buch geprägt. Es ist kein Buch über den Kriegsverlauf in Jugoslawien selbst. Vielmehr wird der damalige Weg des politischen Konfliktes in Jugoslawien bis zum Kriegsbeginn hin nachgezeichnet.2 Ausgangspunkt ist die Verabschiedung einer neuen Verfassung in der nördlichsten Teilrepublik Slowenien am 27. September 1989. Darin wird die „Souveränität des slowenischen Volkes” verankert mit dem Recht auf Loslösung von Jugoslawien. Damit war der erste Stein aus dem Staatsgebäude Jugoslawiens herausgebrochen worden. Das Buch endet mit dem Kriegsbeginn am 27./28. Juni 1991, ebenfalls in Slowenien.
Der Verfassungsänderung in Slowenien sind politische Entwicklungen vorausgegangen, die überhaupt erst den Wunsch nach einem Umbau des jugoslawischen Staates hervorgebracht haben. Das Jugoslawien von Josip Broz Tito (1892-1980) sollte eine ausgewogene Machtbalance zwischen allen Völkern und Völkerschaften unter dem Slogan „Brüderlichkeit-Einheit“ (Bratstvo-Jedinstvo) garantieren. Dafür wurden aber innerstaatliche Grenzen gezogen, die nicht mit den ethnischen Siedlungsgrenzen vor allem der Kroaten und Serben übereinstimmten. Überdies vereinte das kommunistische Jugoslawien nach 1945 ehemalige Kriegsgegner aus dem Zweiten Weltkrieg in einem gemeinsamen Staat, nämlich den gescheiterten, faschistischen „Unabhängigen Staat Kroatien” mit jenen Landesteilen, die einen Partisanenkrieg gegen die deutschen Besatzer geführt hatten.
Als weitere Nation und eigene Teilrepublik wurde 1944/45 das südslawische Makedonien mit einer eigenen Nationalsprache konstituiert. Dies war seither ein Stein des Anstoßes für das ebenfalls slawische Bulgarien und das nordgriechische Makedonien. Die Bulgaren beanspruchten, dass es sich bei der neuen slawisch-makedonischen Sprache um Bulgarisch handele und es auch keine makedonische Nation gäbe. Griechenland wiederum akzeptierte nicht, dass sein historischer Anspruch auf Makedonien plötzlich von Tito und den slawischen Nachbarn im Norden vereinnahmt wurde. Letztlich boykottierten auch führende serbische Sprachwissenschaftler in Jugoslawien lange eine eigenständige makedonische Sprache, die für sie nichts anderes als ein südserbischer Dialekt war.
Ein zusätzlicher Konfliktherd der Gründerzeit von Titos Jugoslawien war das Kosovo, als autonome Provinz unter dem Namen Kosovo und Metohija geführt. In dieser Provinz liegen die serbisch-orthodoxen Klöster wie Gračanica, Dečani und vor allem das Patriarchenkloster Peć. Sie alle haben enorme Bedeutung für die historische Identität Serbiens. Gleichzeitig ist das Kosovo stets ein multiethnisches Gebiet mit einem großen albanischen Siedlungskern gewesen.
Im Jahr 1948, drei Jahre nach Titos Staatsgründung, wird für das Kosovo ein albanischer Bevölkerungsanteil von 68 Prozent ausgewiesen gegenüber 27 Prozent Serben. Bis zum Kriegsbeginn in Jugoslawien 1991 hatte sich dieses Verhältnis deutlich zugunsten der Albaner verändert, die bereits 82 Prozent der Bevölkerung stellten gegenüber nur noch 11 Prozent Serben. Seit dem Kosovo-Krieg 1998/99 und der Gründung einer selbständigen Republik Kosovo ist bis 2007 – bei einem albanischen Anteil von 92 Prozent – der serbische Bevölkerungsanteil auf fünf Prozent gefallen.3
Nach dem Tod Titos 1980 sollte ein ausgewogenes Rotationssystem für die Beteiligung aller Teilrepubliken und autonomen Gebiete an der zentralen Machtausübung sorgen. Die einzige parteipolitische Dachorganisation dafür war der Bund der Kommunisten Jugoslawiens (Savez komunista Jugoslavije). Doch parallel zu dem Zusammenbruch der kommunistischen Systeme und den ersten freien Wahlen in Mittel- und Südosteuropa 1989/1990 (Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien) entwickelte sich in Jugoslawien eine politische Asymmetrie. In Slowenien und Kroatien, später auch in Bosnien-Herzegowina und Makedonien lösten Mehrparteiensysteme die kommunistische Alleinherrschaft ab, während Serbien und Montenegro dem „Bund der Kommunisten”, teilweise später in „Sozialisten” umbenannt, auch bei den ersten freien Wahlen mehrheitlich die Treue hielten.
Der starke Mann in jener Zeit wurde der serbische Parteichef und später auch Präsident der Teilrepublik Serbien Slobodan Milošević. Er galt als der entscheidende machtpolitische Drahtzieher im Jugoslawienkonflikt, weswegen er später auch vor dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag angeklagt wurde.4
Die politische Einschätzung von Milošević ist vielschichtig. Er instrumentalisierte die serbische Frage zwar politisch, unter anderem mit einer nie unzweideutig dokumentierten Rede5 auf dem Kosovo polje (Amselfeld) am 28. Juni 1989 zum 600. Jahrestag der Schlacht auf dem Amselfeld. Diese Schlacht führte zum Kosovo-Mythos, der die Serben als Opfer der osmanischen Besatzung auf dem Balkan würdigt. Milošević nahm diesen Gedanken auf mit der Zielrichtung, dass die „Zeit der damaligen Erniedrigung für Serbien abgelaufen ist”. Gleichwohl bekannte sich Milošević zum multiethnischen Staat als Vorteil für die Gesellschaft.6
Es war immer zu simpel, in Milošević einfach den kämpferischen serbischen Nationalisten zu sehen. Seine national-serbische Argumentation wurde kontrastiert von einer parallelen Haltung des späteren kroatischen Präsidenten Franjo Tudjman und auch des bosnischen Präsidenten Alija Izetbegović. Stattdessen übertrafen die – teilweise vom Westen hofierten – serbischen Politiker Vuk Drašković und Vojislav Šešelj mit ihrer nationalistischen Agitation den serbischen Präsident Milošević bei weitem. Doch der machtpolitische Wille von Milošević wurde lange unterschätzt.
Die Tragik des Jugoslawienkonfliktes bestand unter anderem darin, dass die europäischen Nachbarn und auch die USA um jeden Preis den Gesamtstaat in der Konzeption von Tito erhalten wollten, ohne die politische Asymmetrie und die machtpolitische Entschlossenheit des serbischen Präsidenten zu erkennen. Denn die Auflösung der autonomen Gebiete in Serbien durch Milošević, die Entmachtung seiner Gegner, die Gleichschaltung der Medien – dies alles wurde kaum wahrgenommen.
Ein weiterer tragischer Aspekt war die Verweigerung der damaligen Europäischen Gemeinschaft und der Pentagonale7, jene Mehrheit von Teilrepubliken (Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Makedonien) zu unterstützen, die zwar Jugoslawien erhalten wollten, aber nicht als Bundesstaat (Föderation), sondern als Staatenbund (Konföderation). Bei diesem Prozess hätte sich eine Moderation der EG wie auch der KSZE (Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) angeboten.
Ein dritter Aspekt ist ganz sicher die Überforderung Europas durch den fast zeitgleichen Zusammenbruch der kommunistischen Regime in Mittelosteuropa und durch die Folgen der Perestrojka in der Sowjetunion unter Michail Gorbatschow gewesen. Man muss daran erinnern, dass nur eineinhalb Monate nach dem Kriegsbeginn in Jugoslawien 1991 in Moskau der August-Putsch gegen Michail Gorbatschow stattfand, der die Welt in Atem hielt, zum politischen Sturz von Gorbatschow und vier Monate später zur Auflösung der Sowjetunion geführt hat.
Diese dramatischen Vorgänge hatten kaum Aufmerksamkeit gelassen für die doch sehr schwer zu verstehenden innenpolitischen Abläufe. Davon waren einerseits sechs Teilrepubliken und zwei autonome Gebiet betroffen sowie andererseits das Staatspräsidium, die Bundesregierung in Belgrad sowie die jugoslawische Armee.
Zur Illustration dieser schwierigen Sachlage sind dem Buch zwei Dokumente beigefügt:
Ein Aufruf des Oberkommandos der Armee vom März 1991, also drei Monate vor dem Kriegsausbruch, der zeigt, wie Jugoslawien – trotz gegenteiliger Beteuerung – kurz vor einer möglichen Machtübernahme durch die Armee stand. Und ein danach folgender, eher verzweifelter Aufruf des Staatspräsidiums sechs Wochen vor Kriegsausbruch, mit dem der bereits schwelende innenpolitische Konflikt mit Hilfe der Armee wieder eingedämmt werden sollte.
Zwei Zeitungstitel aus Slowenien und Kroatien sind ebenfalls beigefügt. Sie verkünden die Unabhängigkeitserklärungen, die zwei Tage später von der jugoslawischen Armee mit einem militärischen Eingreifen beantwortet wurden.
Die hier dokumentierten Texte wurden als Beiträge und Reportagen für die öffentlich-rechtlichen Hörfunkprogramme der ARD verfasst. Sie sollen drei Jahrzehnte nach dem Kriegsbeginn in Jugoslawien daran erinnern, was damals von vielen nicht wahrgenommen wurde: Konflikte und Kriege entstehen nicht über Nacht. Doch für diese Erkenntnis ist es im Nachhinein oft zu spät.
Dem Leser wird auffallen, dass zwei so entscheidende Personen wie der bosnische Serbenführer Radovan Karadžić und der bosnisch-serbische General Ratko Mladić in diesen Berichten nicht vorkommen. Sie sind politisch und militärisch erst später in Erscheinung getreten, waren dann aber bis 1995 beherrschende Figuren des Bosnien-Krieges. Dafür wurden sie vor dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien angeklagt.
Allerdings gelang es ihnen, sich viele Jahre den Ermittlern zu entziehen. So konnten Radovan Karadžić8 erst dreizehn Jahre und Ratko Mladić9 erst 16 Jahre nach Beendigung des Bosnienkrieges gefasst, nach Den Haag ausgeliefert und vor Gericht gestellt werden.
1 Vgl. dazu das Kapitel Literaturhinweise S. 241 ff. in diesem Buch.
2 Der aktuellen Tagesberichterstattung entsprechend, kommt es in einzelnen Kapiteln zu inhaltlichen Wiederholungen, die aber im jeweiligen Zusammenhang für das Verständnis notwendig sind.
3 Quelle ist die serbische Wikipedia-Seite unter Berufung auf die Statistik der Provinz Kosovo und Metohija (bis 1991) sowie der OSCE unter https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B5 (Aufruf 21.1.2021).
4 Gegen Milošević wurden 66 Klagepunkte in drei Anklageschriften vorgebracht. Am 11. März 2006 wurde er in seiner Gefängniszelle in der United Nations Detention Unit in Den Haag tot aufgefunden, laut Obduktion ein Herzinfarkt. Daraufhin wurde das Verfahren gegen ihn nach viereinhalb Jahren ohne Urteil und ohne Abschlussbericht eingestellt.
5https://de.wikipedia.org/wiki/Amselfeld-Rede (Aufruf 18.1.2021).
6 ebd.
7 Erhard Busek, österreichischer Vizekanzler, initiierte im Herbst 1989 eine Kooperation der fünf Staaten Italien, Jugoslawien, Ungarn, Tschechoslowakei und Österreich als Antwort auf die politische Wende in Mittelosteuropa.
8 Der studierte Psychiater Karadžić hatte nach dem Krieg sein Erscheinungsbild stark verändert und lebte bis zu seiner Verhaftung unter dem Decknamen Dragan David Dabić unbehelligt in der jugoslawischen Hauptstadt Belgrad, wo er in einer Praxis für alternative Medizin beschäftigt war. Seine neue Identität hatte er von einem serbischen Bauern mit dessen Papiern übernommen. Am 21. Juli 2008 wurde Karadžić verhaftet. Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Radovan_Karad%C5%BEi%C4%87(Aufruf am 8.3.2021).
9 General Mladić soll sich zunächst einige Jahre auf der Flucht in Serbien, der bosnisch-serbischen Republika Srpska und in Russland befunden haben, ehe er bis 2002 unbehelligt bei seinem Sohn in Belgrad gelebt hat. Anschließend sollen ihm bis zu 130 Sympathisanten – vor allem aus der ehemaligen jugoslawischen Armee – mit weiteren Verstecken geholfen haben. 2010 beantragte seine Familie – mutmaßlich zur Ablenkung – eine gerichtliche Todeserklärung für Mladić.
Die USA hatten ein Kopfgeld von 5 Mio. Dollar und die serbische Regierung ein Kopfgeld von 10 Mio. Euro auf Mladić ausgesetzt. Am 26. Mai 2011 wurde er in Lazarevo, Serbien, verhaftet.
Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Ratko_Mladi%C4%87
(Aufruf 8.3.2021).
Der Herbst 1989
26. Februar 1989 Einsatz der paramilitärischen Bundespolizei, später unterstützt durch Panzereinheiten der Armee, gegen Albaner im Kosovo, die zugunsten des entmachteten Kosovo-Parteichefs Azem Vllasi demonstrieren.
28. Februar 1989 Gegendemonstration von einer Million Serben gegen den „albanischen Nationalismus“ im Kosovo. Belgrad verhängt Ausnahmezustand im Kosovo.
2. März 1989 Beginn einer Verhaftungswelle im Kosovo. Dabei wurde auch der gestürzte kommunistische Parteichef des Kosovo Azem Vllasi festgenommen.
28. März 1989 Neue serbische Verfassung schränkt die Autonomierechte der Provinzen Vojvodina und Kosovo ein.
8. Mai 1989 Slobodan Milošević wird Präsident der Teilrepublik Serbien.
28. Juni 1989 Amselfeld-Rede von Slobodan Milošević.
27. September 1989 Die neue Verfassung Sloweniens spricht von der „Souveränität des slowenischen Volkes” und verankert das Recht auf Loslösung von Jugoslawien.
1./2. November 1989 Neue Zusammenstöße im Kosovo mit ersten Toten.
12. November 1989 Slobodan Miloševič wird bei der ersten Direktwahl als Präsident der Republik Serbien bestätigt.
Slowenien wagt den ersten Schritt
27. September 1989
In der jugoslawischen Teilrepublik Slowenien soll heute der politische Aufstand geprobt werden. Trotz ernsthafter Warnungen der Zentralregierung aus Belgrad wollen die Slowenen ihre Verfassung ändern. Die jetzt vorgesehene Änderung würde Slowenien erlauben, aus dem Bundesstaat Jugoslawien auszutreten und sich einem anderen Staatenverband anzuschließen. Die umstrittene Formulierung sieht wörtlich vor „das unverzichtbare Recht auf Selbstbestimmung, die auch das Recht auf Abtrennung und Zusammenschluss beinhaltet.”
Die Slowenen betrachten dies als eine Schutzmaßnahme gegen zunehmende Zentralisierungstendenzen in Jugoslawien. Sie fordern ein neues Recht auf Selbstbestimmung des slowenischen Volkes. Die Abgrenzung gegen die Zentrale in Belgrad wird auch in den anderen geplanten Zusätzen zur Verfassung deutlich. So soll die Verfassung künftig der slowenischen Regierung erlauben, Schutzmaßnahmen gegen Beschlüsse der Bundesregierung zu ergreifen, wenn deren zentrale Beschlüsse die slowenischen Interessen beeinträchtigen könnten.
Eine weitere Provokation Belgrads, aber auch eine Verletzung der jugoslawischen Bundesverfassung, ist die Forderung der Slowenen, dass nur ihr eigenes regionales Parlament den Notstand verhängen oder Sondermaßnahmen beschließen kann und nicht mehr die Zentralregierung. Die entscheidende Sitzung, in der die slowenische Verfassung in diesem Sinn geändert werden soll, tritt heute in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana zusammen, obwohl noch bis zum späten Abend aus Belgrad massive Warnungen und Vorbehalte zu hören waren.
***
Als am frühen Morgen das Zentralkomitee der jugoslawischen Kommunisten die anstehende Verfassungsreform kritisierten und verlangten, die Abstimmung darüber auszusetzen, waren die 268 slowenischen Abgeordneten fest entschlossen, sich dem Urteil der Zentrale nicht zu beugen. Drei Jahre lang ist die Verfassungsreform, vorbereitet worden, drei Monate dauerte bereits die aktuelle, politische Debatte. Die Slowenen machen geltend, dass in jüngster Zeit eine unzulässige Zentralisierung unter serbischer Führung in Jugoslawien um sich greife.
Der slowenische Parteichef Milan Kučan beschuldigte die serbische Führung, sich für eine Abschaffung der Souveränität der Teilrepubliken einzusetzen. Die letzte Nachtsitzung des Belgrader Zentralkomitees der Kommunistischen Partei (Bund der Kommunisten Jugoslawiens) und die Debatte im slowenischen Parlament zeigen, das im post-titoistischen Jugoslawien der Riss innerhalb der Kommunisten und zwischen den Republiken noch nie so tief war wie heute.
***
Stürmischer Beifall der slowenischen Abgeordneten brauste auf, als ihr Parlamentspräsident mit Entschiedenheit den politischen Druck aus Belgrad zurückwies. Die Slowenen, so sagte er, seien fest entschlossen, ihre umstrittene Verfassungsänderung durchzusetzen. Doch statt einer zügigen Abstimmung kam es erneut zu einer stundenlangen Debatte um die Reform, die sich nach Meinung der Kritiker als Sprengstoff für die Einheit Jugoslawiens erweisen kann.
In einem anderen Punkte hatte Slowenien schon vorher eingelenkt. Ursprünglich wollte die Teilrepublik über den Einsatz der jugoslawischen Armee auf dem Territorium Sloweniens selbst entscheiden. Aber auch die abgeschwächte Form rief in Belgrad heftige Kritik hervor: Die Slowenen halten weiter daran fest, dass niemand ohne Zustimmung des slowenischen Parlaments den Ausnahmezustand erklären dürfe. Dies aber ist laut Bundesverfassung das Recht des jugoslawischen Staatspräsidiums in Belgrad.
***
28. September 1989
Protestdemonstrationen und Jubelbeflaggung kennzeichnen das widersprüchliche Bild eines tiefen Konfliktes in Jugoslawien nach der Verfassungsreform in der Teilrepublik Slowenien. Das Belgrader Fernsehen berichtete von teilweise Zehntausenden, die als Protest gegen den – wie es heißt – beginnenden Separatismus in Slowenien auf die Straße gegangen seien. Umgekehrt wurde in mehreren slowenischen Gemeinden die Bevölkerung nach der erfolgreichen Abstimmung dazu aufgerufen, aus Freude über die Verfassungsänderungen ihre Häuser zu beflaggen.
Nahezu einstimmig hatten sich alle Kammern des slowenischen Parlaments für die lange diskutierte Verfassungsreform ausgesprochen. Unter den insgesamt 258 Abgeordneten gab es lediglich eine Enthaltung und eine Neinstimme. In der slowenischen Hauptstadt Ljubljana sprach man von einer historischen Stunde. Kernpunkt des jugoslawischen Konfliktes ist jedoch nicht so sehr das nun verbriefte Recht Sloweniens, aus dem jugoslawischen Bundesstaat austreten zu können. Ein solches Recht ist zum Beispiel auch in der Verfassung der benachbarten Teilrepublik Kroatien garantiert.
Die Belgrader Zentrale ist vielmehr über zweierlei empört:
Zum einen über die Tatsache, dass sich Slowenien offen gegen die Bundesverfassung stellt. Und zwar mit dem Anspruch, dass der Ausnahmezustand und die damit zusammenhängenden Maßnahmen nur vom slowenischen Parlament genehmigt werden können. Dies ist bislang das verbriefte Vorrecht der Bundesregierung, die wiederum in den Augen der Slowenen dieses Recht beispielsweise bei der Niederschlagung der nationalen Unruhen im Kosovo missbraucht hat.
Der zweite Punkt, über den sich Belgrad so sehr aufregt, ist die internationale Medienwirksamkeit, die Slowenien nun zu einem Vorreiter der politischen Liberalisierung und des Kampfes gegen serbische Zentralismusbestrebungen macht. Entsprechend hat sich der Konflikt auch innerhalb der Kommunistischen Partei verschärft, die in Jugoslawien Bund der Kommunisten heißt.
Als Politik der Nadelstiche wird auch empfunden, dass die Verfassungsreform in Slowenien den nationalen Minderheiten von Italienern und Ungarn autonome Rechte einräumt. “Was aber ist mit den Serben, die in Slowenien leben und arbeiten?”, so wird gegen diesen Minderheitenschutz polemisiert. Denn Slowenien bietet als eine Insel des Wohlstandes Arbeitsplätze für viele Einwohner aus anderen Teilen Jugoslawiens. Obwohl der Anteil der Slowenen in Jugoslawien nur acht Prozent an der Gesamtbevölkerung ausmacht, erarbeitet die Teilrepublik zwanzig Prozent des gesamten Nationaleinkommens und sogar 25 Prozent des gesamten jugoslawischen Exportes.
Daher will Slowenien die Verfassungsreform nutzen, um auch außenwirtschaftlich flexibler zu sein, um gegebenenfalls nach 1992 enger mit der Europäischen Gemeinschaft kooperieren zu können.
***
29. September 1989
Durch die Verfassungsreform in Slowenien ist die Frage nach dem politischen Wesen des jugoslawischen Staates aufgeworfen worden. Die Ideale der Ära Tito unter dem Schlagwort Bratstvo-Jedinstvo, Brüderlichkeit-Einheit, hatten spätestens mit dem Tod des Staatsführers einen erheblichen Teil ihrer Wirkung eingebüßt. Denn zu sehr war der Zusammenhalt des Landes von der Figur des Partisanenführers in der Rolle eines jugoslawischen Übervaters und Präsidenten auf Lebenszeit, Josip Broz Tito, geprägt worden – und auch von ihm abhängig gewesen.
Insgeheim jedoch pflegten die meisten der sechs Teilrepubliken sowie die autonome Provinz Kosovo ein nationalgeschichtliches Selbstbewusstsein, das im Grunde auch nach einer eigenen Staatlichkeit verlangte. Der Wunsch nach mehr Souveränität der einzelnen jugoslawischen Völker wurde dann mit zunehmenden Wirtschaftsproblemen immer lauter.
Schon zu Beginn der 1970iger Jahre hatte die nationalkroatische Bewegung in der Nachbarrepublik zu Slowenien mit dem sogenannten Kroatischen Frühling (Hrvatsko proljeće) für eine heftige Erschütterung im Land gesorgt. Damals wurde bereits das Solidarprinzip des jugoslawischen Bundesstaates in Abrede gestellt und als nachteilig für die besser entwickelten Gebiete empfunden.
Nur: damals lebte noch Tito. Und sein massives Eingreifen in die kroatischen Partei- und Republikführung, sein Säuberungsprozess unter den sogenannten separatistischen Kadern, erzwang deren Bekenntnis zum kommunistischen Jugoslawien.
Heute ist die Lage qualitativ anders. Jugoslawien leidet unter drückenden Auslandsschulden, einer unvorstellbaren Inflation und hoher Arbeitslosigkeit. Heute gibt es keine gesamtjugoslawische Integrationsfigur mehr. Heute gibt es nationale Führer, die gerade unter dem Anspruch einer Nationalität ganz Jugoslawien führen wollen. Die schwierigste Rolle spielt dabei der Bund der Kommunisten Serbiens unter Führung von Slobodan Milošević. An der leidigen Sprachenfrage ist – wie immer schon – sichtbar, dass der Weg zu einer stärkeren Differenzierung anstatt zu einer größeren Einheit führt. Was mit viel Mühe als gemeinsame serbokroatische Sprache seit 1945 normiert wurde, muss nun auf politischen Vorgaben hin wieder von den Wissenschaftlern in Kroatisch und Serbisch auseinanderdefiniert werden.10
Was von vielen als „großserbischer Anspruch“ empfunden wird, ist in der Tat bereits die inhaltliche Aufkündigung eines Bundesstaates mit gleichberechtigten Teilrepubliken und der Etablierung einer paradoxen Variante, nämlich einen selektiven Zentralismus zu betreiben. Genau hierzu bilden die Slowenen das Gegengewicht, indem sie mit dem Pochen auf Souveränität zwar das ursprüngliche jugoslawische Konzept stark konterkarieren, sich dazu aber durch die jüngste Entwicklung gezwungen fühlen. Auch hier spielt die Unterstreichung einer wiederum eigenen, slowenischen Sprache eine nicht unerhebliche Rolle für die nationale Identität der Slowenen. Es liegt jedoch in der politischen Logik, dass Slowenien mit seiner Reform nicht Verursacher der Auseinandersetzung ist, sondern konsequenterweise den Versuch wagt, für sich zu retten, was zu retten ist.
Als drohendes Fernziel schwebt über solchen politischen Diskussionen die Angst vor einem Zerfall des jugoslawischen Staates. Die betrübliche Erkenntnis daraus lautet: Das Solidarprinzip eines selbstverwalteten Jugoslawiens geht verloren. Insofern haben beide Seiten, Kritiker und Befürworter der slowenischen Verfassungsreform, Recht, wenn sie von einer historischen Zäsur sprechen.
30. November 1989
Seit heute Nacht gelten in der jugoslawischen Teilepublik Slowenien Sondermaßnahmen, mit der die Bewegungsfreiheit im Land erheblich eingeschränkt wird. Damit will sich Slowenien gegen den Zustrom demonstrierender Serben schützen, die sich zu Tausenden für ein sogenanntes Wahrheits-Meeting in die slowenische Hauptstadt Ljubljana begeben wollten. Mit seinen Schutzmaßnahmen hat Slowenien praktisch seine innerjugoslawischen Republikgrenzen geschlossen.
Der Hintergrund dieses Konfliktes ist ein Streit um das serbische Vorgehen in der Provinz Kosovo, die überwiegend von Albanern bewohnt ist. Slowenien hatte mehrfach das serbische Durchgreifen gegenüber diesen Albanern heftig kritisiert, unter anderem mit dem Vorwurf, die Serben verhielten sich gegenüber den Albanern wie Nazideutschland gegenüber den Juden. Auch der Prozess gegen den albanischen Parteichef vom Kosovo Azem Vllasi, der für nationale Unruhen in seiner Provinz verantwortlich gemacht wird, ist von Slowenien als politischer Prozess verurteilt worden.
Nach Verhängung der slowenischen Sondermaßnahmen aufgrund einer umstrittenen Verfassungsänderung hat der Innenminister in Belgrad offiziell davor gewarnt, dass Slowenien nun mit Gewalt gegen mögliche Demonstranten vorgehen werde. Die Sozialistische Allianz Serbiens, ein Dachverband der Partei und gesellschaftlicher Gruppen, hat das slowenische Verhalten als einen „ungeahnten Angriff auf Menschenrechte und Menschenfreiheit” verurteilt und zu einem totalen Boykott der nördlichen Teilrepublik aufgerufen. Gleichzeitig hat die Wirtschaftskammer in Belgrad alle Firmen aufgefordert, ab sofort alle geschäftlichen Beziehungen mit Slowenien abzubrechen. Einige Organisatoren der geplanten Demonstration haben daraufhin bereits ihre Fahrt nach Ljubljana abgesagt.
10 Vgl. Grotzky, Johannes: Anmerkungen zu Desintegration und Neunormierungen im serbisch-kroatischen Sprachgebiet. In: Im Rhythmus der Linguistik: Festschrift für Sebastian Kempgen zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Anna-Maria Meyer und Ljiljana Reinkowski unter Mitarbeit von Alisa Müller. Bamberger Beiträge zur Linguistik. Band 16, 2017, S. 201-226.
Jugoslawischer Staatspräsident in Bonn
3. Dezember 1989
Fünfzehn Jahre hat es gedauert, bis nach Josip Broz Tito wieder ein jugoslawischer Staatspräsident Bonn besucht. Doch diese Visite wird von innen- und außenpolitischen Ereignissen überlagert.
Die Reformen in Osteuropa haben die Aufmerksamkeit des Westens weitgehend von Jugoslawien abgelenkt, obwohl der Vielvölkerstaat auf dem Balkan ebenfalls in einem angespannten Prozess wirtschaftlicher und politischer Reformen steht. Stattdessen gilt Jugoslawien, besonders seit dem jüngsten Aufflammen des Nationalitätenkonfliktes, als ein Land, das sich nicht einmal auf eine gemeinsame föderative Struktur einigen kann. Noch krasser sind die Probleme zu Tage getreten, seit innerhalb des Landes von Belgrad gegen die nördliche Teilrepublik Slowenien ein Wirtschaftsboykott verhängt worden ist.
Das Pikante an dem Staatsbesuch ist nun, dass der amtierende Präsident, der im Rotationssystem nur ein Jahr im Amt bleibt, derzeit der Slowene Janez Drnovšek ist. Er wird sich in Bonn die Frage gefallen lassen müssen, wen er repräsentiert – seine boykottierte Heimatrepublik Slowenien oder den Rest Jugoslawiens. In Belgrad selbst ist man bemüht, nach außen Normalität zu demonstrieren. Deshalb wird der jugoslawische Präsident auch nicht schlicht als Bittsteller für neue Kredite in Bonn auftreten, sondern für mehr Kapitalanlagen in gemischten Unternehmen werben, um die Wirtschaftsreform zu beschleunigen. Bonn soll sich auch für eine stärkere Berücksichtigung Jugoslawiens in der EG und im Europarat einsetzen.
Das Land möchte angesichts der westeuropäischen Hilfsbereitschaft gegenüber Ungarn und Polen nicht ins Hintertreffen geraten. Überdies argumentiert Jugoslawien mit engen Bindungen an die Bundesrepublik, allein schon durch sechshunderttausend Gastarbeiter. Umgekehrt kommen jährlich 2,8 Millionen Bundesbürger als Touristen nach Jugoslawien. Angesichts dieser Kontakte erscheint es heute noch für die Belgrader Regierung unverständlich, dass die Bundesrepublik die Wiedereinführung der Visumspflicht für jugoslawische Staatsbürger erwogen hat. Hierzu dürfte der jugoslawische Präsident ein endgültiges, klärendes Wort erwarten. Anlass zu dieser Debatte waren bundesdeutsche Befürchtungen, aus Jugoslawien kämen zu viele Asylbewerber. Schlimmer ist für Belgrad der Vorwurf, der auch aus Slowenien unterstützt wird, man veranstalte als einziges europäisches Land noch politische Prozesse.
Der Kampf gegen die Kosovo-Albaner, von Serbien nicht gerade mit zarter Hand geführt, verlieh diesem Vorwurf brisante Aktualität. Entsprechend deutlich äußerte sich Bundespräsident von Weizsäcker jetzt im jugoslawischen Fernsehen mit dem Hinweis: jeder müsse die Möglichkeiten haben, zu Hause nicht von anderen beherrscht zu werden. Denn alle gewaltsamen Unterdrückungsmaßnahmen – so mahnte der Bundespräsident – schlagen früher oder später zurück.
18. Dezember 1989 Radikale Wirtschaftsreform. Abwertung der Landeswährung Dinar 1: 10.000.
Der Schrecken der Inflation
18. Dezember 1989