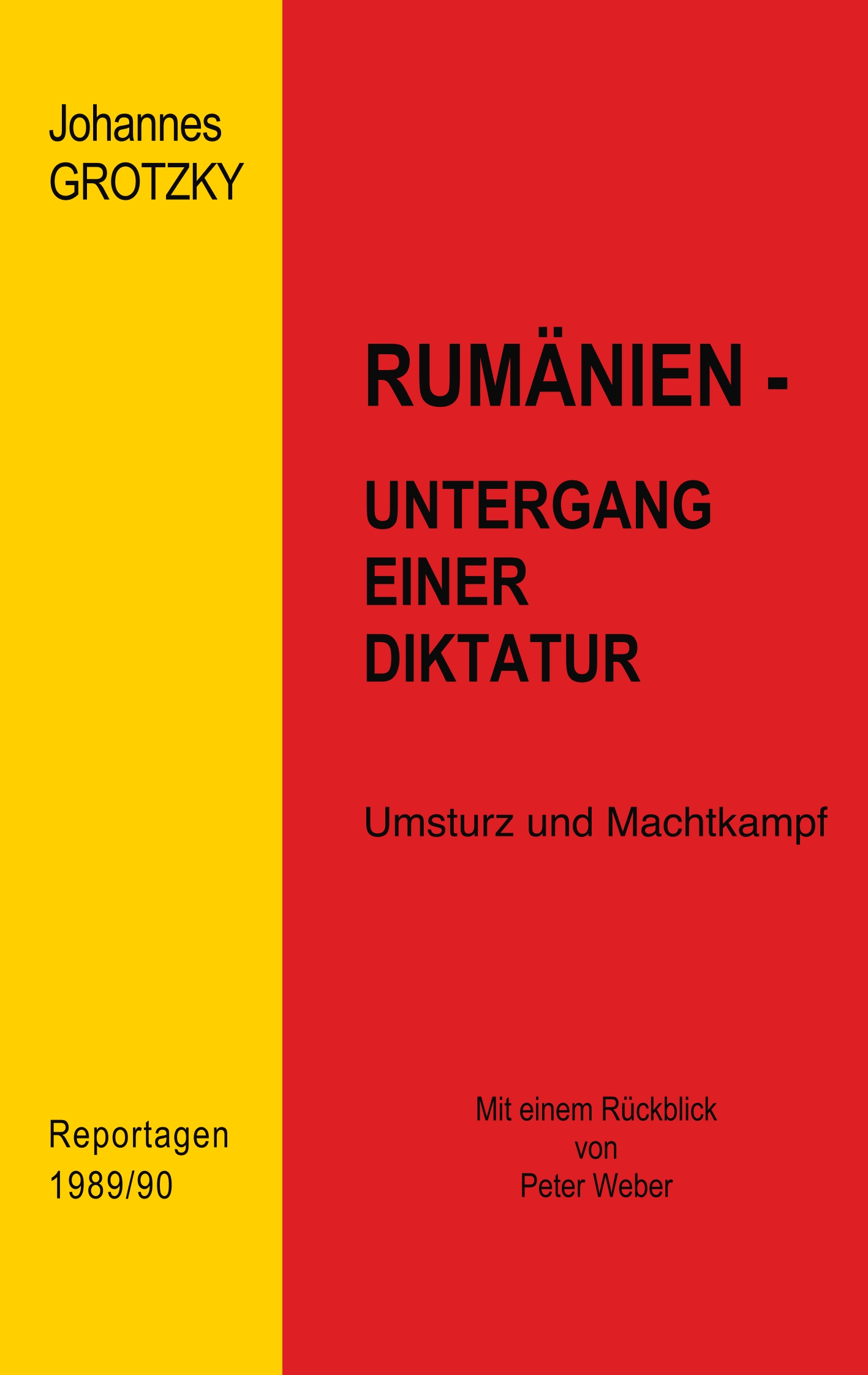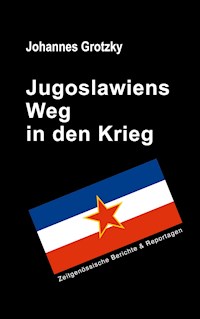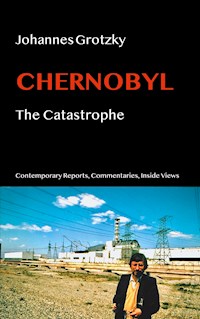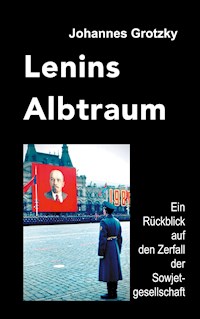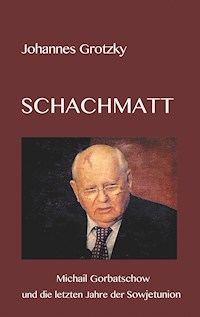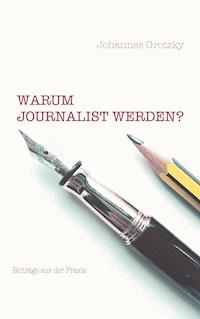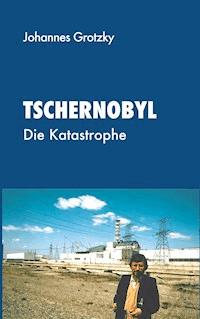
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Tausende von Publikationen über Tschernobyl konnten sich Jahre nach der Katastrophe auf inzwischen gesicherte Informationen berufen. Doch wie bei jedem Konflikt gab es auch während der Katastrophe eine - das Ereignis begleitende - Berichterstattung, die gekennzeichnet war von Nicht-Wissen, von Informationsdefiziten und Informationsunterschlagungen, von Spekulationen, Ängsten und Gerüchten. Davon handelt dieses Buch mit zeitgenössischen Berichten, Kommentaren und Rückblicken. In jener Zeit gab es weder Handy noch Internet, weder Satelliten-TV noch E-Mail, weder Facebook noch Twitter, Snapchat oder Instagram. Nur über Kurzwelle waren im Radio aktuelle Informationen aus dem Ausland zu empfangen. Auslandskorrespondenten in Moskau durften nicht einmal frei telefonieren, weder innerhalb der Sowjetunion noch ins Ausland. Unter diesen Bedingungen sind die hier dokumentierten Texte entstanden. Sie werden ergänzt von einer rückblickenden Einschätzung drei Jahrzehnte nach der Katastrophe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Johannes GROTZKY, Dr.phil. (*1949)
Studium der Slawistik, Balkanologie und Geschichte Ost- und Südosteuropas in München und Zagreb. 1983-1994 ARD-Korrespondent in Moskau und Wien (Südosteuropa). 2002-2014 Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks. Honorarprofessor für Osteuropawissenschaften, Kultur und Medien an der Universität Bamberg.
Inhalt
Warum dieses Buch?
Zur Chronologie der Katastrophe
Belastungen für die Zukunft
Wie alles begann
1986
In der Presse keine Zeile
Weiterhin Schweigen
Irreführung
Erste Reaktionen
Kritik am Westen
Erste Bilder im Fernsehen
Brief des westdeutschen Botschafters in Moskau (I)
Der Zeitpunkt der Explosion
Mehr Fragen als Antworten
Chef der IAEA korrigiert Moskau
Kritik und Umschwung der Informationspolitik
Was bisher geschah
Beruhigungskampagne der Medien
Brief des westdeutschen Botschafters in Moskau (II)
Erste TV Reportage vor Ort
Wirtschaftliche Folgen
Gorbatschow fordert Konsequenzen
Hilfe aus den USA
Offene Reaktionen
Armand Hammer
Dreißigtausend Quadratmeter entseucht
Mehrfrontenkrieg
Ratschläge gegen Radioaktivität
Akademiemitglied Welichow zum Unglück
Erster Untersuchungsbericht
Ein Rockstar betet um Errettung
Der Kampf wird fortgesetzt
Verantwortliche benannt
Gorbatschows Abrechnung
Mythen und Wirklichkeit
Keine kritische Jugend
Leserdiskussion zur Kernenergie
TV Dokumentation weckt hohe Erwartungen
Immer noch Unklarheiten
Die Folgen von Tschernobyl
Heroischer Kampf auf dem Bildschirm
Jahresrückblick
1987
„Warnung” - Neuer Dokumentarfilm über Tschernobyl
Urteile im Tschernobyl Prozess
Kommentar zum Urteil im Tschernobyl Prozess
1988
Zwei Jahre Tschernobyl
Besuch in Tschernobyl
1989
Gorbatschow in Tschernobyl
Tschernobyl nach drei Jahren
30 Jahren später - Rückblick auf die Katastrophe
Warum dieses Buch?
Die Deutsche Nationalbibliothek verfügt über 800 deutsche Buchtitel zum Themenbereich Tschernobyl.1 Noch eindrucksvoller ist eine Recherche im internationalen Bereich. Der Hollis-Katalog der Harvard Library, die 79 Bibliotheken umfasst und mit einem Bestand von 16,8 Millionen Bänden zu den größten Bibliotheken der Welt zählt, weist fast 108.000 Publikationen2 aller Medienarten (Bücher, Zeitschriftenartikel, Dissertationen, Online basierte Materialien, Videos, Konferenzpapiere, Vorträge)3 in zahlreichen Sprachen - darunter auch Russisch - zur Katastrophe von Tschernobyl aus. Ergänzt um die transkribierte ukrainische Schreibweise „Chornobyl” kommen weitere fast 5.000 Titel hinzu. Im Grunde genommen ist jeder erdenkliche Aspekt der Katastrophe aus jedem Blickwinkel beleuchtet. Fast alle Fakten sind mit wenigen Ausnahmen bekannt4. Die Verantwortlichen sind benannt und zur Rechenschaft gezogen. Die Opfer, die der Katastrophe erlegen sind, und jene Opfer, die ein Leben lang an den Folgen der Verseuchungen werden leiden müssen, haben öffentliche Anteilnahme erhalten, wenngleich niemand diese furchtbaren Schäden an Leib und Leben jemals wirklich wiedergutmachen kann.
Warum also jetzt dieser kleine Band zu Tschernobyl, nachdem alles Entscheidende publiziert worden ist?
Alles, was nach der Katastrophe von Tschernobyl veröffentlicht wurde, konnte sich im Rückblick auf viele Informationen und Erkenntnisse berufen. Insofern gilt für diese Bestandsaufnahme dieselbe Regel wie für die Kriegsberichterstattung: Die wirkliche Berichterstattung findet erst nach Abschluss des Krieges statt, wenn alle Quellen zugänglich sind und alle Seiten gehört wurden.
Doch wie in jedem Krieg gab es auch während der Katastrophe von Tschernobyl eine - das Ereignis begleitende - Berichterstattung, die teilweise gekennzeichnet war von Nicht-Wissen, von Informationsdefizit und Informationsunterschlagung, von Spekulationen, Ängsten und Gerüchten. Und genau davon handelt dieses Buch.
Als Korrespondent in Moskau von 1983 bis 1989 konnte ich die Agonie unter den kränkelnden Generalsekretären Andropow und Tschernjenko sowie den Aufbruch zu einer gewagten Reformpolitik unter Michail Gorbatschow erleben. Gerade Gorbatschow versuchte nach seinem Amtsantritt (März 1985) mit der Forderung nach mehr Offenheit (Glasnost) und einem Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft (Perestrojka), die Sowjetunion zu einem konkurrenzfähigen Modell gegenüber der westlichen Welt zu entwickeln. Ausgerechnet in der Aufbruchphase dieser Reformpolitik - zum Ende seines ersten Amtsjahres - hat sich die Katastrophe von Tschernobyl (April 1986) ereignet. Trotz der neuen Offenheit erfuhren wir Korrespondenten in Moskau - wie auch die gesamte Weltöffentlichkeit - fast zwei Tage nichts von den Ereignissen im vierten Reaktorblock von Tschernobyl in der Nacht vom 25. auf den 26. April 1986. Im Westen war bereits erhöhte Radioaktivität gemessen worden, die eindeutig aus der Sowjetunion herrührte. Rundfunksender riefen an und wollten Genaueres wissen. Ich erinnere mich noch, wie ich in meiner ersten Reaktion behauptete, wenn es sich wirklich um eine radioaktive Explosion innerhalb der Sowjetunion handele, dann wäre Gorbatschow der erste, der mit seiner Politik von Glasnost damit an die Öffentlichkeit ginge. Doch nichts passierte und wir Korrespondenten hatten demnach auch nichts zu berichten.
Erst zwei Tage später, am 28. April um 21:02 Uhr Moskauer Zeit veröffentlichte TASS im russischen und englischen Dienst eine lapidare Meldung, die aus vier kurzen Sätzen bestand. Dabei wurde ein Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl zugegeben, bei dem auch ein Reaktor beschädigt worden sei. Man habe Maßnahmen unternommen, um die Folgen des Unglücks zu beseitigen. Den Betroffenen sei Hilfe geleistet worden. Eine Regierungskommission sei eingesetzt worden.
Mit dieser TASS-Meldung beginnt der dokumentarische Teil dieses Buches. Er besteht im Wesentlichen aus Radioberichten, Reportagen und Kommentaren, die ich als Moskauer Korrespondent in der Zeit vom 28. April 1986 bis zum 26. April 1989, also dem dritten Gedenktag der Katastrophe, für die Hörfunksender der ARD, verfasst habe. Die Übermittlung dieser Beiträge lag in der Verantwortung des Westdeutschen Rundfunks, der innerhalb der ARD für das Moskauer Studio zuständig war. Ferner habe ich hier einige Beiträge für die Hamburger Wochenzeitung DIE ZEIT5 aufgenommen, die damals noch keinen eigenen Korrespondenten in Moskau hatte.
In diesen Zeitraum fällt auch - zwei Jahre nach dem Unglück - meine einzige Reise, die ich zum zerborstenen Reaktorblock und an den verstrahlten Ort Prypjat unternommen habe.
Diese Berichte zeugen anfänglich von der Hilflosigkeit, der wir Journalisten - russische wie ausländische - ausgesetzt waren, weil in der Tat auch viele Verantwortliche am Ort des Geschehens in Tschernobyl Informationen, die für Moskau bestimmt waren, gefälscht oder gar unterschlagen haben. Um so dramatischer setzte sich dann Glasnost durch und es entstand ein neuartiger, investigativer sowjetischer Journalismus, der das Drama von Tschernobyl in all seinen Facetten nachzeichnete. Auch diese Entwicklung lässt sich anhand der zeitgenössischen Berichte nachvollziehen.
Vorgeschaltet ist diesem dokumentarischen Teil des Buches ein kurzgefasster chronologischer Überblick über die Ereignisse, wie man ihn rückblickend und in Kenntnis vieler Quellen schreiben kann, die heute zur Verfügung stehen. Dem folgt ein weiteres kurzes Kapitel über die Belastungen, die den verseuchten Gebieten und ihren Bewohnern auch für die kommenden Jahrzehnte noch bevorstehen. Mit dem Schauer der Ungeheuerlichkeit wird der Leser dabei zur Kenntnis nehmen, dass heute von Kiev aus so genannte „Augen öffnende” Erlebnistouren in die „post-apokalyptische Welt” von Tschernobyl und Prypjat angeboten werden.
Den Abschluss des Buches bildet der Abdruck eines fast 45-minütigen Fernsehgespräches, das der Bildungskanal ARD-alpha mit mir aufgezeichnet und zum 30. Jahrestag der Katastrophe ausgestrahlt hat. Im Rückblick kann man dabei sowohl die unsichere Einschätzung der ersten Tage in jenem April 1986 wie auch den monströsen Umfang dieses Unglücks und seiner Folgen, wie er sich heute darstellt, nachvollziehen.
Insgesamt soll dieses Buch damit einen kleinen Beitrag zum realistischen Umgang mit dem Krisenjournalismus leisten wie er zu einer Zeit stattfand, als es weder Internet, noch Handy oder gar E-Mails oder Satellitenfernsehen gab. Die eigene Recherche beschränkte sich wochenlang auf das Bemühen um telefonische Kontakte zur Bevölkerung in den betroffenen Gebieten. Dabei gab es keine freie Telefondurchwahl und die Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung wurden - ebenso wie wir Korrespondenten - von „den Diensten” abgehört. Auch so genannte „informierte Kreise” auf sowjetischer Seite erwiesen sich oft als Plaudertaschen, um den Schrecken der Katastrophe kleinzureden.
Von besonderer Spannung war die Lage für unsere Angehörigen und Familien in Moskau. Über westliche Rundfunksender auf Kurzwelle oder aus westlichen Zeitungen, die mit tagelanger Verspätung in Moskau ankamen, erfuhren sie zuweilen dramatische Übertreibungen - vereinzelt sogar von Tausenden von angeblichen Toten, die aufgrund von Messdaten im Westen in der Sowjetunion „vermutet“ wurden. In diesem Zusammenhang sind auch die Briefe des deutschen Botschafters in Moskau an seine dort lebenden Landsleute interessante Zeugnisse der Zeitgeschichte, die nun dreissig Jahre später hier ebenfalls dokumentiert werden.
1https://portal.dnb.de/opac.htm? method=simpleSearch& query= Tschernobyl
2https://hollis.harvard.edu/primo-explore/search?query=contains,con-tains,Chernobyl&vid=HVD2&search_scope=everything&sortby=rank&tab=everything&lang=en_US&mode=simple&fromRedirectFilter=true (Aufruf 10.01.2018).
3 Unter dem Schlagwort „Chernobyl” finden sich unter anderem 6.537 Bücher, 5.390 Dissertationen, 54.645 Zeitschriftenartikel, 30.697 Zeitungsartikel, 2.605 Rezensionen, 1.203 Konferenzdokumente, 434 Webseiten, 194 Technische Berichte sowie über 139 audiviosuelle Medien einschließlich Videos und Filme. Ebd. (Aufruf 20.01.2018).
4 So ist bis heute unklar, was sich unter der Ruine des vierten Reaktorblocks, der als Sarkophag versiegelt ist, wirklich an verseuchtem Material befindet, welche Wirkung langfristig davon ausgeht und wie nachfolgende Generationen dieses gefährliche, radioaktive Erbe werden handhaben können.
5 Diese Beiträge sind als Anmerkungen mit Quellenbeleg als Fußnote ausgewiesen.
Zur Chronologie der Katastrophe
Minuten-, ja sogar sekundengenau ist die Katastrophe von Tschernobyl inzwischen von Befürwortern6, Gegnern7 und neutralen Beobachtern8 der Kernenergie aufgearbeitet worden.
Daher wissen wir, dass am 26. April 1986 nachts um ein Uhr, dreiundzwanzig Minuten und vier Sekunden ein Leistungstest im vierten Reaktorblock vorgenommen wurde, über den die anwesenden Fachleute die Kontrolle verloren haben. Nachdem auch die Notabschaltung versagt hatte, brach ein Brand im radioaktiven Kern des Reaktors aus. Genau um 01:23:48 Uhr explodierte der Reaktor, also nicht einmal eine Minute nach dem Beginn des Testlaufs. Allein daraus wird klar, wie überfordert die Verantwortlichen im Reaktor waren, die nicht nur zahlreiche Fehlentscheidungen getroffen hatten, sondern auch die Informationen über die beginnende Katastrophe nicht rechtzeitig und vollständig weitergegeben haben.
Auf diese hereinbrechende Katastrophe9, bis dahin die größte, die sich in einem Kernkraftwerk ereignet hatte, war die Sowjetunion in keiner Weise vorbereitet. Nachdem in Schweden, Dänemark und Finnland stark erhöhte radioaktive Messungen registriert worden waren, ließ die sowjetische Führung eine nur vierzeilige Meldung durch die amtliche Nachrichtenagentur TASS verbreiten, in der das Unglück lapidar bestätigt wurde.
Der damalige sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow, Begründer der Politik von Glasnost und Perestrojka, ließ fast drei Wochen verstreichen, bevor er selbst im Fernsehen zu dem Unglück Stellung nahm. Doch die Sowjetunion - und nach dem Zerfall der UdSSR später dann die Ukraine sowie Weißrussland - sollten noch Jahrzehnte an der Bewältigung dieser Katastrophe zu arbeiten haben.
Was früher nie in Frage stand, war nach Tschernobyl in der damaligen Sowjetunion eingetreten: In der Öffentlichkeit begann eine kritische Auseinandersetzung mit der Kernenergie, deren forcierter Ausbau von der sowjetischen Wirtschaftsplanung weiterbetrieben wurde.
Darüber hinaus aber mussten Fachleute bestehende und erkennbare Risiken beseitigen, die sich in der bisherigen Praxis der sowjetischen Kernkraftwerke gezeigt hatten. Dies galt vor allem für den Reaktortyp von Tschernobyl, der seit dem Unglück nicht wieder gebaut wurde. Konkrete Folge davon war der Beschluss, dass auch die beiden geplanten Reaktorblöcke in Tschernobyl nicht mehr fertiggestellt wurden und der Betrieb des Kernkraftwerks schließlich ganz aufgegeben werden musste.
In Smolensk und in Kursk sollten ersten Meldungen zufolge zwei weitere Kernkraftblöcke abgeschaltet worden sein, die nach derselben Technik arbeiteten wie das Kernkraftwerk in Tschernobyl. Alle 14 Einheiten desselben Typs, die aus den 1970er Jahren stammten, mussten modernisiert und mit weiteren Sicherheitsvorkehrungen ausgerüstet werden. Weitere Reaktorblöcke in den Kernkraftwerken Bjelojarsk und Nowoworonesch wurden angeblich für die Stilllegung vorbereitet. Das einzige in Armenien betriebene Kernkraftwerk in unmittelbarer Nähe der Hauptstadt Eriwan ist nach dem schweren Erdbeben 1988 ganz abgeschaltet worden.
Eine für die Sowjetunion bis dahin undenkbare Informationspolitik hatte eingesetzt: Kernkraftwerke wurden für regelmäßige Besuche geöffnet, Firmenvertreter, Schulungseinrichtungen, öffentliche Organisationen - sie alle sollten nun vor Ort Anschauungsunterricht in Sachen Kernenergie erhalten. In Moskau ist ein Informationszentrum für Kernenergie gegründet worden, und in einem Fachinstitut wurden regelmäßig öffentliche Diskussionen über Kernenergie durchgeführt.
Dennoch reichten diese Maßnahmen nicht aus, um den Schrecken von Tschernobyl zu begegnen und gleichzeitig die Bevölkerung für den weiteren Ausbau der Kernenergie zu gewinnen. Zum dritten Jahrestag der Katastrophe widmete die Parteizeitung Prawda eine ganze Seite den Problemen der immer noch wirksamen radioaktiven Verstrahlung. Zur Illustration druckte das Blatt drei Karten aus dem näheren Einzugsbereich von Tschernobyl ab, in der Detailmessungen über die Verseuchung eingetragen waren. In einem Fazit äußerte der sowjetische Fachminister Juri Israel, „dass die radioaktive Verseuchung der Umwelt auf einem beträchtlichen Territorium noch ein ernstes technisches und soziales Problem darstellen wird”.10
Erstmals wagte sich nach drei Jahren auch Michail Gorbatschow nach Tschernobyl, wo er sich in weißer Schutzmontur im ersten Reaktorblock des Kernkraftwerkes vom Schichtleiter den Arbeitsablauf erklären ließ. Der Parteichef unterbrach stets, wenn es um Fragen der Sicherheit ging. Ob die neue Automatik auch wirklich funktioniere? Ob jetzt Fehler ausgeschlossen seien?
Anschließend wandte sich Gorbatschow im Gespräch an die Arbeiter des Kernkraftwerkes. Ihre Sorgen: Mängel in der medizinischen Betreuung. „Und die sowjetische Presse”, so klagten sie, „polemisiert unsachlich gegen die Kernenergie”. In der Rolle des Anwalts der Öffentlichkeit erwiderte Gorbatschow: „In gewisser Weise müssen Sie die Presse verstehen. Die öffentlichen Sorgen und das Misstrauen sind gerechtfertigt.”11
In der neuerbauten Stadt Slawutitsch, in der die Mitarbeiter von Tschernobyl nach der Katastrophe untergebracht wurden, exerzierte der Parteichef vor der Kamera mit den Methoden eines Oberlehrers eine Lehrstunde in Sachen Kernenergie. Er rief Fachleute auf, in wenigen Sätzen vorzubringen, wo sie der Schuh drückt und was man von der Kernenergie zu halten habe.
Der Betriebsdirektor von Tschernobyl bat um eine qualifiziertere Aufmerksamkeit der Massenmedien und lobte den Atomstrom als „das sauberste, was wir ökologisch haben”.12 Der Chefwissenschaftler der sowjetischen Akademie der Wissenschaften, Jewgenij Welichow, sah ohne Atomstrom keine Chance, den sowjetischen Energiebedarf zu decken und forderte, dass sich die Gesellschaft darauf einstellen müsse.
Der Politiker Schtscherbina, Leiter der damaligen Katastrophenkommission, meinte schlicht: Die Jugend muss besser lernen, Vorschriften zu beachten, damit ein Unglück wie Tschernobyl sich nicht wiederhole. Umweltchef Israel bestätigte, man könne bereits wieder in Teilen der Sperrzonen wohnen, dürfe dort nur bestimmte Pilzsorten nicht essen.13
Über die wirklichen katastrophalen Spätfolgen, die sich gleichzeitig anzudeuten begannen, hatte die Wochenzeitung Moskowskie Nowosti berichtet, und zwar wenig später nach diesem Besuch von Gorbatschow in Tschernobyl. Ein Reporter hatte im Einzugsgebiet der radioaktiven Verseuchung eine Kolchose besucht. Bei der dortigen Viehzucht wurde eine erschreckende Zunahme an Missbildungen festgestellt. Die Bilanz bei knapp 440 Stück Vieh lautet wörtlich: „In den fünf Jahren vor Tschernobyl wurden hier insgesamt drei Missgeburten unter den Ferkeln registriert. Bei den Kälbern gab es überhaupt keine. Aber schon innerhalb des ersten Jahres nach dem Unglück wurden 64 missgebildete Tiere geboren. 37 Ferkel und 27 Kälber kamen entweder ohne Kopf und ohne Extremitäten, ohne Augen oder ohne Rippen auf die Welt.”14
Die Zahl der Missgeburten steigerte sich auf mehr als das Doppelte. So wurden nach den Angaben der Zeitung im Jahr 1988 bereits 76 Missgeburten registriert. Und diese Zahlen stammen von einer einzigen Kolchose im weiteren Umkreis des Katastrophengebietes.
Solche Veröffentlichungen verunsicherten vor allem Frauen, die schwanger waren oder schwanger werden wollten. Im zuständigen Gesundheitsministerium von Kiew hatte man sich längst die Sprachregelung zu eigen gemacht, dass außerhalb der unmittelbaren Strahlenzone von Tschernobyl keine Gefahr mehr bestehe. „Wenn keine Gefahr mehr besteht, wie man uns immer wieder sagt”, so zitierte die erwähnte Wochenzeitung eine Betroffene, „weshalb wird uns dann von einer Schwangerschaft abgeraten?”15
Schließlich berief sich das Blatt auf einen Vertreter der örtlichen Verwaltung im Gebiet Shitomir, das weit außerhalb der sogenannten Gefahrenzone liegt. Nach seinen Angaben stellen die Mediziner eine erhebliche Zunahme an chronischen Erkrankungen fest. Nach chirurgischen Eingriffen, so heißt es, werden die Genesungszeiten immer länger. Und wörtlich: „Auch die Zahl der Krebserkrankungen hat sich im Jahresdurchschnitt verdoppelt. Vor allem stellen wir das bei Lippen- und Mundkrebs fest.”16
Zum vierten Jahrestag der Katastrophe 1990 berichtete das sowjetische Fernsehen 24 Stunden lang von den schrecklichen Folgen für die Menschen im Einzugsbereich von Tschernobyl. Verzweifelte Mütter hielten ihre geschädigten und behinderten Kinder in die Kamera und klagten den Staat an, der die Menschen in ihrer Not allein gelassen habe.
6 Dazu gehört vor allem die International Atomic Energy Agency in Wien, IAEA, die über Jahrzehnte eine eigene Webseite zu Tschernobyl pflegt:
https://www.iaea.org/newscenter/focus/chernobyl (Aufruf 19.01.2018).
Mit vielen weiteren Verlinkungen bietet die IAEA auch Einblick in den Forschungsstand zu Tschernobyl:
https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:19054937 (Aufruf 19.01.2018).
7 Vor allem Greenpeace:
https://web.archive.org/web/20130812022903/http://www.green-peace.de/tip/themen/atomkraft/atomunfaelle/artikel/der_unfall/sowie die Initiative „ausgestrahlt. gemeinsam gegen atomenergie”
https://www.ausgestrahlt.de/informieren/atomunfall/tschernobyl/ (Aufruf 19.01.2018).
8 In der Regel sind dies publizistische Aufarbeitungen der Katastrophe
https://www.planet-schule.de/wissenspool/tschernobyl/inhalt/hinter-grund/tschernobyl-chronik-einer-katastrophe.html (Aufruf 19.01.2018).
http://www.zeit.de/2011/12/Tschernobyl (Aufruf 19.01.2018).
Den aktuellen Diskussionsstand spiegelt der sehr umfangreiche Eintrag in der Wikipedia wider, der auch die immer noch unklaren Fragen beim Ablauf der ersten Zerstörung von Brennstäben oder Druckröhren sowie die Erklärungs-Alternativen für die zweite Explosion (Knallgas oder Dampf) problematisiert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearkatastrophe_von_Tschernobyl (Aufruf 19.01.2018).
9 Die nachfolgende Darstellung stützt sich inhaltlich auf: J. Grotzky, Herausforderung Sowjetunion, München 1991, S. 94-97 und S. 262-265.
10 Prawda, 26.04.1989
11 Sowjetisches Fernsehen, 1. Kanal, 21.02.1989. Vgl. S. 53 f.
12 ebd.
13 ebd.
14 Moskowskie Nowosti, Nr. 9, 1989.
15 ebd.
16 ebd.
Belastungen für die Zukunft
Die Ukraine, in der alten Sowjetunion ein Vorbild an wirtschaftlicher und technologischer Leistungskraft, erlebte im April 1986 mit der Katastrophe im Kernkraftwerk von Tschernobyl ihre bitterste Lektion der Nachkriegszeit, die bis heute nachwirkt17. Die Folgen der Katastrophe belasten weiterhin den seit 1991 unabhängigen Staat Ukraine, aber auch den ebenfalls seit 1991 unabhängigen Staat Weißrussland. Auf Jahre hinaus haben Ängste und Gerüchte das gesellschaftliche Klima in der Ukraine beeinträchtigt. Tschernobyl wurde zu einer schweren Belastungsprobe für die damals gerade angebrochene Phase der Reformpolitik von Michail Gorbatschow mit Glasnost, der neuen Offenheit: einerseits mangelte es den sowjetischen Stellen lange Zeit an genauen Erkenntnissen des Unglücksverlaufs und über seine Folgen, andererseits stellte sich erst nach vier Jahren heraus, dass viele verfügbare Informationen tatsächlich zurückgehalten worden waren. Schon zuvor - auf einer medizinischen Fachkonferenz 1988 in Kiew - bemängelten vor allem schwedische und amerikanische Wissenschaftler, dass immer noch keine Daten über die tatsächliche Strahlenbelastung vorlagen und man keine genaue Aufstellung über den Personenkreis hatte, der zur Risikogruppe für Spätfolgen zählte. Ein Jahr später gab der Vorsitzende des Staatskomitees für Hydrologie und Meteorologie, Juri Israel, bekannt, dass etwa 230.000 Menschen im verseuchten Einzugsgebiet von Tschernobyl lebten. 1990 räumte der Vizepräsident der Umweltkommission des sowjetischen Parlaments endlich ein, dass im Einzugsbereich mit einer überhöhten radioaktiven Belastung in Wirklichkeit sogar vier Millionen Menschen lebten, von denen 1,5 Millionen einer „hohen Strahlendosis” ausgesetzt worden seien, darunter 160.000 Kinder. Spätfolgen machten sich bemerkbar: Schilddrüsenkrebs, Leukämie, Blutkrankheiten, steigende Zahlen von Totgeburten und hohe Säuglingssterblichkeit. Vier Jahre nach der Katastrophe mahnten Fachleute die Evakuierung von mindestens 118 Siedlungspunkten an, hauptsächlich im angrenzenden weißrussischen Gebiet, weil dort die Strahlenbelastung unerträglich hoch sei.
Über die Folgekosten von Tschernobyl kamen ebenfalls erst im Laufe der Jahre genaue Schätzungen zustande. Sie bedeuteten eine zusätzliche Bürde für die angespannte Lage der damaligen Sowjetunion und deren betroffene Nachfolgestaaten. Bis zur Jahrtausendwende wurden umgerechnet etwa 300 Milliarden US-Dollar veranschlagt, wollte man die Schäden der Katastrophe völlig beseitigen. Aus Tschernobyl, das zum größten Kernkraftwerk der Welt hätte ausgebaut werden sollen, wurde eine der teuersten Ruinen der Atomwirtschaft.
Noch Jahre nach der Katastrophe musste man sich bei einer Fahrt von Kiew nach Tschernobyl - etwa 100 Kilometer in nördlicher Richtung nahe der Republikgrenze zu Weißrussland gelegen - auf ein Schockerlebnis gefasst machen. Schon einige Kilometer vor Tschernobyl wandelte sich die reich bewaldete Landschaft in eine Wüste. Bäume und Sträucher waren abgestorben. Die Erde um den Komplex des Kernkraftwerkes war mehr als zwanzig Zentimeter tief abgetragen und der Boden mit frischem Sand wieder aufgefüllt worden.
Erst Jahre später fand man Zeit zu einer kritischen Bestandsaufnahme. Der Chef der Abteilung Information im Kernkraftwerk Alexander Kowalenko versuchte, den Fragen der wenigen zugelassenen Korrespondenten, die das Kraftwerk 1988 besuchen durften, gleichsam die Spitze zu nehmen, indem er selbst die schlimmsten Mängel aufzählte: Während der Bergungsarbeiten unmittelbar nach der Katastrophe hatte es Kompetenzstreitereien gegeben, weil vierzig (!) verschiedene Ministerien daran beteiligt waren und jeweils ihr Mitspracherecht geltend gemacht haben. Schließlich wurde ein eigenes Kombinat zur Beseitigung der Schäden eingerichtet, professionell organisiert und ohne Kompetenzrangeleien.
„Für einen Besuch am Sarkophag haben Sie fünf Minuten”, mahnte damals der Kraftwerkssprecher und drückte mir ein Messgerät in die Hand. Damit durfte ich mich bis auf etwa 200 Meter an die zerborstene Ruine des vierten Reaktorblocks heranwagen, der - von einer Haut aus Blei umschlossen - tatsächlich einem Sarkophag ähnelte. Das Messgerät schlug je nach Windrichtung unterschiedlich stark aus.
Nach der Katastrophe wohnten die Arbeiter von Tschernobyl in einer eigenen, etwa 50 Kilometer entfernten Siedlung Seljony Mys. Solange unklar war, was mit Tschernobyl passieren sollte, ehe man sich für die gänzliche Stilllegung entschied, wurden 10.000 Arbeiter und 3.000 Bauleute wieder im Atomkraftwerk eingesetzt. Soldaten übernahmen die Dekontamination, trugen die Erde ab und spülten in der nahegelegenen Stadt Prypjat, aus der die gesamte Einwohnerschaft evakuiert worden war, den radioaktiven Niederschlag von Dächern und Straßen. In der Gefahrenzone wurde in einem Rhythmus von 15 Tagen gearbeitet, danach gab es wiederum 15 Tage frei, als Risikozulage wurde der Verdienst verdoppelt. Bei Erreichen der zulässigen Höchstdosis an radioaktiver Strahlung mussten die Arbeiter ihre Beschäftigung aufgeben.
Mit zunehmender Offenheit wurde Tschernobyl für die sowjetische Presse Gegenstand höchst kritischer Betrachtung. Von Saufgelagen unter den Arbeitern war die Rede, von neuerlicher Schlamperei, vom Einsatz krimineller Elemente. Doch bereits einen Monat nach der Katastrophe, im Mai 1986, waren 14.0000 Anträge eingegangen, angeblich von Freiwilligen, die in Tschernobyl mithelfen wollten. „Wir haben nicht nach der Parteizugehörigkeit ausgewählt“ - meint der Pressechef des Kraftwerks unter Anspielung auf spätere Vorwürfe – „sondern nach dem Merkmal der Anteilnahme und des Schmerzes. Dann aber kamen massenhaft Beamte und begannen hinzusehen, wer verurteilt worden war, wer aus der Partei geflogen war und so weiter.”18