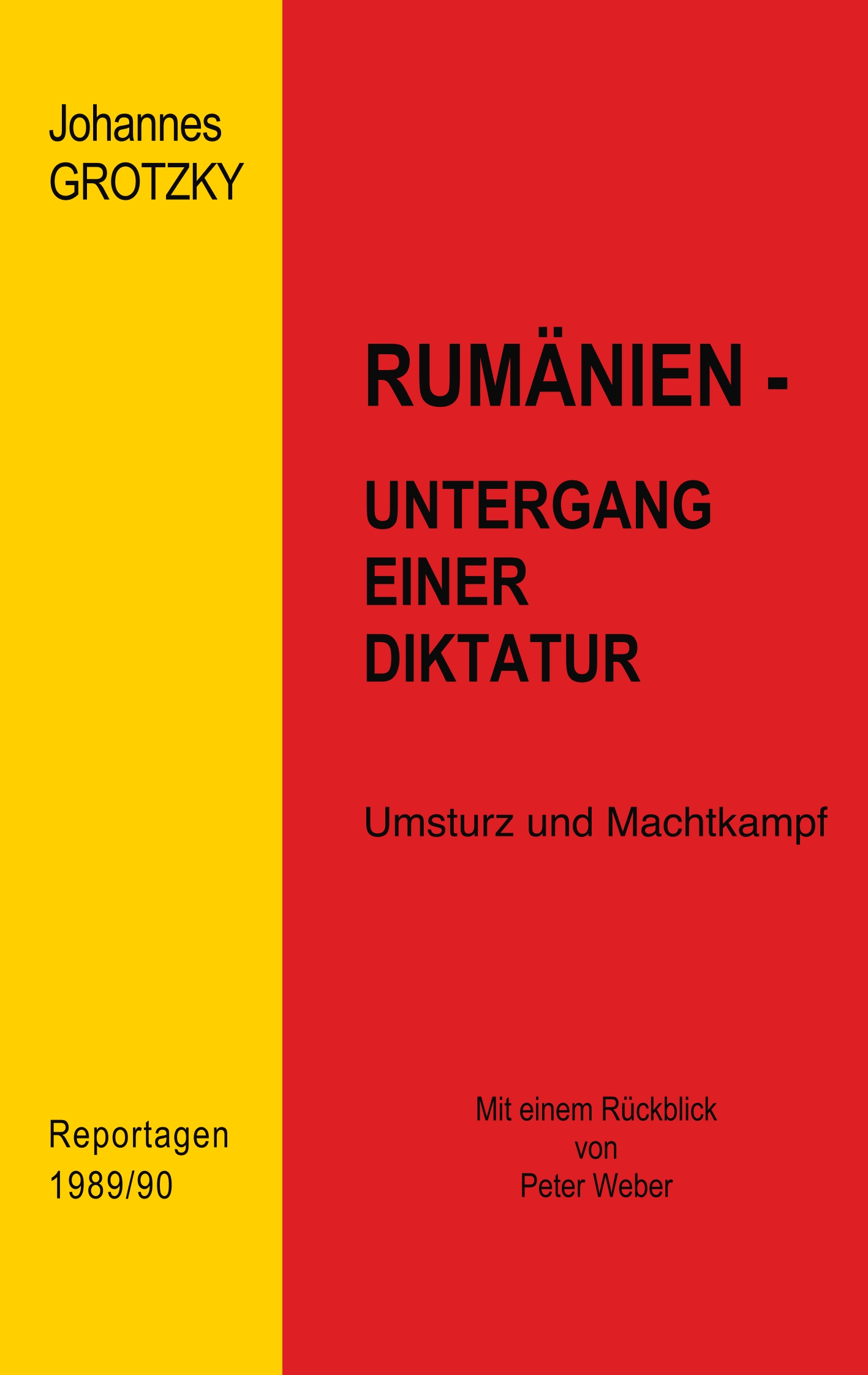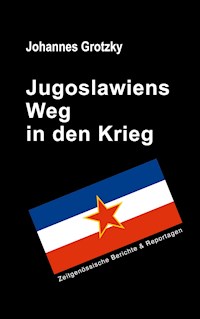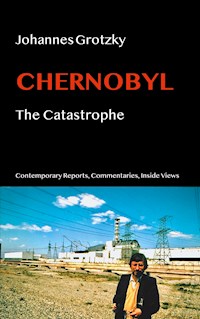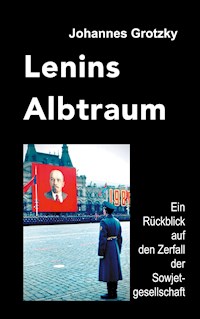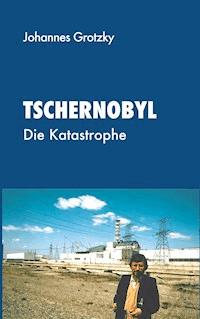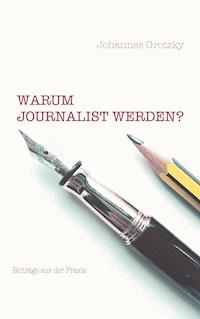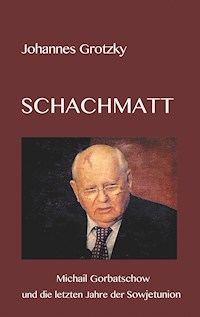
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Michail Gorbatschow hat unter den Begriffen von Glasnost und Perestrojka versucht, die Sowjetunion zu reformieren. Meinungsvielfalt in den Medien, die Aufarbeitung der Geschichte der kommunistischen Willkürherrschaft, die Rehabilitierung verfemter Schriftsteller, die Freilassung politischer Gefangener und eine radikale Abrüstungspolitik machten weltweit Schlagzeilen. Der Begriff Glasnost ging dafür in zahlreiche andere Sprachen ein. Doch der wirtschaftliche Umbau, die Perestrojka, scheiterte am Widerstand aus der kommunistischen Partei. Viele Funktionäre wollten sich nicht einem gleichberechtigten Wettbewerb mit anderen politischen Kräften stellen. Staatsbetriebe scheuten die Herausforderung durch eine freie Marktwirtschaft. Nationale Unruhen in einzelnen Sowjetrepubliken führten zu blutigen Konflikten. Ein Putsch gegen Gorbatschow brach zwar schnell in sich zusammen. Aber damit war auch seine Politik gescheitert, eine reformierte Sowjetunion in eine neue, pluralistische Demokratie zu überführen. Das Riesenreich zerbrach und löste sich in fünfzehn Nachfolgestaaten auf, deren Beziehungen untereinander bis heute von zahlreichen Auseinandersetzungen begleitet sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Johannes GROTZKY, Dr. phil. (*1949), Studium der Slawistik, Balkanologie und Geschichte Ost- und Südosteuropas in München und Zagreb. 1983-1998 Korrespondent für Ost- und Südosteuropa in Moskau, Wien und München. 2002-2014 Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks. Honorarprofessor für Osteuropawissenschaften, Kultur und Medien an der Universität Bamberg.
Bücher: Gebrauchanweisung für die Sowjetunion (1984, 41990). Herausfoderung Sowjetunion. Eine Weltmacht sucht ihren Weg (1991). Konflikt im Vielvölkerstaat. Die Nationen der Sowjetunion im Aufbruch (1991). Lenins Enkel. Reportagen aus einer vergangenen Welt (2009). Tschernobyl. Die Katastrophe (2018)
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
VORWORT ZUR TASCHENBUCHAUSGABE
PERESTROJKA AUS ERSTER HAND
MENSCHEN UND MÄCHTIGE
NEUER MANN AUF ALTER LINIE?
DIKTATOR UND POET DAZU
POLITISCHE NEUERUNGEN BEIM WECHSEL
HERZENSDIENST FÜR DIE MÄCHTIGEN
NEUE LEHREN FÜR DIE GENOSSEN
PERESTROJKA DURCH KADERPOLITIK
WACHTWECHSEL IM MILITÄR
DAS POLITISCHE SYSTEM HAT VERSAGT
POSITIONSKÄMPFE
„DEMOKRATIE WIE DIE LUFT ZUM ATMEN!“
DIE GRENZEN DER BELASTBARKEIT
ANHÄNGER UND GEGNER
DEMOKRATISIERUNG
ERSTMALS FREIE WAHLEN
DIE SUCHE NACH DEM DIALOG
DIE GUTEN UND DIE BÖSEN
HERAUSFORDERUNGEN IM INNERN
UNHEILE UMWELT
EIN ROCKSTAR BETET UM ERRETTUNG
FEHDEHANDSCHUH FÜR DIE GENOSSEN
ERSTE WAHRHEITEN ÜBER DIE TRAGÖDIE
EIN LAND LÄHMENDER WIDERSPRÜCHE
„MIT WELCHEM RECHT KÄMPFEN WIR DORT?”
MEDIEN UND KULTUR
DIE HEIMLICHEN VERFÜHRER
DAS THEATER ALS POLITISCHE BÜHNE
VERBORGENE KRÄFTE DER IDENTITÄT
GLASNOST AUF DEM BILDSCHIRM
RÜCKKEHR DER GESCHICHTE
“DER FASCHIST FLOG VORÜBER”
STALINISMUS UND FASCHISMUS
KEIN VERSTECKSPIEL VOR DER GESCHICHTE
HÄFTLING IN DER STALINZEIT
STREIT UM DEN STALINISMUS
ZUR ZARENZEIT WAR ALLES BESSER
NATIONALE KONFLIKTE
PROTESTE AUF DEM ROTEN PLATZ
EIN VOLK ERHEBT SICH
GLASNOST IN KLEINEN DOSEN
„MIT DER GANZEN MACHT DES STAATES“
„GEFÄNGNIS DER VÖLKER“
UNRUHEN IN GEORGIEN
NATIONALE SPRENGKRAFT
SIGNALE NACH AUSSEN
DAS ENDE EINES TABUS
POLITIK DER NADELSTICHE
„DER REAGAN IST DOCH GEKAUFT“
DIE ASIATISCHE KARTE
AFGHANISTAN
TRUPPENABZUG IN ZWÖLF MONATEN
DAS ENDE DES SYSTEMS
ERNEUERER UND ZAUDERER
DER GROSSE GEWINNER JELZIN
EINE REVOLUTION DES ZERFALLS
NEUORIENTIERUNG
ZEITTAFEL
SCHRIFTEN VON M. GORBATSCHOW AUF DEUTSCH
NAMENSREGISTER
VORWORT
Wer in der Sowjetunion gelebt hat und heute nach Moskau kommt, der glaubt, seinen Augen nicht zu trauen. Nahezu alles, was in kommunistischer Zeit verboten war, gilt heute als selbstverständlich. Die wirtschaftlichen Freiheiten scheinen einem Dammbruch gleich alles niedergerissen zu haben, was früher in strenger Kontrolle kaum gedeihen konnte. Die Straßen sind mit Autos überfüllt, in den Geschäften werden Luxusgüter aus aller Welt vertrieben, beste und teuerste Hotels sind aus dem Boden gewachsen. Und dennoch finden sich immer wieder Spuren jener Herrschaft, die nicht alleine dem Kommunismus, sondern bereits dem Zarismus entstammen. Der Kreml in Moskau bleibt Inbegriff einer zentralen Machtausübung, die den Prozess der Meinungsbildung im Land ebenso wie die Konstituierung der politischen Kräfte lenkt und überwacht.
Nach dem Ende der Sowjetunion wurden die Versuche zur Demokratisierung Russlands unter Präsident Jelzin vom Westen nahezu hymnisch gefeiert. Doch der Verfassungswirklichkeit standen Dutzende von Präsidialerlassen entgegen, mit denen Jelzin die Verfassung umging, um das Land zu regieren. Der häufige Wechsel der Regierungschefs unter Jelzin, die vom Präsidenten nahezu willkürlich in das Amt gehoben und wieder entlassen wurden, mündete 1999 schließlich in der Ernennung von Wladimir Putin zum Ministerpräsidenten, der von Jelzin gleichzeitig als Nachfolger im Amt des Präsidenten im Jahr 2000 gefördert wurde. Unter Putin profitierte Russland wirtschaftlich zunächst von einem unglaublichen Anstieg der Erdöl- und Erdgaspreise. Doch auch unter Putin entwickelten sich kein funktionierendes Mehrparteiensystem, keine klare Gewaltenteilung und keine wirklich unabhängigen Massenmedien. Ähnlich wie Jelzin schlug auch Putin seinen eigenen Nachfolger im Präsidialamt vor, nachdem er laut Verfassung nach achtjähriger Amtszeit nicht mehr wieder kandieren durfte. Sein Favorit Dmitri Medwedew, seit 2005 Erster stellvertretender Ministerpräsident unter Präsident Putin, erhielt als neuer Mann im Kreml die Zustimmung der Bevölkerung. Trotz mancher Wahlfälschungen durfte man bei seiner Wahl 2008 davon ausgehen, dass die Menschen mehrheitlich das Verfahren der Machtübertragung vom Vorgänger auf den von ihm ausgewählten Nachfolger bislang gut geheißen haben. Putin kehrte in das Amt des Ministerpräsidenten zurück, blieb jedoch für viele Russen weiterhin die beherrschende politische Figur. Spekulationen, die von einem kommenden Machtkampf zwischen Putin und Medwedew ausgingen, haben sich nicht bewahrheitet. Bereits nach vier Jahren verzichtet Medwedew auf den Anspruch einer weiteren Amtszeit als Präsident Russlands zugunsten seines Vorgängers Putin, der trotz einer landesweiten Protestbewegung 2012 erneut in das Amt des Präsidenten gewählt wurde. Auch hier bemängelten Wahlbeobachter zahlreiche Manipulationen; doch selbst unter Abzug der vermuteten Wahlfälschungen dürfte dennoch die Mehrheit der Wähler für Putin gestimmt haben. Bereits unter Präsident Medwedew hatte 2008 die Duma, das Parlament, einer Verfassungsänderung zugestimmt, der zufolge künftige Präsidenten jeweils für sechs statt für vier Jahr gewählt werden mit der Möglichkeit einer einmaligen Wiederwahl. Damit hat Wladimir Putin das Mandat, bis 2024 zu regieren. Diese Wiederwahl erfolgte 2018. Somit wird er 25 Jahre lang, davon 20 Jahre Jahre als russischer Präsident, die Geschicke Russlands gelenkt haben.
Diesem neuen Machtverständnis der „gelenkten“ russischer Demokratie ging die von Michail Gorbatschow verantwortete Politik von Glasnost und Perestrojka voraus. Damit sollte ursprünglich der Kommunismus zu einer lebensfähigen Gesellschaftsordnung entwickelt werden. Doch die Bestandsaufnahme der Mangelerscheinungen führte zu einer immer sprunghafteren Reformpolitik, die letztlich die Unreformierbarkeit der sozialistischen Gesellschaftsordnung unter Beweis stellte. Ein Boykott der Parteibürokratie führte schließlich zu einem Putsch gegen Gorbatschow und leitet damit das Ende der Sowjetunion ein. Heute ist Gorbatschow im Westen geachtet, in seiner Heimat hingegen von vielen vergessen, wenn nicht gar verachtet. Denn trotz aller politischen Aufbruchsstimmung hatten sich die Hoffnungen auf einen höheren Lebensstandard unter Gorbatschow nicht erfüllt. Gleichwohl war das Tor geöffnet für einen fundamentalen Wandel in der Geschichte Russlands.
Der vorliegende Sammelband ist keine Gesamtdarstellung aller Vorkommnisse aus diesen letzten, aufregenden Lebensjahren der Sowjetunion. Es handelt sich mehrheitlich um Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträge sowie Radio-Dokumentationen, die während dieser Jahre von mir publiziert wurden. Die meisten von ihnen befassen sich mit den innerparteilichen und innenpolitischen Veränderungen. Die vielen außenpolitischen Aktivitäten Gorbatschows, seine zahlreichern Auslandsreisen, seine Gipfeltreffen mit den beiden US-amerikanischen Präsidenten Reagan und Bush, seine Abrüstungsinitiativen sowie seine Deutschlandpolitik, die – entgegen seiner ursprünglichen Absichten – in der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten mündete, scheinen in diesem Band nur im innenpolitischen Zusammenhang der Sowjetunion auf. Zumindest an dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass der damalige Außenminister Eduard Schewardnadse und einer der Chefdenker der Perestrojka, Alexander Jakowlew, entscheidend Anteil hatten an der Neuorientierung der sowjetischen Position hinsichtlich einer deutschen Vereinigung.
Im Rückblick wundert man sich, mit welcher Aufmerksamkeit die Welt zu Beginn der Perestrojka scheinbar unbedeutende Vorgänge wahrgenommen hat, die heute bereits vergessen sind. So hat die internationale Presse mit großer Aufmerksamkeit über die Eröffnung des ersten Privatrestaurants in der Kropotkinskaja Uliza in Moskau berichtet, während in anderes sozialistischen Ländern wie Ungarn oder Polen die Kleinprivatisierung in diesem Bereich bereits zum Alltag zählte und dort selbstverständlich keine Schlagzeilen hervorrief. Vieles ist zur Normalität geworden, was damals einem ideologischen Erdbeben gleichkam: so die Rückbesinnung auf die eigene Geschichte, die Veröffentlichung verbotener Filme und Bücher wie auch der unbeholfene Versuch, die kommunistische Partei zu demokratisieren. Anderes wiederum wie die Nationalitätenkonflikte und deren Auswirkung auf die Stabilität des Staates bleiben von wiederkehrender Aktualität. Das letzte Drittel der Perestrojka war von weitreichenden Widersprüchen geprägt. Zunächst beherrschte der Konflikt zwischen Jelzin und Gorbatschow die öffentliche Meinung wie auch den Kampf um die Machtverteilung.
Eine weitere Front erwuchs für Gorbatschow aus dem nachhaltigen Widerstand zahlreicher „konservativer“ Parteigenossen. Schließlich sah sich Gorbatschow von Unabhängigkeitsbewegungen in nahezu allen Teilrepubliken konfrontiert, die er gerade erst mit einem neuen Unionsvertrag für eine gemeinsame Zukunft gewinnen wollte.
Es ist erstaunlich, dass Gorbatschow dennoch in dieser Phase entscheidende Reformen vorantrieb, die staatsrechtlich für sein Land eine ungeheure Veränderung bedeuteten, vom Westen jedoch eher als Selbstverständlichkeit wahrgenommen oder gar „eingefordert“ wurden. Dazu zählten – innerhalb nur weniger Woche von Sommer bis Herbst 1990 – die Einführung der gesetzlich verankerten Pressefreiheit und der allgemeinen Religionsfreiheit, die Rehabilitierung von Millionen Stalin-Opfer, die Annullierung der Ausbürgerung von Intellektuellen, die Einführung der Marktwirtschaft und des Parteienpluralismus.
Die gesamten Reformleistungen, die letztlich auf eine Überwindung des Ost-West-Konfliktes hinausliefen, wurden 1990 durch die Verleihung des Friedensnobelpreises an Michail Gorbatschow gewürdigt. Doch genau auf diesem Höhepunkt warnte Außenminister Schewardnadse vor einem drohenden Putsch; er trat von seinem Amt zurück und verließ ein halbes Jahr später die Kommunistische Partei. Diesem Schritt folgte kurz darauf auch Alexander Jakowlew, einer der wichtigsten Perestrojka-Strategen. Anlass dafür war vermutlich der Positionswandel von Gorbatschow, der sich in der Bekämpfung der Unabhängigkeitsbewegungen in den baltischen Staaten wie im Kaukasus auf die Seite des Militärs gestellt hatte mit dem Versuch, diese Bewegungen blutig, aber erfolglos zu unterdrücken.
In diesem Auflösungsprozess, der auch von Streikbewegungen der Arbeiter begleitet wurde, setzte Gorbatschow immer rigoroser seine Präsidialdekrete ein, um seine Ordnungsvorstellungen durchzusetzen. Den konservativen Parteikräften war auch dies noch zu wenig. Mit einem eher operettenhaften Putsch versuchten sie, Gorbatschow von der Macht zu verdrängen und das Rad zurückzudrehen. Im Rückblick muss man noch einmal daran erinnern, dass auch Boris Jelzin damals von den Putschisten verhaftet werden sollte. Der kämpferische Jelzin zog die Armee auf seine Seite, widersetzte sich erfolgreich den Putschisten und konnte Gorbatschow aus dessen Hausarrest befreien. Doch auf der Straße skandierten damals die Menschen nicht mehr den Namen Gorbatschows, sondern den seines Gegenspielers Jelzin, der dann die eigentliche Entmachtung von Gorbatschow und das staatsrechtliche Ende der Sowjetunion betrieb.
Die Beiträge in diesem Band sind aus verschiedenen Anlässen geschrieben worden. Sie spiegeln den jeweiligen Entwicklungsstand der Ereignisse wieder. Sie sind das Ergebnis journalistischer Tagesarbeit. Man kann also von einem zeitgeschichtlichen Lesebuch sprechen, das auf keinen Fall die quellenkritische Aufarbeitung der Historiker ersetzt, die inzwischen auf eine reiche Memoirenliteratur der Zeitzeugen von Glasnost und Perestrojka wie auch auf manches Archivmaterial aus dem Politbüro der KPdSU zurückgreifen können. Gerade die aktuelle Berichterstattung setzt inhaltlichen Wiederholungen voraus, wie sie sich in den hier veröffentlichten Beiträgen zuweilen widerspiegeln; denn der Journalist ist angehalten, bei immer neu entstehenden Zusammenhängen wie auch bei fortschreibender, ereignisbegleitender Berichterstattung auf die jüngste Vergangenheit in seinem Berichtsgebiet zurückzugreifen. Nur so kann er in der Kürze der Zeit für den Hörer und Leser eine Einordnung dessen ermöglichen, worüber gerade aktuell berichtet wird.
Dies gilt vor allem für die Darstellungen im Bereich der kulturellen Veränderungen und der nationalen Frage, die in immer neuen Zusammenhängen, aber meist mit ähnlichem Ausgangspunkt für die Rückbesinnung auf eine postsowjetische Identität vor allem Russland von entscheidender Bedeutung waren. Für den Leser dieses Sammelbandes erscheinen solche Wiederholungen im Einzelfall unentbehrlich, um den Charakter der in sich geschlossenen Beiträge nicht zu verfälschen. Schließlich kann man den vorliegenden Band ebenso linear wie selektiv nutzen. Zur besseren Orientierung ist bei jedem Beitrag ein kommentierter Quellennachweis als Fußnote beigefügt. Mit dieser Hilfe kann der Leser die Relevanz der jeweils geschilderten Tatbestände einordnen.
Bei der deutschen Schreibweise der russischen Namen wird die allgemein verständliche Form der lautlichen Übertragung angewandt und nicht die wissenschaftliche Transkription. Also Tschernenko statt Černenko (russ. Черненко) oder Breschnew statt Brežnev oder Breshnev (russ. Брeжнев). Bei den Vornamen wird die volle Lautform angegeben, also Jurij (russ. Юрий) statt – wie oft vereinfacht – Juri.
Abweichungen gibt es bei der Schreibung des Namens Gorbatschow (russ. Горбачёв; in wissenschaftlicher Transliteration Gorbačёv), der von der Neuen Zürcher Zeitung Gorbatschew und im Englischen Gorbachev geschrieben wird.
Im Text ist gleichbedeutend von Sowjetunion, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken oder der UdSSR (russ. CCCP) die Rede. In Anlehnung an den deutschen Sprachgebrauch verwende ich den Begriff Russische Förderation statt der wörtlichen Übersetzung Russländische Föderation (russ. Российская Федерация). Im Russischen unterscheidet man dagegen zwischen der nationalethnischen (русский – russisch) und der staatsrechtlichen (российский – russländisch) Bezeichnung. Dieser Unterschied ist staatsrechtlich von Belang, weil Russland auch heute noch als größter Flächenstaat der Welt mit über 17 Mio. qkm und über 145 Mio. Einwohner nahezu einhundert verschiedene Völker und Völkerschaften beherbergt, unter denen die Russen knapp 80 Prozent der Bevölkerung stellen. [...]
München/Roaring Branch, Vt., 2012
VORWORT ZUR TASCHENBUCHAUSGABE
Die Taschenbuchausgabe wurde um drei Beträge gekürzt, die im Rückblick keine entscheidende Bedeutung für den historischen Prozess der Perestrojka unter Gorbatschow haben. Es handelte sich dabei thematisch um den Sonderfall Mongolei1, um die außenpolitischen Konsequenzen des Zerfalls der Sowjetunion im Bereich der ehemaligen Verbündeten2 und um eine erste außenpolitische Bestandsaufnahme der russischen Außenpolitik unter Putin3. Ferner wurde der Untertitel der Taschenbuchausgabe wurde umgestellt, der in der Erstausgabe lautete: Die letzten Jahre der Sowjetunion unter Michail Gorbatschow. Durch die inzwischen lange Regierungszeit von Vladimir Putin als Präsident, Ministerpräsident und dann wieder als Präsident der Russländischen Föderation wurde eine ursprüngliche Einschätzung überholt. Sie ging noch von einem kooperativen Pragmatismus der russischen Außenpolitik unter Putin bei gleichzeitiger ideologischer Abschottung aus. Die Turbulenzen und Verhärtungen im Verhältnis zwischen Russland und dem Westen, die Ukraine-Krise, der Anschluss der Krim an die Russländische Föderation, der Krieg in der Ostukraine und die beiderseitige Sanktionspolitik waren zu dieser Zeit noch nicht abzusehen. Auch die innenpolitischen Determinanten der russischen Politik haben sich unter Putin gewandelt. Die gelenkte Demokratie hat sich noch weiter weg entwickelt von der pluralistischen, marktwirtschaftlichen Demokratie westlicher Prägung. Der Entmachtung und Disziplinierung der Oligarchen durch Putin, die unter Jelzin das Land ausgeplündert hatten, ist eine Art neuer staatlich gelenkter Kapitalismus gefolgt, flankiert von einer Zurückdrängung des Medienpluralismus, der sich nur noch in wenigen Nischen behaupten kann. Dies alles zu bewerten, haben sich bereits genügend neue Autoren und Fachleute gefunden.
So bleibt dieses Buch auf eine zeitgenössische, wenn auch selektive Bestandsaufnahme im Stil eines historischen Lesebuchs der Gorbatschow-Zeit. Zur Ergänzung findet sich im Anhang ein Literaturverzeichnis mit Titeln, die von Michail S. Gorbatschow auf deutscher Sprache erschienen sind und damit für deutschsprachige Leser als Originalquellen leicht zugänglich sind. Darunter befinden sich seine Reden und Aufsätze aus seiner Amtszeit als Generalsekretär der KPdSU, als Präsident der Sowjetunion und auch seine spätere Memoirenliteratur. Viele seiner Rückerinnerungen werden von seinen politischen Weggefährten ergänzt, reflektiert, aber auch konterkariert. Einige dieser Titel, die ebenfalls in deutscher Sprache erschienen sind, werden hier als Ergänzung zur Darstellung der Gorbatschow-Zeit angeführt.4
1 Die Mongolei zwischen nationaler Identität und sowjetischem Vorbild. Ein politischer Reisebericht. In: Osteuropa 2-3, 1989, 253-259.
2 Katastrophe oder Chance? Die wirtschaftliche und politisch Zukunft Osteuropas und der früheren Sowjetunion. Verband der Baden-Württembergischen Textilindustrie. Stuttgart 1992
3 Von der Konfrontation zur Kooperation. Der Wandel der russischen Außenpolitik unter Putin. Vortrag am Institut für Politikwissenschaften der Universität Regensburg [11. Dezember] 2001
4 Agangbegjan, Abel [Wirtschaftsberater von Gorbatschow]: Ökonomie und Perestrojka. Gorbatschows Wirtschaftsstrategie. Hoffmann und Campe: Hamburg 1989.
Falin, Valentin [Mitglied des Zentralkomitees, Leiter der Internationalen Abteilung]: Konflikte im Kreml. Zur Vorgeschichte der Einheit und Auflösung der Sowjetunion. Blessing: München 1997.
Jakowlew, Alexander [Mitglied des Politbüros, ‚Architekt’ der Perestrojka]: Die Abgründe meines Jahrhunderts. Faber&Faber: Leipzig 2003.
Jelzin, Boris [Mitglied des Politbüros, Rivale von Gorbatschow]: Aufzeichnungen eines Unbequemen. Droemer Knaur: München 1990.
Ligatschow, Jegor [Mitglied des Politbüros, Reformgegner]: Wer verriet die Sowjetunion. Das neue Berlin: Berlin 2012.
Ryschkow, Nikolai [Vorsitzender des Ministerrates]: Mein Chef Gorbatschow. Die wahre Geschichte eines Untergangs. Das neue Berlin: Berlin 2013.
Saslawskaja, Tatjana [Reformorientierte Wirtschaftswissenschaftlerin]: Die Gorbatschow-Strategie. Wirtschafts- und Sozialpolitik der UdSSR. Orac: Wien 1989.
Schwardnadse, Eduard [Außenminister]: Die Zukunft gehört der Freiheit. Rowohlt: Reinbeck 1991.
PERESTROJKA AUS ERSTER HAND
Erlebnisse im Alltag eines Auslandskorrespondenten5
Als ich im Sommer 1983 als junger Korrespondent nach Moskau kam, lebte die Sowjetunion in trotziger Abschottung gegenüber dem Westen. Mein späterer Freund Sascha schrieb romantische Lieder, die er zur Gitarre sang, Lieder, die ein Land schilderten, das von unendlichem Schnee bedeckt ist, Menschen, die in diesem Schnee unentrinnbar gefangen sind. Zaghaft klang der Wunsch nach Veränderungen durch. Alles war noch systemkonform. Im Kreml regierte Parteichef Andropow, von schwerer Krankheit gezeichnet. Da passierte ein unglaublicher Zwischenfall, der mein Verhältnis zur Informationspolitik des Regimes nachhaltig prägte. Sowjetische Jagdflugzeuge schossen ein südkoreanisches Linienflugzeug ab, das sich - aus bis heute ungeklärten Gründen - in den sowjetischen Luftkorridor verirrt hatte. 269 Menschen starben. Tagelang schwieg der Kreml. TASS wiederholte stets dieselbe Meldung: Ein Flugzeug fremder Herkunft sei in den sowjetischen Luftraum eingedrungen und dann Richtung Japanisches Meer entschwunden. Unter internationalem Druck musste Moskau knapp eine Woche später den Abschuss der Linienmaschine eingestehen.
Die absurde Krönung der sowjetischen Informationspolitik lieferte dann der damalige Sprecher des Außenministeriums, Leonid Samjatin, auf einer internationalen Pressekonferenz. Ein westlicher Korrespondent stellte die Frage, warum die sowjetische Führung sechs Tage lang habe Lügen verbreiten lassen, bevor sie die Wahrheit eingestand. Der Regierungssprecher verfiel einem regelrechten Wutausbruch und schrie zornentbrannt: „Wir haben in dieser Sache nie gelogen. Wenn Sie das behaupten, dann verstehen Sie unsere Sprache nicht, vor allem nicht unsere politische Sprache. Was wollen Sie dann überhaupt in unserem Land?“ Ja, was wollte ich eigentlich in diesem Land, in dem die Informationspolitik aus dem Verschweigen der Wahrheit und dem Suggerieren der Unwahrheit bestand? Staats- und Parteichef Jurij Andropow hatte nur noch wenige Monate zu leben. Ansätze einer Reformdiskussion, die von ihm stammten, verschwanden schnell in den Schubladen. Dann folgte der ebenfalls schwerkranke Konstantin Tschernenko. Ein grausames Spiel begann: Maskenhaft geschminkt wurde Tschernenko vor die Kamera geschleppt. Er sollte die Stärke des Regimes demonstrieren. Doch inzwischen wusste jeder: Es tobt ein Machtkampf im Kreml. Informanten und Zuträger aus allen Richtungen versuchten, die ausländischen Korrespondenten zu instrumentalisieren, für und gegen die Reformer, die nun immer stärker ihre Stimme erhoben.
Ein Erlebnis im Stadtpark von Riga: im Freien, also abhörsicher, diskutierte ich mit einem Vertreter des Moskauer Außenministeriums, der mich pflichtgemäß auf der Reise nach Lettland begleitete. Nach russischer Sitte waren wir schnell per Du. „Hannes, ich sage Dir, wir brauchen mehr Demokratie“, platzte es plötzlich aus meinem sowjetischen Begleiter heraus. „Nicht nur Tschernenko ist krank. Seine Amtszeit ist eine Krankheit unseres Systems.“ Provokation oder echtes Anliegen? Ich blieb vorsichtig. Doch dann entwickelte mein Begleiter ein Szenario, das aus dem Handbuch für Glasnost und Perestrojka hätte stammen können. „Keine Demokratie wie Du Dir das vorstellst, nicht mit mehreren Parteien. Wir müssen erst einmal innerhalb der KP aufräumen, die meisten Genossen wissen doch nicht, was eine freie Meinung ist!“ Mein sowjetischer Begleiter von damals sollte Recht behalten. Er entpuppte sich als Anhänger von Reformen. Heute ist er ein wichtiger russischer Diplomat, der weiterhin nach Wegen sucht, um Russland in Richtung Demokratie zu bringen. Unser Kontakt ist über alle politischen Umbrüche hinweg erhalten geblieben.
Dann kam der 13. März 1985. Die Luft schien gefroren. Doch trotz eisiger Kälte hatten Hunderte von neugierigen Korrespondenten und Diplomaten mühselige Kontrollen von Polizei und Armee über sich ergehen lassen, um einer Totenfeier beizuwohnen, die den Machtwechsel im Kreml einleitete. Da stand er nun auf dem Leninmausoleum, der neue starke Mann der Sowjetunion, Michail Gorbatschow. Vor ihm auf dem Roten Platz ruhte der offene Sarg mit seinem verstorbenen Vorgänger Konstantin Tschernenko. Nur mit wenigen Sätzen betrauerte Gorbatschow den Tod von Tschernenko. Was dann folgte, waren massive Verstöße gegen das Protokoll der kommunistischen Rituale, ein Schock für die Nomenklatura. Gorbatschow wetterte in seiner ersten öffentlichen Rede als Generalsekretär plötzlich über die verlogene, heuchlerische Gesellschaft im Land. Er schwang die Peitsche weitreichender Drohungen: Lügner müssen bestraft und Nichtstuer zur Arbeit angehalten werden. Glasnost und Perestrojka deuteten sich an. So etwas hatte die Welt bei der Beerdigung eines sowjetischen Parteichefs noch nicht zu hören bekommen. Dies war ein Vorgeschmack auf die Ungeduld, mit der Gorbatschow sein Land zu Reformen drängte.
Der neue Stil brachte noch eine weitere Überraschung. Gorbatschow verweigerte dem Sarg von Tschernenko die letzte Ehre, wie sie seit Lenins Zeiten üblich war. Nicht mehr die Mitglieder des Politbüros, sondern nur noch Offiziere der Armee trugen den Sarg zur Kremlmauer. Dazwischen lag eine Beobachtung, die man als junger Korrespondent nicht mehr vergisst: Die Witwe von Tschernenko stürzte sich tränenüberströmt auf den offenen Sarg und schlug mehrfach das Kreuz über den Toten, der bis zuletzt im Namen der Partei den Atheismus zu propagieren hatte. Der Benjamin des Politbüros, Michail Gorbatschow, war mit seinem ersten großen Auftritt für die meisten Sowjetbürger eine Entdeckung. Urteile über ihn: „Der Mann kann frei sprechen. Er muss nicht jeden Satz ablesen. Er sagt offensichtlich, was er denkt.“
Der Kreml öffnete sich auch für Vertreter aus dem Westen. Unter den vielen durchreisenden Politikern sind mir die Reaktionen von zwei Personen deshalb in lebhafter Erinnerung geblieben, weil sie niemals im Verdacht standen, mit den kommunistischen Herren im Kreml geliebäugelt zu haben. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher und der bayerische Ministerpräsident Franz-Josef Strauß. Frau Thatcher wurde in der sowjetischen Presse gerne mit einem feindlichen Panzerkreuzer verglichen. Sie kam als Klassengegner und verließ Moskau als Siegerin nach Punkten. Dazwischen lag eine der überraschendsten Annäherungen am Ende des Kalten Krieges. Bei der Pressekonferenz mit Margaret Thatcher in Moskau schien es zum Eklat zu kommen. Im Presseamt des sowjetischen Außenministers versagten für Frau Thatcher alle Mikrophone und die gesamte Verstärkeranlage. Fast zweihundert neugierige Journalisten feixten, wie sich die Dame wohl Gehör verschaffen werde. Sie schaffte es. Frau Thatcher bog alle Mikrophone zur Seite und zelebrierte ihren Stil aus dem britischen Unterhaus: „Wenn ich meine Stimme erhebe, wer kann mich hören?“, rief sie den lachenden Journalisten zu. Dann folgte ihr stimmgewaltiges Statement, das viele Skeptiker überraschte: „Dies war die faszinierendste und anregendste Reise, die ich jemals als Premierminister im Ausland unternommen habe“, bekannte Frau Thatcher und schilderte Einzelheiten aus einem siebenstündigen Streitgespräch mit Michail Gorbatschow. Man war sich - natürlich - in allen entscheidenden Fragen uneins. Größter Streitpunkt war die Rüstungskontrolle. Dennoch blieb es bei ihrer euphorischen Einschätzung: „Ich sagte, er sei jemand, mit dem ich gut ins Geschäft kommen könnte. Wir haben hier nun eine Menge Business erledigt.“ Das inoffizielle Bild des Thatcher-Besuches lieferten mir russische Freunde. Die britische Premierministerin hatte sich im sowjetischen Fernsehen einer Debatte mit russischen Journalisten gestellt. Auf erste kritische Nachfragen über Arbeitslosigkeit und soziale Ungerechtigkeit in Großbritannien drehte die streitbare Politikerin den Spieß um. Sie bombardierte die russischen Journalisten mit Fakten über sowjetische Menschenrechtsverletzungen, wirtschaftliche Missstände und militärisches Drohpotential. Die Herren schwiegen betreten. Der Dolmetscher konnte bei dem Redefluss von Frau Thatcher kaum mithalten. Noch am Abend riefen mich sowjetische Freunde an: „Wot, ona maladjetz!“ - „Was für ein toller Kerl! Die sollte bei uns Generalsekretär werden.“ Nicht weniger spektakulär war der Überraschungsbesuch von Franz-Josef Strauß in Moskau. Kurz nach Weihnachten 1987 steuerte er eigenhändig sein Flugzeug Richtung Osten. Der denkwürdige Telefonbericht jenes Besuches mit den überraschenden Reaktionen von Franz-Josef Strauß befindet sich heute im Rundfunkarchiv. Strauß bekannte, unmittelbar nachdem er den Kreml verlassen hatte: „Ich habe so etwas nicht erwartet und auch so etwas mir für Russland, für den Führer der Sowjetunion nicht so ohne weiteres als möglich vorgestellt. Gorbatschow war ungezwungen, sehr, sehr selbstbewusst, sehr selbstsicher, ohne überheblich zu sein. Das Gespräch verlief ohne jede aggressive Formulierung, ohne jede Zuspitzung, auch mit deutlicher Betonung der Meinungsunterschiede, aber ich muss sagen - ohne dass ich sehr sentimental, pathetisch beeinflussbar bin - dass ich mit den angenehmsten Gefühlen, in dem Bewusstsein, dass man sich nicht zu viel erwarten darf, weggegangen bin.“ Strauß war beeindruckt, wie klar und realistisch Gorbatschow die Ziele der Perestrojka definiert hat, die allerdings einen langjährigen Entwicklungsprozess voraussetzen. Die alten Zielsetzungen der Sowjetideologie im militärischen und politischen Bereich unterlagen einem Wandlungsprozess, der Strauß zu der Schlussfolgerung veranlasste: „Hier kann ich - ohne dass ich mich selber zu vergewaltigen brauche - sagen, dass Herr Gorbatschow so viele innere Probleme hat in der Sowjetunion selber und bei den Verbündeten der Sowjetunion, dass auf eine heute nicht absehbare Zeit hinaus an irgendeine militärische Konfrontation meines Erachtens nicht gedacht werden kann. Und wenn die alten sowjetischen Zielsetzungen wegfallen, dann stehen wir an der Schwelle eines neuen Zeitalters.“ Nach heutigem Standard würde man über die Tonqualität unserer Rundfunkberichte aus dem Jahr 1987 eher die Nase rümpfen. Inzwischen klingt alles voller, glatter, brillanter. Wir hätten damals auch gerne für einen besseren Ton aus Moskau gesorgt, wenn nicht trotz Glasnost und Perestrojka so viele Blockaden die Arbeit der Ausländer eingeschränkt hätten. Zu diesen Einschränkungen gehörte das Telefonieren. Die Qualität unserer Leitungen war oft jämmerlich. Um überhaupt in das Ausland telefonieren zu können, mussten wir eine besondere Nummer bei der Vermittlung anrufen. Als Korrespondenten wurden wir bevorzugt behandelt - mit einer Wartezeit von 20 bis 30 Minuten. Die Wartezeit für Privatgespräche konnte dagegen Stunden dauern. Im Laufe der Jahre wurde dank Glasnost und dank technischer Hilfe die Wartezeit reduziert, bis endlich für viel Geld eine freie Durchwahl in das Ausland möglich war.
Weniger flexibel zeigte sich die Sowjetmacht nach innen. Die Reisen von Ausländern, die außerhalb des Stadtringes von Moskau führten, mussten sogar bis zum Ende der Gorbatschow-Zeit zwei Werktage im voraus registriert und genehmigt werden. Sowjetbürger durften in einem ausländischen Wagen nicht mitfahren. Ich habe mich nicht darangehalten und wurde prompt erwischt. Meine Freunde wurden bestraft, ich erhielt eine Verwarnung vom Außenministerium. Überdies hatte ich mit dem Auto die Stadtgrenze überschritten und war in einem Vorort gelandet, der für Ausländer auf das strengste verboten war. Noch heute verfüge ich über die bis 1989 gültige Liste von Straßen, Brücken und Ortschaften im Bezirk Moskau, die namentlich für Ausländer gesperrt blieben. Tabus nach innen wurden zwar auf dem Papier der Tagespresse schnell infrage gestellt. Bei der Umsetzung im Alltag haperte es jedoch gewaltig. Reform und Kontrolle - so wollten es viele Kader - sollten Hand in Hand gehen.
Szenenwechsel: eine Sporthalle am Stadtrand von Moskau. Im Inneren toben tausend Jugendliche. Sie haben eine Sportveranstaltung zu einem verbotenen Rockkonzert umgemünzt. Die Miliz will eingreifen. Erstmals erlebte ich den Aufstand der Jugend gegen die Staatsgewalt. Und erstmals erlebte ich, wie die Miliz nachgab. Auf der Bühne spielte die Rockband DDT, offiziell mit Auftrittsverbot belegt. Ein Freund hatte mich hierhergebracht. Unter dem Mantel hielt ich ein Mikrophon versteckt. Eine akustische Orgie von Protest und Befreiung brach los. Spott und Hohn schüttete der Sänger über den Kommunismus aus. Die Fans waren nicht zu bremsen. Jahre später produzierte dieselbe Rockgruppe dieselben Lieder auf CD. Aber trotz schlechter Qualität ist mir die authentische Aufnahme aus dem Untergrund lieber. Bald jedoch drangen die Proteste aus dem Untergrund an die Oberfläche des Landes. Der Rote Platz, jahrzehntelang von KGB-Wachen rund um die Uhr kontrolliert, wurde zum Gegenstand einer der bis dahin größten Massendemonstrationen. Krimtataren, die unter Stalin wegen angeblicher Kollaboration mit den Deutschen deportiert worden waren, kämpften für die Rückkehr in die Heimat. Ihre Hoffnung hieß Gorbatschow. Er hatte verkündet, die weißen Flecken in der Geschichte der Sowjetunion sollten ausgelöscht werden. Die Verbrechen der Stalin-Zeit würden aufgearbeitet. Zu Unrecht Verfolgte sollten rehabilitiert werden.
Eine Zerreißprobe zwischen der staatlichen Macht und den Demonstranten zeichnete sich ab. Noch wenige Jahre zuvor hatte ich miterleben müssen, wie eine kleine Gruppe von Russlanddeutschen auf dem Roten Platz ein Bettlaken ausbreitete mit der Aufschrift „SOS - Wir wollen in unser Vaterland“. Nur Sekunden später sprangen Passanten herbei, die sich als KGB-Schläger entpuppten. Sie prügelten die Russlanddeutschen zusammen, ein grauer Milizwagen raste über den Platz, die Demonstranten wurden hineingestoßen und abtransportiert. Nun war alles anders: Erst achthundert, dann tausend, dann immer mehr Krimtataren hielten Tag und Nacht den Roten Platz besetzt, ohne dass die Miliz oder die KGB-Leute aktiv wurden. Die Demonstranten verlangten nach Gorbatschow. Mit einer schwedischen Rundfunkkollegin stand ich in einem Kessel von diskutierenden Menschen, um Interviews aufzunehmen. In diesem Moment wollte die Miliz eingreifen. Als ausländischen Korrespondenten war es uns verboten, an Demonstrationen teilzunehmen, geschweige denn, Anlass für Demonstrationen zu sein. Plötzlich riefen die Krimtataren sich einander zu: „saditjess, saditjess“, „setzt euch“. Mit ihren Körpern bildeten sie einen Schutzwall um uns Journalisten, während wir verblüfft in der Mitte stehen blieben. Zur eigenen Ablenkung habe ich in diesem Moment begonnen, die angespannte Situation auf Band zu sprechen:
„Jetzt setzen sich alle Leute vor uns auf den Boden als Protestdemonstration, weil die Polizei uns hindern will, die Aufnahmen durchzuführen, und weil die Polizei entgegen den geltenden Regeln die akkreditierten Korrespondenten hier an der Arbeit hindern will. Ich darf die Leute nicht ansprechen, um nicht in den Vorwurf zu kommen, dass ich hier einen öffentlichen Aufruhr mache. Deshalb halte ich mich zurück und beobachte nur die Leute, die uns mit großen, braunen Augen anstarren: Vor mir sitzen viele Frauen, Männer. Sie hocken auf dem Boden. Ich habe so etwas in Moskau noch nie erlebt. Die Miliz allerdings greift nicht weiter ein. Sie hält sich im Moment noch zurück. Sie versucht, mit beschwichtigenden Worten uns zurückzuziehen. Sie sagen immer wieder ´Entschuldigen Sie´. Wir folgen jetzt dem Milizionär zunächst zur Seite...“
Erstmals spürte ich - geschützt von den auf der Erde hockenden Menschen - eine Solidarität, wie ich sie als Korrespondent in der Sowjetunion bis dahin nie kennen gelernt hatte. Dann bestürmten mich die Krimtataren, warum ich der Miliz folge und wegginge. Ich erklärte ihnen auf Russisch, dass ich jetzt nicht mehr mit ihnen sprechen dürfe, es sei denn, sie, die Krimtataren wollten von sich aus mit mir weiterreden und Fragen an mich richten. Das dürfe aber nicht hier am Ort der Demonstration stattfinden. Ich ging weiter - und Dutzende von Menschen folgten mir. Die Aufweichung der starren Staatsgewalt wurde immer deutlicher. Die Miliz war verunsichert. Die Politik von Gorbatschow hatte dazu geführt, dass die alten Werte der kommunistischen Ordnung zerbrachen. Doch etwas Neues schien noch nicht nachzuwachsen. Diesen Zwiespalt bekamen all jene deutlich zu spüren, die von Gorbatschow mehr erwarteten als nur das Signal zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Vergangenheit und Gegenwart der Sowjetunion. Bestes Beispiel dafür war das Schicksal von Andrej Sacharow, Bürgerrechtler und Friedensnobelpreisträger. Kurz nach dem Einmarsch der sowjetischen Armee in Afghanistan war Sacharow im Januar 1980 nach öffentlichen Protesten auf der Straße verhaftet und ohne Gerichtsurteil nach Gorki verbannt worden. Wann immer westliche Journalisten nach Sacharow fragten, wurden sie mit kaltschnäuzigen Lügen abgewiesen, bis im Winter 1986 das Gerücht verbreitet wurde, Gorbatschow wolle Sacharow aus der Verbannung nach Moskau zurückholen.
Das alte Spiel im Grenzbereich zwischen Information und Desinformation funktionierte noch. Am 22. Dezember 1986 erhielt ich spät abends - wie andere Korrespondenten auch – zu Hause einen anonymen Anruf. Der Nachtzug aus Gorki werde eine Überraschung nach Moskau bringen, hieß es. Mehr nicht, kein Hinweis, worum es sich handelte, keine Uhrzeit wurde genannt. Aber mir war klar, es bestand die Chance, dass es sich um die Rückkehr von Sacharow handeln könnte. Gegen fünf Uhr morgens war ich bereits am Jaroslawer Bahnhof. Der Zug sollte mehr als eine Stunde später eintreffen. Auf dem äußersten Gleis entdeckte ich den russischen Maler Boris Birger, der zum Freundeskreis von Sacharow gehörte. In der Nähe warteten zahlreiche Herren in auffällig uniformer Zivilkleidung. Als der Nachtzug aus Gorki einfuhr, stand ich unmittelbar neben Boris Birger, der offensichtlich genauer informiert war. Denn direkt vor uns öffnete sich die Waggontür, und heraus drängte die kämpferische Ehefrau von Andrej Sacharow: „Es geht nicht um mich. Es geht um Andrej Dmitrijewitsch“, beschwichtige Jelena Bonner die Menschentraube der meist ausländischen Journalisten. Dann erschien Sacharow in der Waggontür - und blieb unmittelbar neben mir stehen. Ich war in diesem Moment innerlich mindestens so erregt, wie Sacharow selbst bei seinen ersten Worten. Alle Kollegen bestürmten den Bürgerrechtler mit Fragen, die er geduldig beantwortete: Nein, eine Ausreise aus der Sowjetunion werde er nicht beantragen. Er wolle wieder wissenschaftlich arbeiten. Zur Politik könne er wenig sagen. Die letzten sieben Monate habe er nur ein einziges Mal mit einem anderen Menschen auf der Straße ein paar Worte wechseln können. Sonst seien er und seine Frau total isoliert gewesen. Das Ende der Verbannung sei für ihn überraschend gekommen. Sieben Jahre lang besaß er kein Telefon. Plötzlich hätten Techniker ihm einen Apparat installiert, an dem sich kurz darauf Gorbatschow persönlich gemeldet habe, um ihm mitzuteilen, er, Sacharow könne nach Moskau zurückkehren. Dann kam der Bürgerrechtler zum Thema Afghanistan, Ausgangspunkt für seine Verbannung: Afghanistan war für Sacharow die offene Wunde seines Heimatlandes, das brennendste außenpolitische Problem der Sowjetunion.
Der Bürgerrechtler kehrte im Triumph an die Akademie der Wissenschaften zurück. Politisch engagierte sich Sacharow im Volkskongress, wo er zunächst mit, dann aber gegen Gorbatschow für weitere Reformen kämpfte. Denn bald zeigte sich, dass Sacharow in seinen Demokratievorstellungen weiter ging als Michail Gorbatschow. Das Leitthema von Sacharow, der Afghanistan-Krieg, ließ sich nun nicht länger aus der Öffentlichkeit verdrängen. Der Krieg war zu einem Trauma für die Bevölkerung geworden. Immer wieder baten mich Freunde um Geld oder westliche Elektronikgeräte, um wichtige Leute im Militär zu bestechen. Denn mit Bestechung, so glaubten sie jedenfalls, könnten sie ihre Söhne vor einem Kriegseinsatz in Afghanistan bewahren.
Ich erinnere mich an die bedrückende Geschichte einer guten Bekannten. Sie glaubte, ihr Sohn sei zu einem ungefährlichen Auslandseinsatz, vermutlich in Syrien, abkommandiert worden. Ein Foto aus dem Militärdienst ließ den Einsatzort nicht erkennen. Im Brief durften die Soldaten über den Aufenthaltsort in den ersten drei Monaten nichts sagen. Dann kam die Todesnachricht aus Afghanistan, „gestorben bei der Ausübung internationaler Pflichterfüllung“. So lautete die Standardformel. Dazu erfolgte eine Geldüberweisung für die Beerdigung. Es war jedoch verboten, auf dem Grabstein zu vermerken, dass der junge Soldat in Afghanistan gefallen war. Beim Thema Afghanistan versuchte das Militär Glasnost, die neue Offenheit, immer wieder zu unterdrücken. Der Afghanistan-Krieg wurde sogar noch weiter idealisiert, obwohl die meisten ahnten, dass dieser Kampf bereits verloren war:
In dieser Situation erlebte ich eine makabre Feier zum 70. Jahrestag der Sowjetarmee, bei der sogar junge Mädchen den Einsatz ihrer Freundin in Afghanistan bejubelten: „Unsere Freundin Leutnant Waronina dient in Afghanistan. Und wir sind stolz auf sie!“ Ein Dreikäsehoch lobte mit stolzgeschwellter Brust die Sowjetarmee als die stärkste Armee der Welt. Jung und Alt jubilierten gemeinsam, stimmstark, wenn auch musikalisch nicht gerade sehr harmonisch. Das Bild des tapferen Sowjetmenschen, der allen Kriegen trotzt, gehörte zu den letzten Resten von Selbstbewusstsein, die das zerberstende System seinen Bürgern bieten konnte. Der „obyknowjennyj sowjetskij tschelowjek“, der gewöhnliche Sowjetmensch, musste als letzte gemeinsame Identität herhalten, nachdem die Ideale des Kommunismus zerbrachen und die nationale Frage sich zum Sprengstoff für den Zusammenhalt des riesigen Vielvölkerstaates entwickelte.
Auch Glasnost und Perestrojka konnten nicht an dem Mythos der Oktoberrevolution kratzen. Das martialische Zeremoniell der Elitetruppen auf dem Roten Platz fand weiterhin Jahr um Jahr statt, begleitet von den heroischen Reportagen im sowjetischen Fernsehen. Vor dem Leninmausoleum marschierten als Symbol sowjetischer Unverwundbarkeit die Truppen der Armee, die Truppen des Innenministeriums, die Grenztruppen des KGB.
Wer den Roten Platz nur von Bildern kennt, wird erstaunt sein, wie klein die Fläche in Wirklichkeit ist. Umso bedrückender wird der ausländische Beobachter auf der Besuchergalerie neben dem Leninmausoleum von Marschmusik und Panzerketten akustisch überrollt. Ein Eindruck, der früher sicher gewollt war, um Stärke und Abschreckung zu demonstrieren. Doch dann landete auf eben diesem Roten Platz ein kleines Sportflugzeug mit dem deutschen Piloten Matthias Rust. Er hatte alle Radarkontrollen unterlaufen und wurde von den ersten Moskowitern Schulter klopfend begrüßt. Genau genommen landete er auf der ansteigenden Zufahrtstraße zum Roten Platz, die vom Fluss Moskwa zur Basilius-Kathedrale führt. Fast neben dieser Kathedrale brachte er sein Sportflugzeug zum Stehen. Dies erfuhr die Öffentlichkeit erst später aus dem Amateurvideo eines britischen Touristen, der den Anflug und die Landung vom benachbarten Hotel Rossija aus filmte. Zunächst aber war Katastrophenstimmung angesagt. Gerüchte machten die Runde. Ein deutscher Spion habe mit seinem Flugzeug eine Bombe über dem Kreml direkt am Roten Platz abwerfen wollen. Was für den Westen wie das Lausbubenstück eines übermütigen jungen Piloten aussah, war für die Sowjetunion weitaus tragischer. Das Symbol der Unverwundbarkeit, der Rote Platz mit dem Kreml, das Zentrum der Sowjetmacht schlechthin, war beschädigt worden. Bald mussten sich die Sowjetbürger daran gewöhnen, dass auch die Armee als militärisches Symbol der Unverwundbarkeit ihren Glanz einzubüßen drohte. Die orthodoxe Kirche kehrte mit einem Requiem für die gefallenen Soldaten in Afghanistan erstmals wieder in die Öffentlichkeit zurück, ausgestrahlt vom sowjetischen Fernsehen. Zwei Tabus wurden dabei gebrochen: der Afghanistan-Krieg wurde nach Jahren bemühter Jubelorgien nun zu einem landesweiten Trauerfall erklärt; und die orthodoxe Kirche übernahm dabei die Rolle des Trösters in nationaler Not. Kontrastreicher konnte für die Sowjetbürger der Wendepunkt in Gorbatschows Afghanistan-Politik kaum eingeleitet werden. Bald häuften sich in den Zeitungen Reportagen vom Schrecken dieses Krieges. Junge Veteranen klagten Staat und Gesellschaft an. Filmreportagen zeigten, wie der Krieg viele Soldaten in Drogenabhängige verwandelt hatte. Schließlich bewilligte mir das sowjetische Außenministerium einen langjährigen Antrag. Ich durfte, zusammen mit einigen Kollegen, in das Kriegsgebiet nach Kabul reisen. In Moskau hatte ich zuvor mehrfach Gelegenheit, den damals starken Mann Afghanistans, Nadschibullah, zu treffen. In fließendem Russisch erläuterte er den angeblich bevorstehenden Sieg seiner Armee. Dann änderte Nadschibullah seinen Namen. Er strich den Hinweis auf Allah, nannte sich nur noch Nadschib und erklärte seine Gegner zu fundamentalistischen Glaubenskriegern, die auch dem Westen bedrohlich werden könnten. Um dies alles selbst in Augenschein zu nehmen, starteten wir Richtung Afghanistan. Doch als wir nach sechs Stunden den Hindukusch überquerten, wartete ich vergeblich auf den Landeanflug Richtung Kabul. In unverminderter Höhe glitt die Maschine weiter bis über den Talkessel der afghanischen Hauptstadt. Plötzlich erschienen an beiden Seiten der Bordfenster sowjetische Jagdflieger.
In respektvollem Abstand nebelten sie den Luftraum mit einer Magnesiummischung ein, um Wärme suchende Raketen der Mudjaheddin von uns abzulenken. Dann begann der spiralförmige Landeanflug auf Kabul. Der Flugkapitän hatte dabei keinen Spielraum zu verschenken und musste in engsten Kurven die Maschine über dem Talkessel sinken lassen. Wer bis dahin alle Achterbahn-Fahrten gut überstanden hatte, erlebte hier eine neue Herausforderung. Als die Maschine sich noch gut hundertfünfzig Meter über dem Boden befand und auf die Landebahn zuflog, tauchten Jagdhubschrauber auf. Auf den letzten Metern sicherten sie die Landung ab, indem sie die Randstreifen rechts und links außerhalb der Landebahn beschossen. Ich konnte zunächst nicht entscheiden, ob das alles nur eine gut inszenierte Show war, oder ob die Rebellen tatsächlich schon den Flughafen und den Stadtrand von Kabul kontrollierten. Bald sollte ich die Lage besser verstehen.
Zunächst jedoch ging es zum Beten in die große Moschee von Kabul. Das heißt, wir Korrespondenten wurden auf eine Balustrade geführt, um in Bild und Ton festzuhalten, was nun die neue Lesart des Krieges war: Auf dem Boden der Moschee hockte die gesamte afghanische Führung auf den Knien, um das Gebet zu verrichten: Nadschib, der jetzt wieder Nadschibullah hieß, dann sein Verteidigungsminister sowie weitere hohe Militärs, umgeben von Hunderten von Gläubigen. Die Gegner der fundamentalistischen Glaubenskrieger waren plötzlich selbst Glaubenskrieger geworden. Vor der Moschee kam es dann zu jenem Erlebnis, das von der erstaunlichen Wandlungsfähigkeit des Herrn Nadschibullah zeugte. Wir Korrespondenten standen bereits im Innenhof der Moschee, als Nadschibullah herauskam. Eine schaulustige Masse bedrängte uns. Ich zückte mein Mikrophon, marschierte direkt auf Nadschibullah zu und sprach ihn auf Russisch an:
„Sdrasdwujtje, towarischtsch Nadschib, wy konjetschno pomnite, ja jawljajuc korrespondentom is Moskwy“ - „Hallo Genosse Nadschib, Sie erinnern sich wohl, ich bin Korrespondent aus Moskau.“
Doch weiter kam ich schon nicht. Nadschibullah wehrte vehement mit beiden Händen ab: „No Russian, English please, I don‘t speak Russian.” Dann zog mich ein Sicherheitsmann zur Seite und flüsterte mir ins Ohr: „Bloß kein Wort Russisch in der Öffentlichkeit.“ Mehr brauchte ich nicht zu wissen, um zu verstehen, auf welch verlorenem Posten die sowjetische Armee ihren Afghanistan-Krieg betrieb. Der nächste Tag, als Nadschibullah von einer Art Volksversammlung zum neuen Staatspräsidenten gewählt werden sollte, bestärkte meinen Verdacht, dass Kabul militärisch kaum zu halten war. Meine alten Tonbandaufzeichnungen dokumentieren jenen Tag: „Ich bin vor dem Malimah-Pal-Hotel in Kabul, dem ehemaligen Intercontinental-Hotel. Das Maschinengewehrfeuer kann nicht sehr weit von uns entfernt sein. Vor mir erstreckt sich ein Berg, etwa siebenhundert Meter von dem Hotel entfernt. Dort hinter wird wie wild geschossen. Zu meiner Rechten liegt die große Tiefebene, in der auch das Gebäude steht, in der die Volksversammlung heute die Verfassung verabschieden wird und möglicherweise auch den neuen Staatspräsidenten wählen wird. Seitdem die Volksversammlung zusammengetreten ist, haben offensichtlich Mudjaheddin das Feuer um Kabul herum eröffnet. Man hört leichte Artillerie bis spät in die Nacht hinein und nun seit dem frühen Morgen Maschinengewehrsalven in den Bergen rings um Kabul.“
Ich flog nach Moskau zurück und ahnte, dass der sowjetische Abzug aus Afghanistan nur noch eine Frage der Zeit sein konnte. Für Gorbatschow allerdings war damit ein großes Problem verbunden. Wie konnte er der sowjetischen Militärführung diese Niederlage zumuten, ohne sich Feinde zu machen? Gorbatschow hat dieses Problem nie zu lösen vermocht. So konnte der letzte Verteidigungsminister der Sowjetunion, General Jazow, die Niederlage des Militärs in Afghanistan nicht verwinden und schlug sich später auf die Seite der Putschisten gegen Gorbatschow.
Doch nicht nur im Militär, auch in der politischen Führung rief Gorbatschow manche Konfrontation hervor. Je länger Gorbatschow im Amt blieb, desto widersprüchlicher wurde sein Kurs von Reform und Gegenreform, desto kritischer wurde die Bevölkerung, deren Beschwerden er sich immer wieder auf Reisen im Land stellte. Im sibirischen Krasnojarsk schimpften die Leute über leere Geschäfte und korrupte Parteibosse. Gorbatschow - und mit ihm das sowjetischen Fernsehen waren zur Stelle. „So etwas muss geändert werden“, lautete die Standardparole von Gorbatschow. Doch der von ihm praktizierten Offenheit folgte in der Bevölkerung selbst nur selten Eigeninitiative. Die Menschen waren zu sehr daran gewöhnt, dass man ihnen nicht nur das Denken, sondern auch das Handeln vorschrieb. Boltatj - schwatzen, plappern, mit dieser Vokabel belegte der Volksmund bald die endlosen Reden, Statements und Auftritte von Gorbatschow. Auch unter vielen Parteikadern wurden Gorbatschows Reden von der Vertiefung, Erweiterung und dem Ausbau der Perestrojka, die Schlagworte vom menschlichen Faktor und der Demokratisierung weniger ernst genommen als vom Ausland. Unter den angepassten oder überzeugten Anhängern von Gorbatschow fiel schon sehr früh ein Mann wegen seiner ungewöhnlich robusten und unverfälschten Sprache auf: Boris Jelzin. Der Parteichef aus Swerdlowsk - heute wieder Jekaterinburg - wurde von Gorbatschow nach Moskau geholt, um den dortigen Parteisumpf von Protektion und Mafiamethoden trockenzulegen. Die ersten Amtshandlungen brachten dem neuen Stadtparteichef Jelzin jene Popularität, mit der er später seinen politischen Feldzug gegen Gorbatschow gewann. Wenige Tage nach seinem Dienstantritt ließ sich Jelzin früh morgens mit seinem Dienstauto in eine der großen Trabantensiedlungen am Stadtrand von Moskau fahren. Anschließend versuchte er, mit öffentlichen Verkehrsmitteln sein Büro im Stadtzentrum zu erreichen. Bei den zahlreichen Pannen der stets überfüllten Busse und den unglaublichen Warteschlangen, brauchte Jelzin zwei Stunden, ehe er in seinem Büro ankam. Seine öffentliche Reaktion darauf: „Jetzt kann ich verstehen, warum die Leute lieber blaumachen, statt sich auf diese Art zur Arbeit zu quälen.“ Damit löste Jelzin Jubel bei der Bevölkerung aus. Er legalisierte den Schwarzhandel in Moskau, errichtete kleine Marktbuden für private Verkäufer und strich Versorgungsprivilegien der Nomenklatura. Für Gorbatschow, der eine kämpferische Anti-Alkoholkampagne vertrat, hatte Jelzin aber einen entscheidenden Fehler. Boris Jelzin, der populäre Stadtparteichef von Moskau, trank mehr als ihm gut tat. Der zweite Fehler Jelzins war - in Augen von Gorbatschow - noch schlimmer. Denn Jelzin kritisierte öffentlich den zögerlichen Reformwillen des Generalsekretärs - und er kritisierte den zunehmenden Einfluss von Raissa Maximowna Gorbatschowa, der Frau von Michail Gorbatschow, innerhalb der Parteigremien. Die Abrechnung, die Gorbatschow mit Jelzin betrieb, war gnadenlos - und diese Abrechnung ist der Schlüssel für Gorbatschows endgültigen politischen Sturz in der Sowjetunion. Im Zentralkomitee musste der damals kranke, mit Medikamenten aufgeputschte Jelzin im Stil der Stalinzeit bekennen, dass er sich schuldig gemacht habe vor Michail Gorbatschow und vor der ganzen Kommunistischen Partei. Dann verlor Jelzin alle Parteiämter und wurde in das Bauministerium verbannt. Wer damals mit dem gestürzten Politiker zusammentraf, konnte dessen tiefe Verbitterung erleben. Aus dem Parteimann wurde ein Parteirebell. Und er rebellierte mit Unterstützung der Moskauer im März 1989 gegen Gorbatschow. Niemand konnte ihm mehr seine Auftritte streitig machen. Massen kamen unter freiem Himmel zusammen, um Jelzin zu hören. Bei den ersten halbwegs freien Wahlen erhielt er fast 90 Prozent aller Stimmen in der sowjetischen Hauptstadt. Die üblichen Verleumdungskampagnen des KGB gegen den Trunkenbold Jelzin bewirkten das Gegenteil. „Endlich einer von uns“, sagten die Russen und jubelten mit Jelzin, der sich über seinen Wodkakonsum öffentlich lustig machte. Kurzfristig lebte noch einmal auf, wofür ich als Korrespondent in der Sowjetunion niemals Verständnis hatte: Andere ausländische Kollegen ließen sich von KGB-Halbleitern einspannen, dieses Mal für die Anti-Jelzin Kampagne: Der Mann sei schwer krank, hieß es. Er habe nur noch wenige Wochen zu leben. Wir sollten ihm nicht soviel Aufmerksamkeit schenken. Wir überforderten ihn mit unseren dauernden Interviewwünschen. Und letztlich werde Jelzin den Sommer 1989 nicht überleben. Dann hätten wir alle auf den falschen Politiker gesetzt. Was aber wäre damals die richtige Lesart für die weitere Entwicklung der Sowjetunion gewesen. Gorbatschow hatte ohne Zweifel das System reformieren, aber nicht abschaffen wollen. Seine Gegner kamen aus verschiedenen Lagern:
Die Kommunisten alter Prägung, die keine Reform wollten. Die Militärs, die ihre einstige Größe beschmutzt sahen.
Die Nationalisten, die den Vielvölkerstaat auflösen wollten.
Die Radikalreformer, die eine politische und wirtschaftliche Schocktherapie anstrebten.
Was für die einen wie ein Wunder an Veränderung wirkte, war den anderen nicht genug und den Dritten wiederum zu viel Reform. Über all die Jahre verfolgte ein Mann in Deutschland die Perestrojka mit größter innerer Bewegung: Wolfgang Leonhard. Er war in Moskau aufgewachsen und politisch erzogen, um später die DDR mit aufzubauen. Dabei wurde Wolfgang Leonhard zu einem der prominentesten Dissidenten. Sein Buch „Die Revolution entlässt ihre Kinder“ war eine der ersten Abrechnungen mit dem Stalinismus. Die Sowjetunion hatte Leonhard jahrzehntelang nicht mehr betreten dürfen. Doch endlich war es soweit. Unter Gorbatschow durfte Wolfgang Leonhard, dem ich seit Beginn meiner Zeit als Osteuropakorrespondent viele wichtige Gespräche verdanke, wieder nach Moskau. Wir trafen uns damals zufällig in der Kantine vom staatlichen Presseamt und mehr nebenbei nahm ich auf, was dem zurückgekehrten Dissidenten damals in Moskau durch den Kopf ging. Bemerkungen zum politischen Umbruch ebenso wie zu seiner Person: