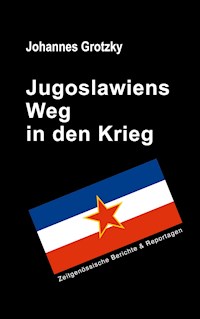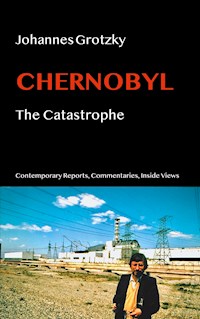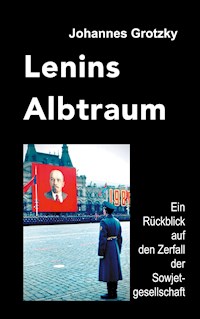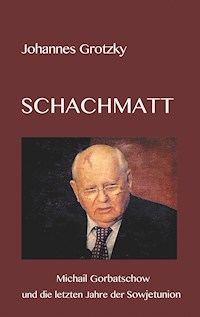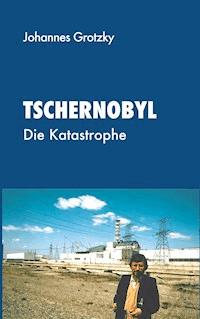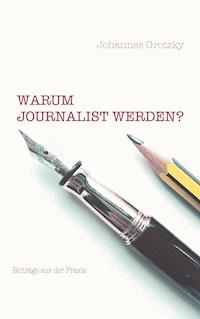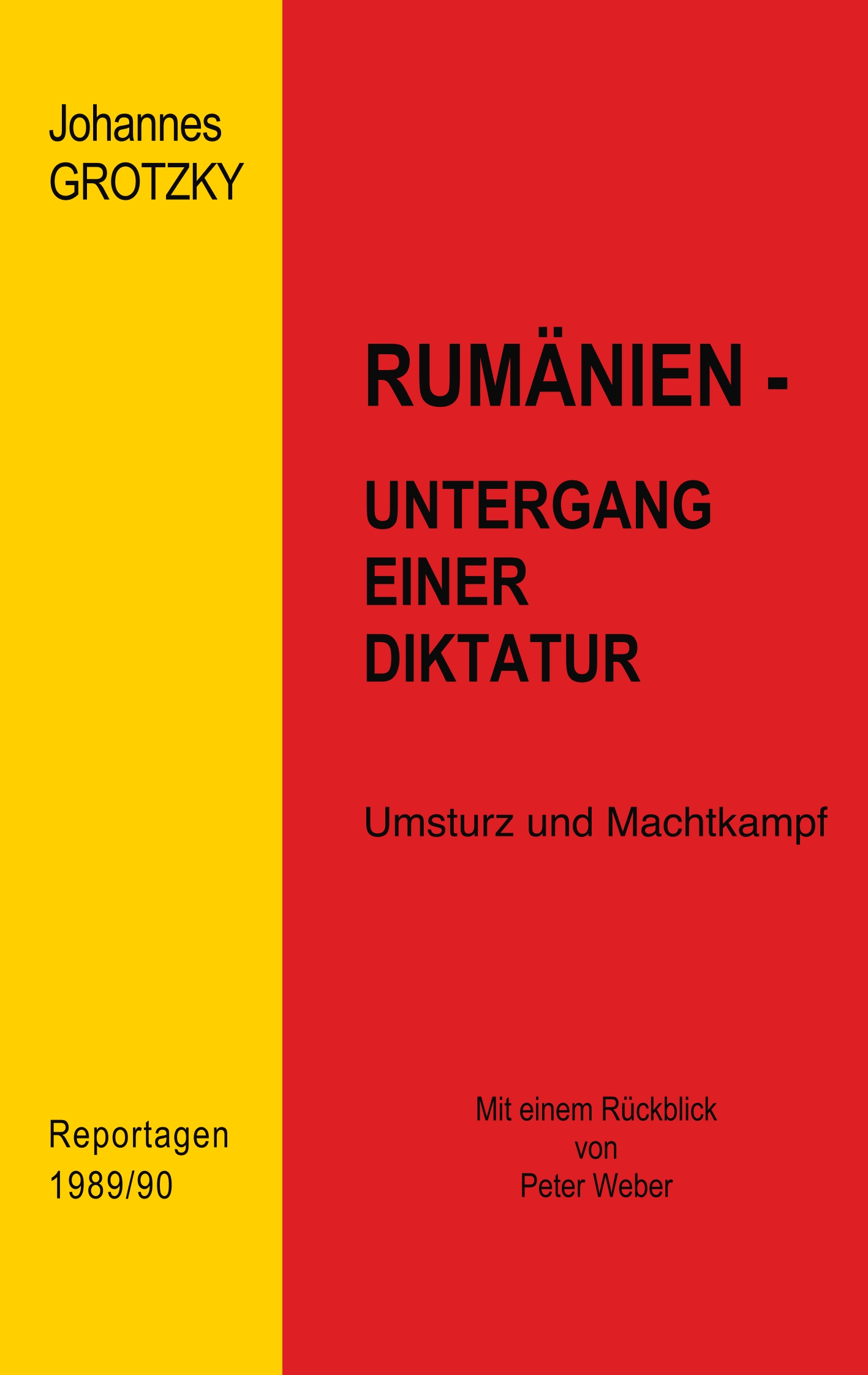
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am 25. Dezember 1989 wurden der kommunistische Staats- und Parteichef Rumäniens Nicolae Ceausescu und seine Ehefrau Elena in Bukarest erschossen. Drei Tage vorher waren beide vor einer aufgebrachten Menschenmenge in Bukarest während einer geplanten Jubelveranstaltung geflüchtet, dann nach einer aufregenden Jagd durch Rumänien vom Militär festgenommen, von einem Militärtribunal zum Tode verurteilt und sofort hingerichtet worden. Es war die blutigste Abrechnung mit einem kommunistischen Herrscher in Osteuropa. Landesweite Aufstände gegen die Diktatur und den Personenkult von Ceausescu hatten den Umsturz eingeleitet. Doch bis heute sind die Hintergründe dieser Entwicklung unklar geblieben. War es ein Putsch, ein Volksaufstand? Wer hat dabei die Fäden gezogen? Welche Rolle spielte das Militär, welche Rolle der Geheimdienst Securitate? In zeitgeschichtlichen Reportagen werden hier der Niedergang des Regimes, das anschließende Ringen um die Macht und die Neukonstituierung einer demokratischen Ordnung durch erste freie Wahlen in Rumänien nachgezeichnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Johannes GROTZKY, Dr. phil. (*1949)
Studium der Slawistik, Balkanologie und Geschichte Ost- und Südosteuropas in München und Zagreb. 1983-1989 ARD-Korrespondent in Moskau. 1989-1994 Balkankorrespondent und Leiter des ARD-Hörfunkstudios Südosteuropa in Wien. 2002-2014 Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks. Honorarprofessor für Osteuropawissenschaften, Kultur und Medien an der Universität Bamberg.
VORWEG EIN BLICK ZURÜCK
EINSTIMMUNG
Ein Land isoliert sich
DER LETZTE PARTEITAG
Orchestrierte Ovationen
EMPÖRUNG ÜBER DEN WESTEN
Rumänien fühlt sich schlecht behandelt
DER STURZ DES DIKTATORS
Ein politisch-journalistisches Tagebuch
Montag, 18. Dezember 1989
Dienstag, 19. Dezember 1989
Mittwoch/Donnerstag, 20./21. Dezember 1989
Freitag, 22. Dezember 1989
Freitag, 22. Dezember 1989, abends
Samstag, 23. Dezember 1989
Sonntag, 24. Dezember 1989
Montag, 25. Dezember 1989, morgens
Montag, 25. Dezember 1989, mittags
Montag, 25. Dezember 1989, abends
Dienstag, 26. Dezember 1989
Mittwoch, 27. Dezember 1989
Donnerstag, 28. Dezember 1989
Freitag, 29. Dezember 1989
Freitag, 29.12.1989, abends
INNBEGRIFF DES SCHRECKENS
Die Kampftruppen der Securitate
SONDERGERICHTE
Schnellverfahren gegen die Securitate
PROBELAUF
Auf der Suche nach einem neuen Modell
TRAUER UM DIE TOTEN
Kirchliche Selbstkritik
HOFFNUNGEN UND ZWEIFEL
Aufräumen nach dem Aufstand
POLITISCHER WITZ ALS VERGANGENHEITSBEWÄLTIGUNG
Besuch beim rumänischen Radio
DER PREIS DER ENTSCHULDUNG
Rumäniens Wirtschaft nach der Wende
ERNEUTE REVOLTE
Zielscheibe Iliescu
AUFARBEITUNG
Prozesse gegen die Täter
NATIONALITÄTENKONFLIKT
Ungarisch-rumänischer Schlagabtausch
ERSTE FREIE WAHLEN
Die Macht des Umsturzes etabliert sich
EINE VATERFIGUR FÜR RUMÄNIEN
Warum der Reformkommunist Iliescu an der Macht bleibt
PUTSCH ODER VOLKSAUFSTAND?
Fragen zur unvollendeten Revolution
ERSTER JAHRESTAG DER REVOLUTION
Trauer und offene Fragen
RUMÄNIEN HEUTE
Ein Ausblick
DER VOLKSAUFSTAND IN TEMESWAR IN BRIEFZEUGNISSEN
Ein Rückblick
Von Peter Weber
VORWEG EIN BLICK ZURÜCK
Im Sommer 1968, also vor mehr als 50 Jahren, bereiste ich zum ersten Mal als junger Zeitungshospitant Rumänien. Mit jugendlicher Unbefangenheit fotografierte ich, was mir vor die Linse kam, suchte Kontakt zu jedem, der mit mir reden wollte oder konnte. Vom Presseamt bekam ich für einige Tage sogar einen Fahrer, einen Dolmetscher und eine riesige Tschaika-Limousine sowjetischer Bauart gestellt, damit man mich entlang der Schwarzmeer-Küste zu Neubauprojekten von riesigen Hotelanlagen brachte, die vor allem für westliche Urlauber gebaut wurden. Die so genannten „Neckermänner“ kamen zu Billigurlauben nach Rumänien und gleichzeitig entwickelten sich über diese Schiene Familientreffen von Ost- und Westdeutschen an der rumänischen Schwarzmeerküste, da auch DDR-Bürger problemlos dorthin reisen durften. Meine offiziellen Begleiter von rumänischer Seite warben sogar eigens damit, dass man mit diesem Urlaub ein wenig die deutsche Teilung überwinden könne.
Es war die liberale Phase von Staats- und Parteichef Nicolae Ceauşescu. Auch im Westen wurde er geschätzt, weil er kein sklavischer Vasall Moskaus war, keine sowjetischen Truppen in Rumänien duldete, viele Jahre die Migration russischer Juden über Rumänien nach Israel ermöglichte und sich nicht an der militärischen Niederschlagung des Prager Frühlings im Herbst 1968 beteiligte.
Nicht zuletzt hatte Rumänien als erster Ostblockstaat 1967 diplomatische Beziehungen mit der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen und nach dem Sechs-Tage-Krieg im Sommer desselben Jahres als einziges Ostblock-Land nicht die diplomatischen Beziehungen zu Israel abgebrochen.
Schließlich erhielt Ceauşescu 1971 den höchsten Orden, den die Bundesrepublik einem ausländischen Staatsoberhaupt verleihen konnte, die „Sonderstufe des Großkreuzes“.
Meine ersten Reportagen über dieses Land waren dementsprechend wohlwollend, fast hoffnungsvoll mit dem Tenor, Rumänien könne der Baustein für eine Brücke zwischen Ost und West werden.
Gut 20 Jahre später kam ich als Balkankorrespondent zurück in dieses Land, dessen Lage sich dramatisch gewandelt hatte. Aus dem Hoffnungsträger Ceauşescu war – vermutlich unter dem Einfluss seiner Reisen nach China und Nordkorea und unter dem Einfluss seiner Frau Elena – ein größenwahnsinniger, despotischer Herrscher geworden.
Mein erster Visumsantrag für meine Arbeit als Journalist in Rumänien blieb zunächst unbeantwortet, doch Monate später, zum bevorstehenden XIV. Parteitag der Kommunistischen Partei Rumäniens, wurde mir die Einreise erlaubt, nachdem ich zuvor wohlmeinende Gesinnungsgespräche mit einem Botschaftsrat Manea in der rumänischen Botschaft in Wien verbracht habe.
Als ich endlich im November 1989 wieder nach Bukarest reisen durfte, herrschte am Flughafen große Nervosität. Angesichts der politischen Umbrüche in den sozialistischen Nachbarländern war der Ansturm ausländischer Journalisten auf den rumänischen Parteitag besonders groß und löste entsprechende, umfangreiche Kontrollen aus. Jedes bedruckte Papier, das wir mit uns führten, rief das Misstrauen der rumänischen Zollbeamten auf den Plan. Wie bei vielen anderen Kolleginnen und Kollegen wurden auch von mir Arbeitsunterlagen beschlagnahmt, die aus für mich unerfindlichen Gründen nicht nach Rumänien hätten eingeführt werden dürfen. Unter den konfiszierten Texten waren auch offizielle Artikel, die mir von der rumänischen Botschaft zur Vorbereitung auf die Reise mitgegeben worden waren. Natürlich war die Beschlagnahme von journalistischem Arbeitsmaterial ein Verstoß gegen die KSZE-Schlussakte von Helsinki. Aber Proteste nutzten nichts. Später entschuldigte sich ein Sprecher des Außenministeriums für den Übereifer der Zöllner mit der Begründung: Bei einer französischen Journalistin seien angeblich umstürzlerische Aufrufe gefunden worden. Doch auch der Beamte des Außenministeriums wies jeden Protest wegen der Verletzung der KSZE-Akte zurück, die freie journalistische Arbeit ermöglichen soll. Und zwar mit einem sehr interessanten Argument: Dieses internationale Übereinkommen, so der Beamte, sei durch die innerrumänischen Gesetze eingeschränkt. Und diese erlaubten nun einmal die Beschlagnahmung von Arbeitsunterlagen ausländischer Journalisten.
Natürlich wurden wir alle im damals noch neuen Hotel InterContinental untergebracht. Ich erhielt die Zusage, dass mir selbstverständlich eine Telefonleitung nach Westdeutschland zur Verfügung gestellt würde, damit ich meine Radiobeiträge für die ARD direkt aus Bukarest abschicken könne.
Schon am nächsten Tag übermittelte ich für die Morgenmagazine gegen sechs Uhr früh einen Beitrag über die inzwischen bedrückende Lage in Rumänien, über Nahrungsmittelknappheit, über die Verordnung, die Zentralheizungen staatlicher Wohnungen im Winter auf 15 Grad Celsius zu drosseln und über den allerorten sichtbaren Personenkult um Nicolae Ceauşescu. Für deutsche Hörer konnte ich besonders eindrucksvoll diesen Personenkult anhand einer Tageszeitung der deutschen Minderheit in Rumänien belegen, Neuer Weg, die wortgleich die wichtigsten politischen Lobeshymnen auf Ceauşescu aus der rumänischsprachigen Staatspresse veröffentlichte.
Mit einem Wort: Mein erster Bericht aus Rumänien war nicht mehr so wohlwollend, wie meine Artikel zwei Jahrzehnte zuvor.
Ich hatte allerdings unterschätzt, mit welcher Windeseile mich der lange Arm der staatlichen Zensur in Rumänien erwischen sollte. Noch bevor ich zum Frühstück ging, klingelte das Telefon. In vollendetem Deutsch rief mich ein Vertreter des Außenministeriums an, dessen Name sich lautmalerisch als „Girbia“ oder „Garbia“ bei mir eingeprägt hatte. In einem kommandohaften Ton befahl er mir, mich unverzüglich an der Rezeption des Hotels zu melden. Ich solle am besten gleich mit meinem Gepäck herunterkommen.
Ohne Gepäck fuhr ich den Lift herunter und als ich unten ausstieg, schoss der besagte Herr von relativ bescheidenem Wuchs direkt auf mich zu und teilte mir mit, ich müsse als Feind Rumäniens das Land sofort verlassen. Mit meinem ersten Bericht hätte ich die Gastfreundschaft verwirkt und deshalb dürfe ich nicht bleiben. Und dann folgte das Urteil: „Sie werden nie wieder ein Einreisevisum nach Rumänien bekommen.“
In meiner Not griff ich nach einer halben Lüge und behauptete, der ARD sei aber im Rahmen des Parteitages ein Exklusiv-Interview von Staats- und Parteichef Ceauşescu zugesagt worden. Und da ich – wie mein Ausweis und meine Akkreditierung bewiesen – für die ARD arbeite, gelte diese Zusage auch für mich. Er möge also seine Anweisung erst mit dem Büro des Präsidenten abgleichen, sonst drohe nicht mir, sondern ihm Ungemach.
Die notwendige Dreistigkeit im Umgang mit autoritären Staatsvertretern hatte ich mir in den vorangegangenen sechs Jahren als Korrespondent in der Sowjetunion angeeignet, wo ich gelernt habe, dass man immer nur eine noch höhere Institution gegen einen subalternen Staatsdiener ausspielen muss, um ihn zu verunsichern. Allerdings hatte ich an diesem Morgen in Bukarest guten Grund zu meinem dreisten Auftritt, denn mein damaliger Fernsehkollege von der ARD, Dagobert Lindlau, hatte tatsächlich ein Interview mit Ceauşescu beantragt. Da er beste Kontakte in die oberste Führungsspitze aufgebaut hatte, galt er für die unteren Chargen als unangreifbar. Also konnte ich mich hinter seinem Namen „verstecken“, was ich ihm am selben Tag natürlich gebeichtet habe. Seine Reaktion war sehr locker: Wenn es erfolgreich war, so meinte Lindlau, dann sei das gerechtfertigt. Und wir gingen einen trinken.
Jedenfalls wurde ich nicht ausgewiesen, durfte den Parteitag über in Bukarest bleiben, bekam dabei einen Platz in der Ehrenloge, in der ich mir die mehrstündige Rede von Ceauşescu in deutscher Übersetzung und die skandierenden Lobeshymnen der Genossinnen und Genossen anhören durfte.
Es sollte der letzte Parteitag des rumänischen Diktators sein. Gut fünf Wochen später war er aus seinem Amt vertrieben, zum Tode verurteilt und vor laufenden Kameras – gemeinsam mit seiner Frau – hingerichtet worden.
Der aufgebrachte Vertreter des Außenministeriums, der mich ausweisen wollte, begegnete mir Monate danach in Berlin wieder. Auf einem Podium mit dem damaligen Außenminister Genscher. Nun in der Rolle eines mutigen Vorkämpfers der Revolution für die Demokratie und gegen die Diktatur von Ceauşescu!
Der letzte Besuch beim großen Bruder in Moskau Neuer Weg, 06.12.1989
In Moskau hatte Michail Gorbatschow durch seine Politik von Glasnost und Perestrojka Reformpolitik im Ostblock gefördert. Ceauşescu hingegen blieb seiner sozialistischen Linie treu und zeigte sich auch bei seinem letzten Treffen mit Gorbatschow am 05. Dezember 1989 eher abweisend. Die rumänische Presse sprach dabei von „aktuellen Probleme des sozialistischen Aufbaus“, von einem „offenen Meinungsaustausch“ und einer „kameradschaftlichen Atmosphäre“.
Früher hätte es stattdessen geheißen „völlige Übereinstimmung“ und „freundschaftliche Atmosphäre“. Die Isolierung Rumänien wurde damit öffentlich.
Neuer Weg 06.12.1989
Allerdings konnte Ceauşescu bei diesem letzten Moskau-Besuch seines Lebens noch einen Trumpf ausspielen. Voller Genugtuung ließ er in Rumänien einen Text veröffentlich, in denen „die Führer Bulgariens, der Deutschen Demokratischen Republik, Polens, Ungarns und der Sowjetunion“ erklären, „dass der im Juni 1968 erfolgte Einsatz der Truppen ihrer Staaten in der Tschechoslowakischen SR eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der souveränen Tschechoslowakei dargestellt hat und zu verurteilen ist.“
Das war Ceauşescu´s letzte Ohrfeige für seine bisherigen Verbündeten. Denn Rumänien hatte sich 1968 geweigert, an der Invasion der Tschechoslowakei teilzunehmen.
Immer an seiner Seite Ehefrau Elena, praktisch die Mitregentin. Sie war so bekannt, dass die Zeitungen nicht einmal mehr ihren Namen in der Bildunterschrift oder im Titel nennen mussten. (16.12.1989)
In dieser Atmosphäre zunehmender Isolierung im eigenen sozialistischen Lager machte sich Ceauşescu mit seiner Gattin Elena auf den Weg in die Iran. Es sollte die letzte Dienstreise seines Lebens werden.
Auf zur letzten Dienstreise (19.12.1989)
Unterdessen ließ mit pompösen Ergebenheitsadressen den XIV. – und wie sich zeigen sollte – letzten Parteitag der Rumänischen Kommunistischen Partei vorbereiten.
Mit der Vorberichterstattung zum Parteitag und dem Parteitag selbst setzt nun die Rückblende in diesem Buch ein. Es sind Texte meiner Berichterstattung für die Radiosender der ARD, die den Verlauf und den Versuch der Bewältigung der Revolution gegen Ceauşescu aus journalistischer Sicht nacherleben lassen.
Außerdem führt die Rückblende noch weiter in das Jahr 1990 hinein, als es um die Neukonstituierung der Macht und die Abrechnung mit dem Regime ging. Bis heute herrscht freilich keine Klarheit darüber, wer die entscheidenden Kräfte dieser Revolution waren. Die Rolle des Geheimdienstes Securitate, die Rolle der Armee, die Rolle einzelner ehemaliger Parteigänger lassen sich nicht schlüssig zuordnen. Die Theorien reichen von einem aus Moskau ferngesteuerten Putsch bis zu einer spontanen Volkserhebung, von der auch die Institutionen des Staates mitgerissen wurden.
Der Nachfolger von Nicolae Ceauşescu im Amt des Staatspräsidenten, Ion Iliescu, übernahm noch während der Revolution eine führende Rolle im Machtkampf, konnte sich dann bei den ersten freien Wahlen behaupten und kehrte später noch einmal in das Amt des Staatspräsidenten zurück. Andererseits gab sich Iliescu bei allen journalistischen Begegnungen recht kryptisch über Verlauf und Drahtzieher der Revolution und verteidigte die Armee, obwohl sie teilweise gegen Demonstranten vorgegangen war.
Auch die Rolle der Securitate, des gefürchteten Geheimdienstes, wurde immer wieder neu bewertet, bis hin zu der Vermutung, dass letztlich der Geheimdienst auf Seiten der Revolution stand, obwohl viele Kampfeinheiten der Securitate für blutige Übergriffe verantwortlich gemacht wurden. Auch meine Reportagen folgen noch dem Narrativ von der „bösen Securitate“, die eher gegen als für die Bevölkerung gekämpft hat und Teil des Unterdrückungsapparates war. Durch die Übernahme zahlreicher Securitate-Mitarbeiter nach der Erhebung gegen die Diktatur wurde das Schreckensbild des brutalen Geheimdienstes wieder etwas entschärft.
2018 wurde Iliescu sogar angeklagt, weil er angeblich während des Aufstandes gegen Ceauşescu den Tod von über eintausend Menschen mitverantwortet haben soll. Allerdings steht der Strafprozess darüber noch aus. Und es ist unwahrscheinlich, dass Iliescu, Jahrgang 1930, das Ende eines solchen Prozesses noch erleben wird.
Die journalistischen Beobachtungen, die in diesem Buch1 zusammengetragen sind, umfassen
- die Zeit des letzten Parteitages der rumänischen Kommunisten unter Nicolae Ceauşescu, seinen Sturz und seine Hinrichtung,
- die Verunsicherung des Landes durch die unklaren Rollen von Geheimdienst und Militär,
- die schnelle Konstituierung des Rats der Front zur Nationalen Rettung unter Leitung des Altkommunisten Ion Iliescu,
- den anschließenden Kampf um die Konsolidierung der Macht und die ersten Gerichtsprozesse gegen die Anhänger des Diktators,
- die aufbrechenden nationalen Konflikte mit der ungarischen Minderheit bis zu den ersten freien Wahlen im Mai 1990.
Dem folgen Überlegungen zur unvollendeten Revolution, von der bis heute nicht eindeutig geklärt ist, ob es sich um einen Volksaufstand oder um einen inszenierten Putsch gehandelt hat.
Ein aktueller Beitrag zum heutigen Rumänien schließt das diesen Teil des Buches ab, nachdem das Land – trotz zahlreicher innenpolitischer Krisen und Skandale – inzwischen als Mitglied der NATO (ab 2004) und der Europäischen Union (ab 2007) seinen neuen Platz in der internationalen Gemeinschaft gefunden hat.
Die erweiterte Neuauflage ist ergänzt von einem zeitgeschichtlichen Rückblick auf die Ereignisse der Revolution in Temeswar, den Peter Weber anhand von Brief- und Zeitungsdokumenten über seine persönlichen Beziehungen nach Temeswar zusammengestellt hat. Ich danke Peter Weber, dass er seinen Beitrag für die Neuauflage dieses Buches zur Verfügung gestellt hat.
Journalisten sind immer auf die Hilfe von sach- und sprachkundigen Fachleuten angewiesen. In autoritären Staaten bedurfte es eines besonderen Vertrauensverhältnisses, um eine solche Zusammenarbeit aufzubauen. Mein politischer und sprachlicher Wegweiser durch Rumänien war und blieb Herbert Gruenwald, dessen Bildung, Vielsprachigkeit, Belastungsfähigkeit und Engagement ich mit größter Dankbarkeit für meine Korrespondentenarbeit nutzen durfte. Noch dreißig Jahre nach dem Umsturz ist Herbert Gruenwald in Bukarest für die ARD im Einsatz. Ohne ihn wäre manche Authentizität des Erlebten nicht denkbar gewesen. Für mögliche Fehleinschätzungen und Fehler in meinen Texten trage ich jedoch ganz allein die Verantwortung.
München
November 2019/März 2020
1 Das Kapitel „Der Sturz des Diktators“ ist entnommen aus J. Grotzky, Fremde Nachbarn. Ost- und Südosteuropa am Ende des 20. Jahrhunderts. Norderstedt 22012.
EINSTIMMUNG
Ein Land isoliert sich
Starker Beifall und Hochrufe. Ein Sprechchor skandiert: „Ceauşescu, Rumänien – unsere Achtung, unser Stolz!“ - „Ceauşescu, Heldentum – Rumänien, Kommunismus!“
Was sich wie eine Regieanweisung liest, entstammt dem offiziellen Zeitungsbericht über eine Stadtparteikonferenz in Bukarest. Staats- und Parteichef Ceauşescu betreibt Wahlkampf auf Rumänisch. Mit einer Rede präsentiert er sich als Kandidat für das Amt des Generalsekretärs, das er bereits seit 24 Jahren bekleidet. Was der Parteitag der rumänischen Kommunisten zu beschließen hat, wird heute schon als Tatsache in den Schlagzeilen der Staatspresse gefeiert. Zitat: „Die Wiederwahl des Genossen Nicolae Ceauşescu in das hohe Amt des Generalsekretärs der Partei – eine historische Entscheidung des ganzen Volkes.“