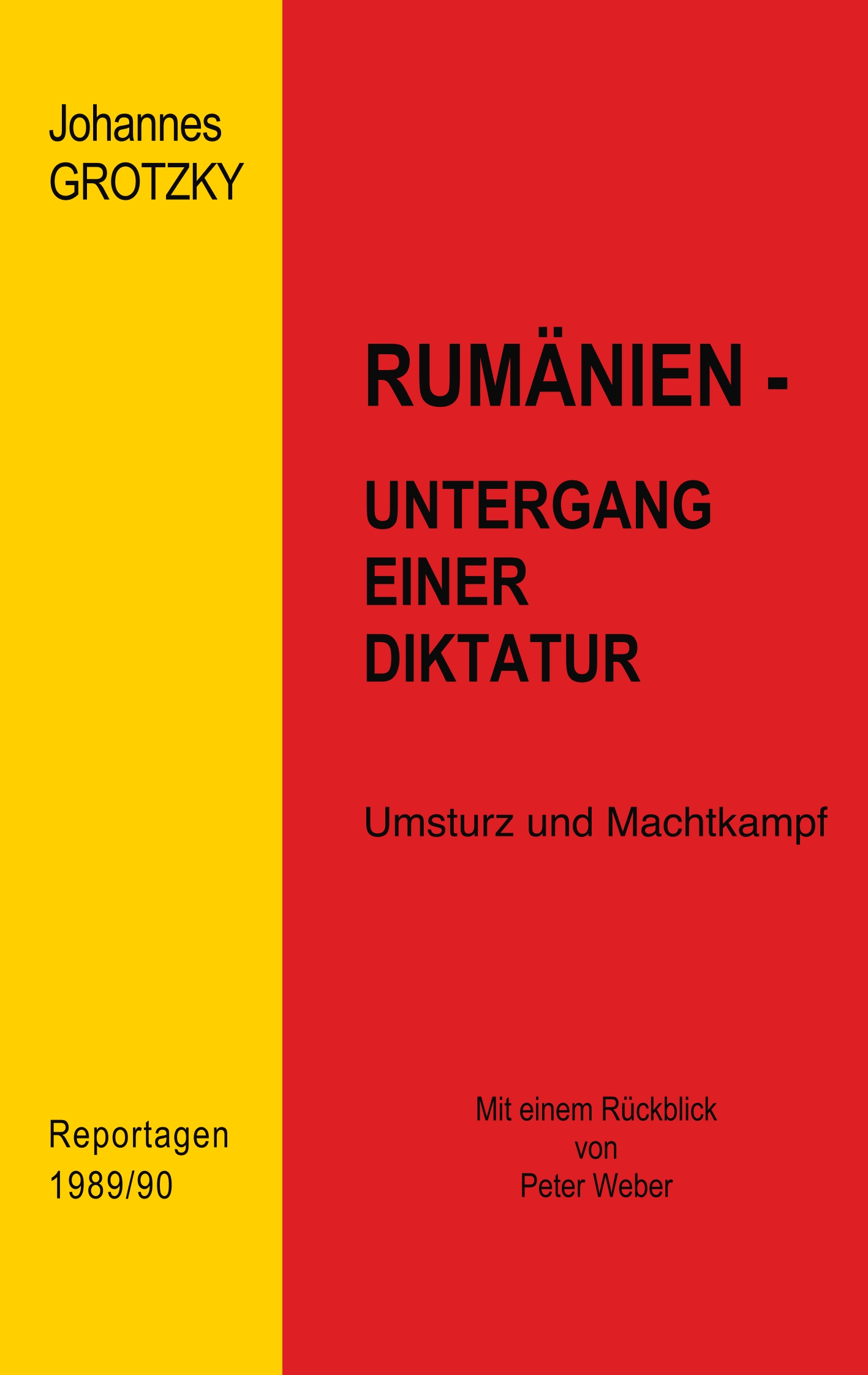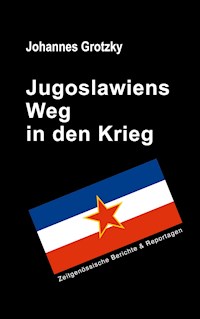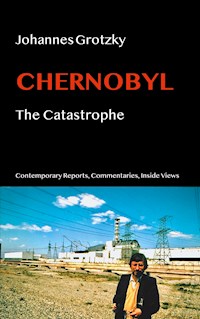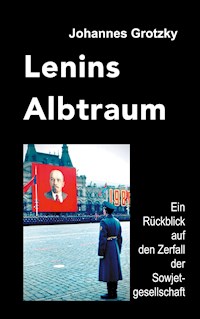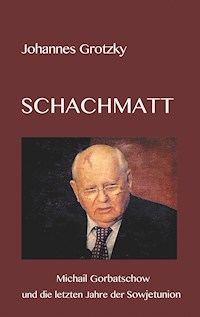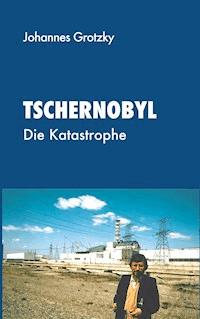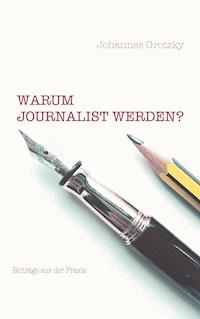
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Umfragen in Deutschland erfassen regelmäßig, welche Berufe die höchste Akzeptanz haben. Das sind Feuerwehrleute, Sanitäter, Pflegepersonal im Krankenhaus, Piloten, Ärzte, Apotheker, Polizisten. Und wer steht ganz am unteren Ende der Skala mit dem geringsten Vertrauen in der Bevölkerung? Journalisten und Politiker. Soll man da wirklich noch Journalist werden? Ja, man soll, weil guter Journalismus zu objektiver Information verhilft, zur pluralen Meinungsbildung beiträgt und ein Baustein für eine funktionierende Demokratie ist. Die Beiträge in diesem Buch beschreiben nicht den Weg, wie man Journalist oder Journalistin wird. Es geht vielmehr um die ethischen Grundlagen und die Medienkompetenz journalistischer Arbeit, um den verantwortlichen Umgang mit Fakten und um die Frage, wie wir informiert werden. Die sozialen Netzwerke werden auf den Begriff "sozial" hinterfragt und Konfliktfälle für Journalistinnen und Journalisten werden erörtert bis hin zu dem Problem des "embedded journalism". Ein Blick über die Grenzen nach Osteuropa zum Medienwandel und zur Entstehung unseres Medienbildes von Russland schließen das Buch ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Johannes GROTZKY, Dr. phil. (*1949)
Studium der Slavistik, Balkanologie und Geschichte Ost- und Südosteuropas in München und Zagreb. Weitere Studienaufenthalte in Belgrad, Sarajevo und Skopje. 1983-1994 ARD-Korrespondent in Moskau und Wien (Südosteuropa). Anschließend Chefkorrespondent, Chefredakteur sowie 2002-2014 Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks.
Honorarprofessor für Osteuropawissenschaften, Kultur und Medien an der Universität Bamberg.
Inhalt
Halb im Scherz und halb im Ernst
Warum Journalist werden?
Orientierung im Journalismus
Wie werden wir informiert?
An der Schwelle zur Praxis im Journalismus
Medienkompetenz in der Journalistik
Journalistische Ethik - Journalistische Standards
Wie sozial sind soziale Netzwerke?
Journalismus und Krisenberichterstattung
Embedded Journalism
Selektive Authentizität
Falsche Fraternisierung
Verzerrte Kameraperspektive
Außerhalb des Geschehens bleiben
Eifersucht und Konkurrenzkampf
Kriegsreporter-Tourismus
Umgang mit der Zensur
Gefahr des Missbrauchs
Journalismus im "Kulturradio"
Archive – Gedächtnis des Journalismus
Ein Blick in die Praxis:
Zum Russland-Bild in deutschen Medien
Ein Blick über die Grenzen:
Medienwandel in Osteuropa (Englisch)
Zu guter Letzt: In eigener Sache
Quellennachweis
Halb im Scherz und halb im Ernst
Halb im Scherz und halb im Ernst warne ich immer davor, Journalismus an der Universität zu studieren. Man kann zwar studieren, wie man publizistische und journalistische Arbeit bewertet. Man kann den Unterscheid zwischen Bericht, Kommentar, Reportage, Feature, Glosse und anderen Darstellungsformen erlernen. Auch über Krisen- und Kriegsberichterstattung kann man an der Universität Seminare besuchen. Doch der wirkliche Journalismus ist von vielen Faktoren bestimmt, die nicht an der Universität unterrichtet werden können.
Das gilt zunächst für den Zeitfaktor.
Journalistische Arbeit steht vor allem im aktuellen Bereich unter einem enormen Zeitdruck. Oft sind nur wenige Minuten Zeit, um eine Meldung zu schreiben. Die aktuellen Ergebnisse einer Pressekonferenz werden vor Ort weiterverarbeitet. Eine das Ereignis begleitende Berichterstattung ist immer etwas Unfertiges. Mit fortlaufender Entwicklung muss die Darstellung nachjustiert, mit neuen Fakten und Erkenntnissen erweitert werden. Das gilt um so mehr im Zeitalter des Internets.
Der nächste Punkt ist der menschliche Faktor.
Journalismus ist Kommunikation mit Informanten und dem Publikum. Der Erfolg bei einem Interview oder das Recherchegespräch hängen davon ab, ob ich einen emotionalen Zugang zu den Gesprächspartnern finde. Hinzu kommt bei Einsätzen im Ausland, dass man die Fähigkeit erwerben muss, mit Hilfe eines Dolmetschers ein Vertrauensverhältnis zu seinen Informanten aufzubauen. Denn nicht jeder Auslandskorrespondent, nicht jede Auslandskorrespondentin beherrscht alle Sprachen, die in den meist großen Einzugsbereichen ihrer Korrespondentenplätze gesprochen werden. Eine gründliche inhaltliche Vorbereitung ist ohnehin selbstverständlich. Eine solche Gründlichkeit wird durchaus im wissenschaftlichen Unterricht vermittelt. Aber der Umgang mit Menschen lässt sich nicht durch ein Lehrbuch vermitteln.
Weitere Faktoren sind Belastbarkeit, Distanz zum Geschehen und Konzentration in angespannten Situationen. Wer in einem Krieg als Reporter oder Reporterin eingesetzt ist, muss auch das Grauen mit der Distanz des Beobachters schildern können, ohne in einen emotionalen Aufschrei oder in persönliches Engagement zu verfallen. Hinzu kommen die Belastung durch Dauereinsätze und – im Ausland – oft mehrstündige Zeitverschiebungen. Wer live aus fernen Ländern berichten muss, verzichtet auf einen Teil seines Privatlebens, um tagsüber dort zu recherchieren und darüber nachts – in Deutschland also am Tag – zu berichten.
Trotz allem ist jedoch jedes Fachstudium eine sehr gute Voraussetzung für die journalistische Arbeit. Je mehr Fremdsprachen, desto besser. Das ist in einem Kommunikationsberuf selbstredend. Aber egal ob Wirtschaft oder Recht, ob Geschichte oder Philologie, ob Naturwissenschaften oder Medizin – mit jeder Fachrichtung lässt sich erfolgreich ein Weg in den Journalismus finden, auch wenn letztlich jeder Journalist auch Generalist ist, der sich schnell in völlig neue Sachgebiete einarbeiten muss.
In den Bereich von Wahrheit und Wahrhaftigkeit gehört die Unterscheidung zwischen geprüften Fakten und den darauf basierenden Schlussfolgerungen, aber auch der Mut, sein Nicht-Wissen zu erkennen und einzugestehen. Auch der Journalist hat das Recht und die Pflicht zu sagen: „Das weiß ich nicht.“ Oder auch: „Diese oder jene Behauptungen lassen sich nicht belegen.“ Und der Journalist hat auch die Pflicht, seine Quellen zu nennen, soweit er damit nicht seine Informanten gefährdet.
Im Wesentlichen sind alle diese Aspekte des journalistischen Handwerks auch Gegenstand einer Arbeitsethik, über die sich der Journalist selbst immer wieder einmal Rechenschaft ablegen sollte. Für Berufseinsteiger ist es daher immer sinnvoll, sich mit älteren Kolleginnen und Kollegen zu beraten. Die Erfahrung in der Praxis ist unbezahlbar, findet sich in keinem Lehrbuch und hält sicher manche Überraschungen und auch Enttäuschungen bereit. Im Rückblick fällt es leichter, jüngeren Kollegen gegenüber Fehler einzugestehen. Zwei solche Fehler kann ich hier zum Besten geben. Einer davon ist der falsche Umgang mit der Geographie:
Als junger Korrespondent begleitete ich in Moskau zur Sowjetzeit eine große Demonstration. Mit Harmonika, Trommeln und Trompeten marschierten die Demonstranten zu markigen Melodien durch die Stadt. Sie trugen Plakate mit der Aufschrift: „Gegen Atomraketen in Ost und West“. Ich interpretierte dies sofort als ein Bündnis mit den westlichen Gegnern von Atomraketen und war überrascht, dass in der damaligen Sowjetunion auch offen gegen Atomraketen im eigenen Land demonstriert werden durfte. In diesem Sinn begann ich meine Reportage in das Mikrofon zu sprechen, damit ich als Radioreporter später mit einem authentischen O-Ton von der Demonstration die Sendung beginnen konnte. Dann begann ich mit den Interviews. Was war der Anlass für die Demonstration? Wer hat sie organisiert? Sind die Demonstranten freiwillig hier oder von ihrem Arbeitsplatz delegiert worden? Auf alles bekam ich freimütige Antworten. Dann die Frage, warum sie gegen Atomraketen im eigenen Land demonstrierten, während die Politik doch auf atomare Abschreckung setze. Unverständnis bei meinen Interviewpartnern. Was ich denn damit meine, entgegneten sie. Ich zeigte auf die großen Plakate mit der Losung: „Gegen Atomraketen ist Ost und West“. Das beträfe doch auch das eigene Land, also die Sowjetunion, meinte ich. Doch damit löste ich nur Lachen aus. Nein, hieß es, damit sei doch nicht die Sowjetunion gemeint. Es ginge beim Westen um die aggressive Nato und beim Osten um das aggressive Japan. Die Sowjetunion sei doch nur das Opfer von beiden und läge in der Mitte zwischen Ost und West.
Mein Fehler war offenkundig. Ich hatte meine politische Geographie von Deutschland mit nach Russland genommen und meinte, die Menschen wähnten sich im Osten. Stattdessen sahen sie sich als das bedrohte Zentrum zwischen zwei anderen Welten.
Wer nach China kommt, wird dasselbe erleben: Nämlich das Bewusstsein, man befinde sich im Zentrum und nicht an einer Peripherie. Nicht unähnlich war das Verhalten meiner italienischen Nachbarn in München, denen ich sagte, ich fahre nach Südtirol. Nein, meinten Sie, sie kämen aus dem Süden, aus Sizilien. Ich dagegen würde nach Norditalien fahren.
Über Jahrzehnte haben wir ein Bild von Osteuropa gepflegt und meinten damit politisch den Ostblock einschließlich unserer Nachbarn Polen, Ungarn und der damaligen Tschechoslowakei. Doch auch zu sozialistischen Zeiten stand in polnischen Schulbüchen: „Polen liegt im Herzen Europas“. Und als der tschechische Schriftsteller und Bürgerrechtler Pavel Kohout 1978 von Prag nach Wien kam, wurde er bei einer Vortragsveranstaltung angekündigt als ein „Kronzeuge aus dem Osten Europas“. Kohout korrigierte diese Darstellung mit dem Worten: „Ich komme aus Prag. Und Prag liegt westlich von Wien.“ Auch hier galt, dass wir zu schnell eine politische Geographie auf die wirkliche Geographie projizieren. Das erzeugt Fehlsichten und Fehlurteile, die sich nicht nur publizistisch, sondern auch politisch auswirken können.
Ein anderer (und hier mein zweiter) Fehler ist das mangelnde Vorstellungsvermögen von völlig überraschenden politischen Positionswechseln. So schrieb ich einen flammenden Kommentar darüber, dass der damalige deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl und der sowjetische Parteichef Gorbatschow vermutlich nie mehr miteinander würden auskommen können. Der Anlass war ein kurzes Interview im Herbst 1986 von Helmut Kohl, in dem er über Gorbatschow sagte: "Er ist ein moderner kommunistischer Führer, der sich auf Public Relations versteht. Goebbels, einer von jenen, die für die Verbrechen der Hitler-Ära verantwortlich waren, war auch ein Experte in Public Relations."1
Für die Sowjetunion war jeder Vergleich mit der Nazizeit der größte vorstellbare Tabubruch, weil das Land die schlimmsten Kriegslasten nach dem Überfall durch die Deutsche Wehrmacht zu tragen hatte. Das schloss für mich jede politische Gemeinsamkeit von Kohl und Gorbatschow für die Zukunft aus. Doch später vereinbarten ausgerechnet Helmut Kohl und Michael Gorbatschow die deutsche Einheit. Mein vollmundiger Kommentar wurde durch die Realität widerlegt. Ein Blick in die Geschichte lehrt, dass die unglaublichsten Wendungen möglich sind.
Ein Beispiel dafür ist auch die Verleihung der Friedensnobelpreise an den israelischen Ministerpräsidenten Menachim Begin (1978)2 und später an den Palästinenserführer Jassir Arafat (1994)3. Denn beide Politiker galten ihren früheren politischen Gegnern als Terroristen und wurden als solche lange Zeit gegenseitig gebrandmarkt, ehe sie den Weg zu einer gemeinsamen Friedenspolitik fanden.
Diese Möglichkeit zum politischen Wandel im Kopf zu behalten, also „einen kühlen Kopf“ bewahren, gehört auch zu den Grundlagen des Journalismus. Und ich muss im Rückblick bekennen, dass ich zuweilen diesen „kühlen Kopf“ nicht bewahrt habe.
Nun beschriebt dieses Buch nicht den Weg, wie man Journalist oder Journalistin wird. Stattdessen erläutere ich die Frage, warum man überhaupt Journalist werden soll. Ein weiteres Kapitel kann Orientierung geben im Hinblick auf Grundsatzentscheidungen und journalistische Genres. Dabei werden auch die Verantwortungsbereiche von Etat, Programm und Personal erläutert. Ein weiterer wichtiger Themenschwerpunkt ist die Frage, wie wir informiert werden. Und um es gleich vorweg zu nehmen: Diese Frage muss heute angesichts der unglaublichen Vielfalt und Vielzahl an Informationsquellen ergänzt werden von der Frage „Wie informieren wir uns selbst?“. Dem schließt sich ein kurzer Text an, der ursprünglich für Absolventen eines Volontärkurses gedacht war und sich mit dem Übergang von der Ausbildung zur Praxis im Journalismus beschäftigt. Durch zahlreiche Lehrveranstaltungen und Tagungen auch im Ausland sind zwei weitere Aspekte in dieses Buch gelangt: Einerseits geht es um die Medienkompetenz, die auch Journalisten selbst erwerben müssen. Andererseits geht es um journalistische Ethik und Standards, die ebenfalls unverzichtbar, aber erlernbar sind und stets einem Wirklichkeitstest in der Praxis unterzogen werden müssen.
Anschließend werden die sozialen Netzwerke auf den Begriff „sozial“ hinterfragt. Hier eröffnet sich ein Bereich, dessen Auswirkung auf Meinungsbildungen und Meinungsmanipulation bis heute noch nicht abzusehen ist. Demgegenüber ist das nachfolgende Thema über Krisenberichterstattung und Konfliktfälle für Journalistinnen und Journalisten schon lange und immer wieder erörtert worden. Aus der Sicht des Praktikers habe ich zuweilen mit Stirnrunzeln akademische Abhandlungen dazu gelesen, denen – bei aller Wertschätzung – zuweilen anzumerken war, dass deren Autoren noch nie als Journalisten im Gefechtsfeuer an einer Front gelegen oder bei einem Bombenangriff um ihr Leben gebangt haben. Doch gerade solche Umstände prägen oft die Kriegsberichterstattung nachhaltiger als wir es uns vorstellen können. Zu diesem Themenbereich gehört auch das Gespräch über den „embedded journalist“, also den in das Militär einer der Kriegsparteien „eingebetteten“ Journalisten, zu dem mein Kollege Henry Jarczyk seine Erfahrungen als Auslandskorrespondent mit beigetragen hat.
Völlig anders steht es dagegen um den Bereich des Kulturjournalismus, der aufgrund meiner eigenen früheren Programmverantwortung am Beispiel des so genannten Kulturradios behandelt wird. Auch wenn es medienspezifische Formen des Journalimus bei Printmedien, im Hörfunk, Fernsehen oder Online gibt, lassen sich dennoch inhaltliche Parallelen über alle Vermittlungsformen hinwegziehen.
Ein heute eher unterschätzter Aspekt ist das Archiv, das für die strukturierte Erfassung von journalistischen Inhalten zuständig ist und diese Inhalte für die Recherche zur Verfügung stellt. Da ich selbst meine Laufbahn in einem Zeitungsarchiv begonnen habe, weiß ich dessen Bedeutung sehr zu schätzen. Die Systematik einer journalistischen Recherche in einem Medienarchiv sollte nicht durch den fremdbestimmten Algorithmus einer Suchmaschine im Internet ersetzt, sondern im besten Fall ergänzt werden. Das schließt natürlich mit ein, dass inzwischen zahlreiche Archive online aufbereitet und nutzbar sind.
Am Schluss dieses Buches erlaube ich mir noch wegen meiner eigenen Fachrichtung einen Blick über die Grenzen nach Osteuropa. Zunächst geht es um den Wandel des Russland-Bildes in den deutschen Medien. Geprägt von der politischen Agenda und den jeweils obersten Repräsentanten, haben wir von Gorbatschow über Jelzin bis Putin eine deutlich belegbare Veränderung festzustellen. Diese Bestandsaufnahme zeigt, dass der Journalismus der politischen Konjunktur folgt und nicht umgekehrt. Ein anderer politischer Wandel in den Reformstaaten des östlichen Mitteleuropas (früher schlicht Osteuropa genannt) war von einem Medienwandel begleitet worden, der in seinen Anfängen einem Medientransfer von West nach Ost entsprach. Dem folgte dann aber ein emanzipatorischer Akt, manchmal auch politisch gesteuert, der die heutige Medienlandschaft in den ehemaligen Reformstaaten zu prägen begonnen hat.
Zu guter Letzt wurde in einem Interview für die Studierenden noch einmal summarisch aufbereitet, was auch mein Anliegen mit diesem Buch ist: Interesse am Journalismus und Verantwortung für den Journalismus wecken.
Einige Grundregeln des Journalismus, die immer wieder auftauchen, habe ich in diesem Buch durch eine Umrahmung hervorgehoben.
Mehr als vier Jahrzehnte habe ich im Journalismus gearbeitet, als Redakteur, Auslandskorrespondent, Chefredakteur und Programmdirektor. Sehr früh fing ich an, mein Fachgebiet Osteuropa und den Journalismus für den Unterricht an der Universität zu verbinden – zunächst in München, dann in Bamberg. Hinzu kamen zahlreiche Einsätze vor allem an Medien- und Bildungseinrichtungen in Russland, der Ukraine, Georgien und dem Balkan. Während dieser Tätigkeit sind die meisten Texte entstanden, die teilweise als Vorträge oder als Aufsätze4 veröffentlicht und hier nun zusammengetragen wurden. Zuweilen ist dabei der Charakter des gesprochenen Wortes erhalten geblieben, weil ich nicht nachträglich dem Text mehr Gewicht verleihen wollte, als er ursprünglich hatte. Außerdem werden einige Gedanken wiederholt geäußert. Sie sind aber in dem jeweiligen Sachzusammenhang unverzichtbar. Kapitel, zu denen es keine Quellenangabe gibt, wurden als Originalbeitrag für dieses Buch geschrieben.
Im meinem Lebensweg habe ich vielen Kolleginnen und Kollegen zu danken, die mein Korrektiv waren, die mich gefördert haben und die mir Verantwortung übergeben und mir vertraut haben.
Zwei Namen möchte ich dafür stellvertretend nennen: Die entscheidenden Förderer in meiner beruflichen Laufbahn waren der damalige Hörfunkchefredakteur Hans-Joachim Netzer und Prof. Dr. Albert Scharf, damaliger Intendant des Bayerischen Rundfunks. Mit einem ungeheuren Vertrauensvorschuss hat Hans-Joachim Netzer meine Laufbahn als ARD-Auslandskorrespondent eingeleitet. Mit eben demselben Vertrauensvorschuss hat Albert Scharf mich als Chefkorrespondent zum BR zurückgeholt und die Grundlage für meine weitere Karriere gelegt.
1 Zitiert nach: http://www.spiegel.de/einestages/politiker-entgleisungena-946818.html (Aufruf 8. April 2018).
2 Zusammen mit dem ägyptischen Präsidenten Anwar as-Sadat.
3 Zusammen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Jitzchak Rabin und dem späteren israelischen Staatspräsidenten Schimon Peres.
4 Belege aus sozialen Netzwerken wurden für dieses Buch teilweise aktualisiert.
Warum Journalist werden?
Ich bin Journalist geworden – gegen den Wunsch meines Vaters. Er hatte kein Vertrauen zum Journalismus und zu den Journalisten. Damit gehörte mein Vater zu der Mehrheit der Menschen in Deutschland.
Das war vor vierzig Jahren so.
Und das ist auch heute noch so.
Ich zitiere eine Umfrage von 2014 in Deutschland. Welche Berufe haben die höchste Akzeptanz? Das sind Feuerwehrleute, Sanitäter, Pflegepersonal im Krankenhaus, Piloten, Ärzte, Apotheker, Polizisten. Und wer steht ganz unten am Ende der Skala? Welche Berufe haben das geringste Vertrauen in Deutschland? Journalisten und Politiker.
Soll man da wirklich noch Journalist werden?
Ja, man soll.
Warum?
Damit unterliegt der Beruf des Journalisten einem ethischen Anspruch. Genau so wie es auch eine Ethik für Medien überhaupt gibt. Nicht Quote und Profit einer Zeitung oder eines TV-Programms rechtfertigen jeden journalistischen Inhalt. Nein, umgekehrt: Guter Journalismus rechtfertigt die Akzeptanz eines Mediums in der Gesellschaft und letztlich damit auch die Auflage oder die Einschaltquote.
Das ist ein Ideal. Und das werden wir nicht in jedem Fall erreichen. Aber wir sollen dies als Leitbild anerkennen.
Gelernt habe ich meinen Beruf bei einer kleinen Lokalzeitung in meiner Heimatstadt. Wenn ich dort den Namen des Bürgermeisters falsch geschrieben habe oder ein Datum von einem Ereignis vertauscht habe, dann war der Teufel los. Die kleinsten Fehler wurden gnadenlos kontrolliert. Denn ich traf täglich meine Leser auf der Straße. Dies ist sicher die beste Schule, Verantwortung für sein journalistisches Handeln zu übernehmen.
Auch als politischer Korrespondent in der damaligen Regierungsstadt Bonn konnte mir so etwas passieren. Denn Politiker und politische Institutionen in der ganzen Welt lassen die Medien auswerten. Sie wollen wissen, ob und wie oft sie darin vorkommen, wie sie dargestellt werden. Und sie lieben es, Journalisten zur Rechenschaft zu ziehen. Deshalb ist es wichtig, in der Berichterstattung die immer gleiche Distanz zu allen Politikern und zu allen politischen Richtungen einzuhalten. Dann ist der Journalist nicht erpressbar und er kann nicht missbraucht werden.
Also halten wir die beiden wichtigsten Regeln fest:
Das klingt auf den ersten Blick ganz vernünftig. Aber in einer großen politischen oder wirtschaftlichen Krise, in der Kriegsberichterstattung oder bei der Arbeit in autoritären Staaten ist das gar nicht so leicht. Dann ist diese Unabhängigkeit eine große Herausforderung und jeder Journalist muss im Konfliktfall von seiner Redaktion und seinem Chefredakteur/seiner Chefredakteurin vor Angriffen geschützt werden.
Die zweite Regel ist uns nicht immer klar. Der Journalist ist neutral. Er ist nicht Kämpfer für Ideen, über die er berichtet. Eine Ausnahme davon ist der Kommentar. In einem Kommentar darf er jede sachliche Distanz aufgeben. Er darf seine Meinung sagen. Dafür gelten drei Richtlinien:
Ich erinnere mich gut an die Berichterstattung aus dem so genannten arabischen Frühling, der im Dezember 2010 begann. Fast die gesamte westliche Presse jubelte über den Aufbruch der arabischen Welt in ein demokratisches Zeitalter. Dabei gingen oft Informationen und Meinungen durcheinander. Mir fehlten zwei Dinge: Erstens fehlte mir die Distanz zu den Demon-stranten. Sie nutzten zwar Schlagworte von Demokratie. Aber die meisten hatten mit Demokratie keine Erfahrung. Also war auch unklar, was sie wirklich damit meinten. Zweitens fehlte mir in den Berichten der kulturelle und historische Hintergrund über die Lage in Ägypten, Libyen oder Tunesien.
Hätten wir mehr Hintergrundwissen, dann wäre Folgendes nicht passiert: Wir hätten nicht über den ersten angeblich demokratisch gewählten Präsidenten Mohammed Mursi in Ägypten im Sommer 2012 erst gejubelt und ihn dann verdammt, als er ein Jahr später wegen der Unterstützer der Muslimbruderschaft und wegen Hochverrats zu langjährigen Haftstrafen sowie zum Tode verurteilt wurde. Und wir hätten nicht gleich die Verhaftung seiner Vorgängers Husni Mubarak bejubelt, der nach zwei Jahren Untersuchungshaft 2013 wieder auf freiem Fuß kam, nachdem das Verfahren gegen ihn wegen des Todes von 800 Demonstranten eingestellt wurde, wenngleich er später noch wegen Korruption verurteilt wurde. Und wir hätten auch nicht einfach den Sturz des libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi 2011 und das Eingreifen westlicher Staaten in Libyen bejubelt, das später der US-Präsident Obama als den größten Fehler seiner Amtszeit bezeichnet hat.
Wir hätten immer nach dem Motiv der Handelnden forschen sollen und uns fragen sollen, was kommt danach. Jetzt haben konkurrierende islamistische Kämpfer den Staat Libyen zerschlagen. Dort organisieren nun Menschenhändler ein grausames Schauspiel, das uns im Mittelmeer mit vielen Tausenden von toten Migranten konfrontiert.
Oder Syrien: Was wissen und verstehen wir wirklich von dem Bürgerkrieg dort? Aber wir nutzen Videos aus dem Internet, ohne genau zu wissen, wer was wo aufgenommen und ins Netz gestellt hat. Ungeprüfte Informationen werden von allen Konfliktparteien in das Internet gestellt oder sonst irgendwie verbreitet. Deshalb kommen wir damit zur dritten Regel der journalistischen Ethik:
Journalisten müssen in der Lage sein, die Quellen für ihre Information zu belegen. In diesem Punkt unterscheidet sich der Journalismus nicht von der Wissenschaft. Genau aus diesem Grund nutzt dem Journalismus und der journalistischen Ausbildung eine wissenschaftliche Grundlage. Im Journalismus verwenden viele Kolleginnen und Kollegen eine Formulierung, um ihre Informanten zu schützen. Dann heißt es: Die Fakten stammen aus so genannten „informierten Kreisen“.
Natürlich gibt es Informantenschutz. Manchmal – aber nicht immer – wird dieser Informantenschutz in Deutschland vor Gericht anerkannt. Doch gegenüber dem Chefredakteur muss der Journalist seine Informanten nennen, weil der Chefredakteur oder der Programmdirektor dafür nach außen die Verantwortung trägt. So habe ich das immer praktiziert. Und nur so konnte ich auch Journalisten vor Druck von außen schützen. Auch den gibt es in Deutschland wie in jedem anderen Land.
Jetzt kommen wir zur harten Wirklichkeit dieses Berufes. Und wir kommen zu meinen eigenen Erfahrungen. Als junger Korrespondent kam ich 1983 nach Moskau. Damals herrschte noch der Kalte Krieg. Ich bekam im Büro einen anonymen Anruf. Einige Russlanddeutsche wollten auf dem Roten Platz für ihre Ausreise demonstrieren. Damals war Migration aus der Sowjetunion so gut wie unmöglich. Mit einem Kollegen als weiteren Zeugen fuhr ich an dem genannten Termin zum Roten Platz. Eine kleine Gruppe von fünf oder sechs Leuten versuchte, ein Bettlaken zu entrollen. Dort stand: „SOS – Wir wollen in unser Vaterland“. Es dauerte nur Sekunden. Dann kamen schon die üblichen KGB-Männer, die den Roten Platz bewachten, und Polizeiwagen. Die Menschen wurden vor meinen Augen zusammengeschlagen und abtransportiert. Eine weitere Recherche in diesem Fall war für mich nicht mehr möglich.
Was hatte ich erlebt?
Eine Inszenierung oder echtes Unrecht?
War ich mit Schuld daran, weil natürlich mein Telefon abgehört wurde und ich zum Roten Platz gefahren bin?
Was sollte ich darüber berichten?
Also konnte ich den Vorgang nur so beschreiben, wie ich es hier gerade getan habe.
Ein anderes Beispiel: In Moskau amtierte Jurij Andropow (1982-1984) als Generalsekretär der Kommunistischen Partei. Er war sehr krank und konnte in den letzten Monaten seiner Amtszeit nicht mehr öffentlich auftreten. Westliche Medien spekulierten über Machtkämpfe im Kreml. In der ersten Februarwoche 1984, auf dem Höhepunkt aller Spekulationen, erhielten mehrere westliche Korrespondentenbüros anonyme Anrufe. Der Staats- und Parteichef sei wieder voll genesen. Er werde am nächsten Morgen pünktlich um zehn Uhr mit seiner Wagenkolonne über den Kutusowskij Prospekt in den Kreml ins Büro fahren. An diesem Prospekt liegen zufällig viele Büros westlicher Journalisten. Also hingen die meisten Journalisten am Fenster, als tatsächlich – wie angekündigt – die gigantische Tschajka-Limousine samt den Begleitfahrzeugen und der Polizeieskorte mit hoher Geschwindigkeit Richtung Kreml rasten. Und kurz darauf tickerten die Agenturen: „Andropow wieder im Amt“. Ich konnte in meiner Reportage lediglich berichten, dass ich zwar die Wagenkolonne gesehen habe, aber keinen Andropow. Denn hinter den verhängten Scheiben war niemand zu erkennen. Damit blieb ich hinter der Schlussfolgerung anderer Journalisten zurück und meine Gesprächspartner im Radio waren darüber nicht sehr glücklich.
Heute wissen wir: Genau an jenem Tag saß Andropow nicht im Wagen. Er rang im Krankenhaus mit dem Tode und starb zwei Tage später. Eine inszenierte Geschichte.
Genau so schlimm aber sind andere Inszenierungen, auf die Journalisten sehr leicht hereinfallen können. Im Irak-Krieg gegen Saddam Hussein 2003 eroberten US-Truppen die Hauptstadt Bagdad. Der visuelle Höhepunkt war eine Szene, die weltweit als Foto oder im TV dokumentiert wurde: US-Soldaten umhüllten das Gesicht eines gigantischen Denkmals von Saddam Hussein mit der amerikanischen Fahne. Dann wurde das Denkmal gestürzt. Diese scheinbar spontane Aktion war – wie man erst später erfuhr – bereits Wochen vor dem Krieg von einer PR-Agentur ausgedacht und in das Drehbuch der medialen Kriegsführung geschrieben worden. Die Wahrheit hinter dieser Wirklichkeit konnte damals kein Reporter erahnen, der diese Szene live miterlebt und darüber berichtet hat.
Doch selten werden Inszenierungen so schnell entlarvt wie im folgenden Fall der rumänischen Revolution gegen Ceauşescu im Dezember 1989. Im Archiv des rumänischen Fernsehens gibt es bemerkenswerte Filmaufnahmen. Man sieht einen ausländischen Reporter, der todesmutig aus einer Unterführung auf die Straße stürmt. Dabei wird er von der Kamera verfolgt, während er gleichzeitig mit dramatischen Worten die Schrecken der Straßenkämpfe schildert. Zu sehen ist nur der Reporter, aber der Gefechtslärm unterstreicht „authentisch“ die gesprochene Reportage. Plötzlich stoppt der Reporter, die Schießerei verstummt. Er macht kehrt, dann gibt er ein Handzeichen, schreit „again“ und „cut“. Die Schießereien beginnen wieder. Der Mann hetzt erneut die Stufen hoch und wiederholt seinen Reportagetext. Wer jetzt an Zufall glaubt, wird schnell ernüchtert. Denn das „Schauspiel“ wiederholt sich ein drittes Mal, bis die Szene der vermeintlich authentischen Reportage sitzt.
Die Wahrheit ist: Es hat Straßenkämpfe gegeben. Die Lage in Bukarest war dramatisch. Menschen wurden getötet. Dennoch widersprach diese Reportage der Wahrhaftigkeit. Und ausgerechnet die Kamera, die der Manipulation diente, hat diesen Verstoß gegen die journalistische Wahrhaftigkeit entlarvt. Selbst wenn Sie als Journalist Augenzeuge sind, können Sie von einfachen Beobachtungen überfordert sein. Das ist eine Erfahrung, die ich vor allem bei der Kriegsberichterstattung immer wieder erlebt habe: Kriegsgräuel in einem Dorf. Menschen liegen blutend am Boden. Wer ist wie schwer verletzt? Wer hat wen aus welchem Motiv angegriffen? Zu welcher Volksgruppe gehören die Opfer? Wie viele Opfer mögen es sein?