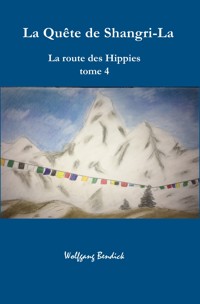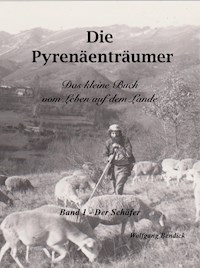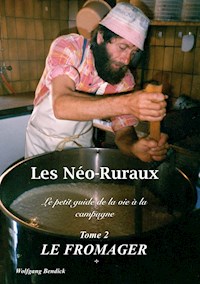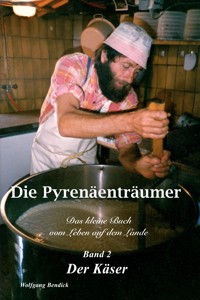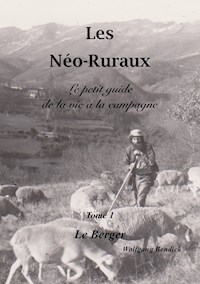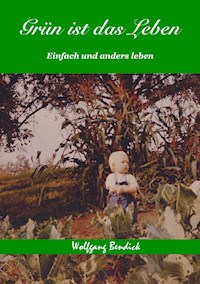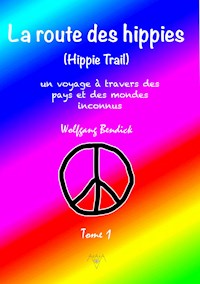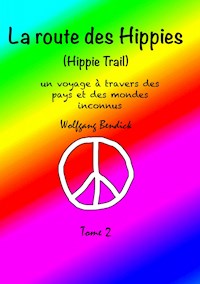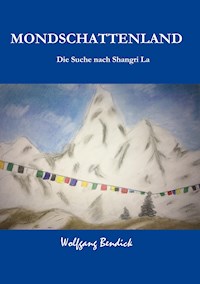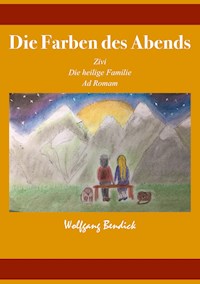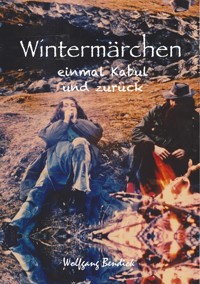Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Zu Wasser und zu Lande
- Sprache: Deutsch
Dieses ist die Geschichte einer Kindheit und Jugend in der Mitte des letzten Jahrhunderts. Es ist zugleich die Geschichte eines Jungen, der sich auf die Suche nach seinem Ursprung macht. Er bemerkt, dass die Welt der Großen voller Lüge ist und alle ihm etwas verheimlichen. Gut und Böse sind nicht immer klar zu unterscheiden. Worte haben oft mehrere Bedeutungen und lenken ihn auf falsche Spuren. Die Schule vermittelt etwas Wissen, aber er sucht mehr. Die Religion und das Wort Sünde verkompliziert die Suche noch mehr. Mit seinem Freund Max entdeckt er erschreckende Geheimnisse. Doch die Wahrheit ist noch viel schlimmer. Aber auch von einer unerwarteten Herrlichkeit! All die gefundenen Fäden führen langsam zusammen und verflechten sich zu einem Leben, dem seinigen…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Bendick
Jungens sind Jungens
Bube sind Bube
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Jungens sind Jungens
Impressum
Widmung
Der Irrtum des Klapperstorchs
Das fehlende Pippilein
Vergiftete Bonbons
Der Hausdrachen
Aa-Hund
Die Tö
Bütterken
Der Geruch des Herbstes
Die Zuckertüten
Wochenend und Sonnenschein…
Kreislaufstörung
I-Männeken
Der Marterpfahl
Die Lüge
Die Sau rauslassen
Die Kokosnuss
Mümmelmänner
Hammer und Amboss
Federhalter
Der Junge mit der dicken Lippe
Die Tommys
Sünde
Corpus Christi
Mein Paradies
Pamir 2
Der Verrat
Die Dreschmaschine
Altbewährte Erziehungsmethoden
Nachwuchs
Der Tod
Schiffen steckt an
Der Heilige Geist
Die neueste Mode
Du sollst es einmal besser haben!
Das Panzerschiff
Verbotenes und Strafen
Hawaii
Mit dem Fahrrad
Moritz
Kinderspiele
Karottenstecken
Der Ernst des Lebens
Neue Freunde
Das gelobte Land
Saupreiß, damischer!
Der Bastel
Heimatlos
Weiche Knie und heiße Bremsen
Resirap
Viel Zeit - wenig Geld
§ 175
Eine Explosion von Millionen von Sternen
Endlich Arbeiten
Gefährliches Spiel
Klassenparty
Hitze, Staub und Lärm
Die Jungfern
Mein Kampf
Endlich frei !
Weitere Werke des Autors:
Impressum neobooks
Jungens sind Jungens
Bube sind Bube
Wolfgang Bendick
Zu Wasser und zu Lande, Teil 1
Impressum
Text: © Copyright by Wolfgang Bendick
Umschlag: © Copyright by Lucia BendickWebseite: wolfgangbendick.com
Erstmals erschienen im April 2017
Zweite Auflage (Taschenbuch), September 2019
Überarbeitete Auflage, August 2023
Umschlagfotos : Pamir 2, zwei Brüder
Widmung
Sunt pueri pueri, pueri puerilia tranctant
( Bube bleibet Bube )
*
Für meinen Bruder
*
Wir hatten zwar die gleichen Eltern
wurden aber zu zwei verschiedenen Wesen
Der Irrtum des Klapperstorchs
Ich erblickte an einem 2. Januar 1948 um neun Uhr morgens das Licht der Welt. Auf einem Strohsack. Nicht in einer Krippe, dazu waren wir zu arm. Die erste Erinnerung an mein Erdendasein waren die Worte: „Willst‘ n Titi?“ Das muss mein Vater gewesen sein, und die Antwort meiner Mutter: „Vati, der ist doch jetzt zu groß dazu. Erinnere ihn doch nicht daran!“ Eine weitere Erinnerung ist die, aus dem Dunkel zum Licht zu steigen. Aber das kann genauso gut auch später gewesen sein. Denn wir wohnten an einem See und wie oft fiel ich vom Steg ins Wasser! Und genausooft zog mich jemand wieder hinaus. War das schön, den glänzenden Spiegel über mir zu durchbrechen und wieder die Lungen mit Luft zu füllen! Doch irgendwie war es da unten auch schön. Das Wasser übte immer eine große Anziehung auf mich aus, wie eine Kerze auf die Motten. Doch ebenso hatte alles andere Verbotene eine große Faszination für mich. Nach so einem kalten Bad zog man mir die festklebenden Kleider vom Leib, riss mir dabei halb den Kopf und die Ohren ab. Dann rieb man mich heftig mit einem rauen Handtuch, vielleicht, dass ich mir merken sollte, was mir das nächste Mal bevorsteht. „Wenn du das nochmal machst, kriegst du ‘ne ‚Abreibung‘!“ Das war nur eine Umschreibung für eine ‚Tracht Prügel‘, oder ‚Wucht‘, man ‚versohlte‘ mich, ‚gab mir den Hintern voll‘. Es gab viele Worte für diese seit Menschengedenken angewandte Erziehungsmethode, deren Erfolg zu widerlegen ich mir schon früh als Aufgabe gestellt hatte.
Eigentlich hätte ich ein Mädchen sein sollen. So hörte ich meine Mutter oft zu anderen sagen. „Wie gerne hätte ich als zweites Kind ein Mädchen gehabt! Das hätte ein schönes Pärchen gegeben. Na ja, ein Junge ist auch nicht so schlecht. Da kann er wenigstens die Kleider vom Großen auftragen!“ Manchmal zog sie mich aber trotzdem wie ein Mädchen an und drehte mich im Kreis. Bisweilen machte mir das ein schlechtes Gewissen, dass ich die Mutter so enttäuscht hatte. Ich wusste aber nicht, wie ich das hätte anstellen sollen, ein Mädchen zu werden. Was war überhaupt der Unterschied zwischen einem Jungen und einem Mädchen? Dass die einen in Lederhosen stecken, die anderen in Kleidern? Dass wir eine hässliche ‚Topffrisur‘ haben, die Mädchen schöne Zöpfe, an denen man aber nicht ziehen durfte? Wie hätte ich auch mehr wissen sollen, hatte ich doch nur einen Bruder als Vergleich! Und auch in der Nachbarschaft gab’s nur Jungens.
Eigentlich hätte ich schon am Vortag zur Welt kommen sollen. Denn für ‚Glückskinder‘ gab es eine Prämie. Die hätten wir bitter notwendig gehabt! Aber es lag damals schon in meiner Art, die Wünsche meiner Eltern zu durchkreuzen. Man nannte mich Wolfgang. Ein Name der mir nie gefiel; aber er deutete an, welche Erwartungen man an mich stellte: mindesten so zu werden wie Goethe oder Mozart, am besten noch besser als beide zusammen!
Seit dem ‚Titi-Entzug‘ war meine Hauptbeschäftigung, an meinem Daumen zu saugen. Das ersparte meinen armen Eltern wenigstens den Kauf von Schnullern. „Daumenlutscher“ nannte mich mein Bruder verächtlich. Wenn der wüsste, wie gut der schmeckte! Manchmal war er so wund gesaugt, vor allem als ich die Zähne bekam, dass ich eine Weile meinen Ersatzdaumen, den linken, saugen musste. Doch dieser schmeckte eigenartigerweise ganz anders. Was hatten die Eltern alles versucht, um mich davon abzubringen und zu einem normalen Kind zu machen! Die Mutter las mir aus dem ‚Struwwelpeter‘ vor, bis ich das ganze Buch auswendig kannte. „…weh, jetzt geht es klipp und klapp, mit der Scher‘ die Daumen ab!“ Doch ich lachte nur darüber. Obwohl ich anfangs schon ziemliche Angst hatte. Ich war überhaupt ein Angsthase. Nur gelang es mir, das gut zu verbergen. Lutschte ich später aus Trotz? Auf jeden Fall gab es mir ein Gefühl der Geborgenheit und ich brauchte keinen Schnuller. Jemand riet meiner Mutter, es mit Senf zu versuchen. Meine gespitzten Ohren hatten das natürlich mitgekriegt. „Euch werd‘ ich’s zeigen!“ sagte ich mir. Als meine Mutter dann mit dem Senfglas erschien, und meinen Daumen da reintauchte, steckte ich ihn gleich in den Mund, und obwohl es ziemlich brannte, leckte ihn ab und verlangte nach mehr. Am Abend dann erzählte sie alles dem Vater: „Stell dir vor, das hilft auch nicht! Er hat das halbe Glas leergegessen. Ich habe Angst, dass er sich den Magen verdirbt. Ich glaube, ich muss das Glas verstecken!“
Ich wollte alles wissen. Zerlegte mein Spielzeug um zu sehen, was da drinnen ist. Das Wort ‚warum?‘ war mein meistgebrauchtes Wort. Sehr zum Schrecken meiner Eltern! „Warum soll ich schon ins Bett? Warum ist es schon Zeit? Warum müssen Kinder schlafen?“ Manchmal sagte ich das Wort warum und wusste noch gar nicht, was ich eigentlich fragen wollte. Meine Eltern waren ziemlich am Ende, wussten keine Antworten mehr, oder gaben alberne. Ich nahm diese wie ernste, und stellte ebenfalls alberne, heute würde man sagen, absurde Fragen. „Warum ist die Banane krumm?“ antwortete mir mein Vater einmal. Darauf versuchten wir dann zusammen eine Antwort zu finden. Es wurde ein lustiger Abend! „Warte nur, bis du in die Schule kommst! Da kannst du alles erlernen!“ Doch als es dann, später, soweit war, waren es die Lehrer, die uns die Fragen stellten…
Ich hatte einen Bruder, der war etwas älter als ich und auch etwas grösser. Daran würde ich nie im Leben etwas ändern können. Ich blieb der Kleine. Damit fand ich mich früh genug ab. Auch, dass er der Stärkere war. An Weihnachten merkte ich, dass es Geschenke für Jungen gab und welche für Mädchen. Wir hatten zusammen mit den Eltern einen Wunschzettel aufgestellt. Ich wünschte mir eine Negerpuppe, mein Bruder ein Auto. Das Christkind legte beides unter den Weihnachtsbaum. Mein Bruder machte sich über mich lustig. „Der spielt mit Puppen!“ Jeder von uns zweien hatte einen Teddybären. Das war wohl ein Spielzeug für alle… Ein anderes Mal lag da ein Märklin-Baukasten, mit einer Menge Schrauben und bunten Blechen. Der war bestimmt für meinen Bruder. Der kleine Küchenherd daneben war für mich! Dieser wurde mit kleinen weißen Würfeln beheizt, die einen für uns Kinder anziehenden Geruch verbreiteten. Darauf kochte ich dann in winzigen Töpfen Suppe und Puddings. Wenn diese nicht anbrannten, waren sie einfach lecker, und ich kochte auch für alle Anderen. Dafür wurde ich gelobt. Das war was Besseres, als die Metallteile des Baukastens, die mein Bruder zwar auch in den Mund steckte, aber dafür Tadel bekam! Ich beobachtete die Eltern genau. Sie aßen meine Puddings wirklich! Machten es nicht wie bei meinen Sandkuchen, wo sie dran nibbelten „mhhh, ist das gut!“ sagten, und dann heimlich wegwarfen.
Weihnachten darauf bekam ich eine Puppenstube, mein Bruder eine Dampfmaschine. Sie wurde mit dem gleichen Brennstoff beheizt wie mein Küchenherd. Diese durfte ich nur anschauen, wenn mein Bruder dabei war. Sie spuckte Dampf und Hitze und das Schwungrad setzte sich irgendwann in wahnsinnige Bewegung, ähnlich den Lokomotiven, denen wir von weitem respektvoll zuschauten. Klar, dass ich sie später auch mal anfassen durfte und mir dabei die Finger verbrannte! Am meisten gefiel mir die kleine Pfeife auf dem Kessel. Wenn ich sie öffnete, kamen erst ein paar Wassertropfen raus, dann ein schrilles Pfeifen. Schnell machte mein Bruder sie wieder zu, denn schon begann das Schwungrad sich langsamer zu drehen. Aber auch meine Puppenstube hatte einen Wasserhahn, eine Badewanne und ein Klo. Das Wasser wurde in einen kleinen Behälter hinten dran gefüllt. Gar zu gerne hätte ich eine Dampfheizung eingebaut!
Weihnachten darauf bekam der Bruder Zubehör für die Dampfmaschine. Ich einen Puppenwagen. Langsam wurde ich dem Christkind böse. Ich war doch ein Junge! Und Jungenspielzeug fand ich inzwischen viel interessanter! Meine Mutter meinte, das Christkind hätte an Weihnachten so viel zu tun, da hätte es wohl etwas verwechselt. Es musste ja überall gleichzeitig sein! Sie hatte recht. Ich bemitleidete das arme Christkind. Anfangs kam es in der Nacht. Am Weihnachtsmorgen lagen dann die Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Zum Glück hatten die Eltern vergessen gehabt, die Tür zuzusperren! Denn wir hatten gehört, dass es woanders durch den Kamin gekommen war. Wie muss das nachher ausgesehen haben! Und bei uns war nur das dünne Ofenrohr, und der Küchenherd daran. Eine Zumutung!
Später gingen wir zwei mit dem Vater am Nachmittag des Heiligen Abends spazieren. Wir statteten dem Schrankenwärter in seinem Blechhäuschen einen Besuch ab. Gleich dahinter hatte er ein kleines Steinhäuschen, mit viel Blumen rundum, wo er und seine Frau und ihre zwei Ziegen wohnten. Manchmal klingelte das Telefon. Dann drehte er mit einer Kurbel die rot/weiß gestrichenen Schranken herunter. Eine Glocke machte „Pling, Pling, Pling!“ Langsam spreizten sich die beweglich hängenden Stäbe ab und bildeten eine Art Gittervorhang, der vom Schrankenrohr fast bis auf den Boden reichte. Wohl um zu verhindern, dass Kinder und Tiere da drunter durchschlüpften. Kurz darauf brauste die Rauch und Dampf speiende Lokomotive in einer Lärm- und Hitzewelle an uns vorüber und warf uns regelrecht zurück. Im Vorbeifahren zog der Lokführer kurz die Dampfpfeife, was uns einen weiteren Schreck einjagte. Dann folgten die Wagen in einem ohrenbetäubenden, an- und abschwellenden Lärm. Und plötzlich war der Spuk vorbei und alles verschwand rauschend in der Ferne. Wir halfen dem Bahnwärter beim Hochkurbeln der Schranken. Nur der Rauchgeruch schwebte noch in der Luft. So nahe waren wir einem Zug noch nie gewesen! „Nie ohne zu schauen über die Gleise gehen!“ mahnte er uns, „es könnte ja ein Zug von der anderen Seite kommen!“
Was hatten die Erwachsenen nur alles zu besprechen! Das nahm kein Ende! Wir zogen den Vater an den Händen; „Komm, sonst versäumen wir noch das Christkind!“ drängten wir. „Das eilt nicht! Das kommt noch lange nicht!“ Und er trank noch ein Schnäpsken mit dem Bahnwärter, der ab und zu zum schrillenden Telefon ging oder die Schranken betätigte. So konnten mein Bruder und ich noch mehrere Züge von nah bestaunen. Auch eine orangefarbene Diesellok, eine V 200. „Ich werde mal Lokführer!“ erklärte mein Bruder stolz dem Vater! „Komm du erst mal in die Schule!“ war dessen Antwort. Und immer noch hatten die sich was zu erzählen! Bis wir dann endlich nach Hause kamen, war es natürlich zu spät.
Das Christkind war schon da gewesen, und wir hatten es wieder nicht gesehen! Doch beim Anblick der Geschenke vergaßen wir das schnell. Wir sangen „Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn ‚Owi‘ lacht.“ Und ich dachte, Gottes Sohn heißt Jesus! Und dann noch ‚oh du fröhliche, oh du selige, knabenbringende Weihnachtszeit!‘, was sich ewig hinzog. (Ich ging noch nicht zur Schule; meine kindliche Seele hatte noch nicht durch den Religionsunterricht ihre Unschuld verloren. Von Gnade hatte ich nie gehört.) Außerdem war ich ja ein Knabe und auch in der Weihnachtszeit geboren! Hätten meine Eltern ein Mädchen haben wollen, hätten sie mich für Ostern oder so bestellen müssen. Was kann ich dafür, dass ich kein Mädchen bin! Ich war gespannt, ob sich das Christkind diesmal wieder vertan hatte. Dann durften wir uns auf unsere Geschenke stürzen. Mein Bruder hatte ein batteriegetriebenes Auto, ich eine Achterbahn zum Aufziehen. Ich glaube, jetzt war es bis zum Himmel durchgedrungen, dass ich ein Junge war!
Da waren wir zwei eine Weile beschäftigt. Doch blieb mir genügend Zeit, um über die knabenbringende Weihnachtszeit nachzudenken. Denn eigentlich hätte da eher mein Bruder ein Mädchen sein müssen, denn er war im August geboren, also weit von der knabenbringenden Weihnachtszeit entfernt! Auch sagten die Leute, wenn sie ihn sahen, „ganz die Mutter, die Augen, diese schwarzen Haare.“ Und bei mir „ganz der Vater, diese blonden Haare, dieser Dickschädel!“ Doch wo kommen die Kinder her? Man sagte uns, der Klapperstorch hatte uns gebracht. Aber ich wäre etwas schlecht verpackt gewesen. Darum hatte ich auch das kleine Loch vorne im Bauch. Transportschaden. Doch das war ja zum Glück zugeheilt, und man brauchte mich nicht umzutauschen. Mein Bruder hatte aber auch so ein Loch. Der Storch schien mir gar nicht so sicher als Transportmittel. Zum Glück hatte er mich nicht fallen gelassen!
Manchmal kam die ‚Pötterstante‘, die Hebamme, wie meine Mutter sie nannte, zu Besuch. Dann tranken sie zusammen ein, meistens zwei Gläschen ‚Datisnixfürdich‘ und tuschelten aufgeregt miteinander. Meine Mutter sagte, diese hatte mich in Empfang genommen, ‚aufgehoben‘, als mich der Storch abgelegt hatte. Das hätte meine Mutter bestimmt auch alleine hingekriegt! dachte ich mir. Denn wenn der Postbote Pakete brachte, so wie letztens das große mit den Lebkuchen, was bestimmt schwerer war als ich damals, ruft sie ja auch nicht die Tante Pötter zu Hilfe! Unbemerkt krabbelte ich unter den Tisch. „Hast du aber noch schöne Beine!“ hörte ich die Tante sagen, „Andere Frauen haben nach ein paar Kindern schon Wasser darin!“ Ich schaute mich um. Ich sah die meiner Mutter und die der Besucherin. Demnach müsste diese viele Kinder haben, denn sie schimmerten leicht bläulich! „Ich hab ja nur zwei!“ hörte ich Mami sagen. „Ich kann nicht verstehen, dass andere so viele haben. Bestimmt haben die nicht aufgepasst!“ Sie sprach in Rätseln. Was sollte das heißen, nicht aufgepasst? Wenn ich hingefallen war, hieß es „pass doch auf!“ Sollte ein Mädchen, das hinfällt, ein Kind geliefert bekommen? Sie fingen an zu tuscheln. Vielleicht aus Rücksicht auf meine empfindlichen Ohren. Ich bekam nicht alles mit. Aber es ging um Monate und anstehende Lieferungen des Klapperstorches. Nach einer Weile stand die Tante Pötter auf. „Wölfi! Komm und sag der Tante auf Wiedersehen!“ Ich rührte mich nicht. Sie begleitete den Besuch hinaus. Schnell schlüpfte ich aus meinem Versteck, krabbelte in mein Eck und wühlte in der Spielzeugkiste. „Ja wo warst du denn?“ „Immer in der Küche!“ „Ich hab‘ dich gar nicht bemerkt. Muss wohl von dem dritten Gläschen kommen…“
Dass mein Geburtstag so kurz hinter Weihnachten lag, passte mir gar nicht. Ich hatte den Eindruck, dass meine Geschenke halbiert wurden, so dass ich an beiden Festen weniger bekam. Eigentlich müsste das ja ‚Liefertag‘ oder so heißen. Irgendwie kam mir die Welt der Erwachsenen wie ein Rätsel vor. Oder sie versteckten, verheimlichten uns etwas. ‚Geboren werden!‘ Was heißt das eigentlich? „Na ja, zur Welt kommen!“ „Klar, mit dem Storch. Aber vorher, wo holte der einen her?“ „Das verstehst du noch nicht, werde erst mal groß!“ Ich fand, ich war groß genug. Und selbst mein Bruder, der grösser war, bekam dieselbe Antwort. Und ich verstand mehr, als die Großen glaubten! Entweder logen sie mich an oder sie wussten es selber nicht! Mein Vater baute an einem neuen Ruderboot. Dabei mussten viele Löcher mit der Bohrkurbel ins Holz gebohrt werden. Manchmal durfte ich sie nehmen und Löcher in Abfallstücke bohren. Rechtsherum ging der Bohrer rein, linksherum raus. Da kam mir ein Gedanke: vielleicht werden so die Kinder ‚gebohren‘. Ich sah mich im Geist auf einem Bein stehen und linksherum aus der Erde ‚herausbohren‘, auf einem großen Feld. Ähnlich wie ich ‚bohrten‘ sich da noch andere Kinder heraus und wir warteten, dass uns der Storch holte zum Ausliefern. So musste das sein!
Das fehlende Pippilein
Anfangs badete man uns beide zusammen in der Zinkbadewanne. Da passten wir gut rein. Und das war lustig! Einmal legte sich mein Bruder zurück, zeigte auf sein durch das Wasser ragende ‚Pippilein‘ und sagte: „Schau mal, wie eine Boje!“ und wackelte damit hin und her. „Da fasst man nicht dran, damit spielt man nicht!“ schimpfte unsere Mutter. Komisch, mit den Fingern durfte man doch auch spielen! „Aber, wenn man Pippi macht, fasst man doch auch dran!“ „Ja, aber nur dann!“ „Und wozu ist denn der kleine Sack da drunter?“ „Der ist zum Tropfen auffangen, wie der Schwamm am Hals der Kaffeekanne!“ Das leuchtete uns ein. Endlich mal eine klare Antwort! (Auf dem Deckel von Kaffeekannen setzte man damals ein gehäkeltes Püppchen, dessen eine Befestigung, zugleich ein kleines Schwämmchen, genau unter dem ‚Schnabel‘ festhielt, dessen andere Befestigung um den Henkel der Kanne lief. Somit wurde auch noch der Kannendeckel festgehalten und konnte nicht beim Gießen herausfallen.) Nach uns badete der Vater in demselben Wasser, dann die Mutter. Zwischendurch wurde mit einem Schöpfer heißes Wasser nachgefüllt. Dann wurde noch die Wäsche der letzten Woche darin eingeweicht. „Ist das aber eine Drecksuppe!“ sagte Mutter am nächsten Tag. Wir hofften, dass sie das Wasser nicht auch noch zum Kochen der Suppe nahm! Meist diente es nachher zum Bodenputzen und Blumenbeete gießen.
Wir selber tollten immer angezogen herum. Es gab aber auch Eltern, die ihre Kinder manchmal nackt im Garten oder Haus herumrennen ließen. Das sparte Windelwaschen. Denn diese waren aus Baumwolle und wurden mit Hand, Waschbrett und Bürste gewaschen. Kernseife diente zu allem, auch zum Haare waschen. Einmal waren wir zu Besuch bei Leuten, deren Kinder gerade im schönsten Gewand durch die Wohnung rasten. Jungens und Mädchen, alle nackig. „Kriegen die nicht kalt?“ fragte meine Mutter besorgt. Ich hatte den Eindruck sie wollte nicht, dass wir die nackigen Kinder sehen. „Nee, die sind das gewöhnt!“ antwortete deren Mutter und bereitete den Kaffee vor. „Ich möchte die aber nicht auf den Schoss nehmen!“ meinte unser Vater. Beide hielten uns auf ihrem Schoss. Wahrscheinlich wollten sie so verhindern, dass eines der anderen Kinder da hochkrabbeln würde. Ich hatte in meinem kurzen Leben noch nie ein nackiges Mädchen gesehen. Ich starrte entsetzt zwischen seine Beine, zeigte auf seinem Bauch und stotterte: „Dem fehlt ja das ‚Pippilein!“ „Das ist auch ein Mädchen!“ klärte meine Mutter mich auf, die brauchen keines!“ „Aber wie machen die denn dann Pippi?“ „Die machen das so, ohne!“ Klar, dachte ich mir, dann brauchen die ja auch nicht den Schwamm! Also waren Mädchen unvollständige Jungen. Sie taten mir leid. Sie konnten nicht einmal an einem ‚Weitschiffen‘ mitmachen, was unter uns in Mode war, wenn mehrere Jungen zusammen waren. „Schiffen steckt an!“ sagte man und stellte sich zu den anderen in eine Reihe.
Wir lebten also hauptsächlich in einer ‚Männerwelt‘. ‚Jungenwelt‘ wäre genauer, aber wir fühlten uns groß, gab es doch immer noch Kleinere irgendwo, an denen man sich messen konnte, die ‚Hosenscheißer‘. Direkte Nachbarn hatten wir keine. Alle ein paar hundert Meter weit weg. Zur Stadt waren es zwei Kilometer. So hatten wir es gehört. Was das genau war, wussten wir nicht. Auf jeden Fall weit. So weit, dass wir da nicht alleine hindurften. Das nächstliegende Haus war die ‚Stadtmühle‘, eine Gastwirtschaft. Dort war auch eine Landwirtschaft dabei, die aber von jemand anderem betrieben wurde. Die Besitzer des Gasthofes waren zugleich die Vorstände der Bootshausgesellschaft, also die Chefs unserer Eltern. Sie lebten auf ‚großem Fuß‘, wie diese sagte. Ich schaute das nächste Mal genau hin. Eigentlich waren deren Füße nicht viel grösser als die meines Vaters. Sie besaßen zwei Mercedes Autos, mit denen sie sonntags in die Kirche fuhren, wo sie reservierte Plätze hatten. Unsere Eltern gingen nicht in die Kirche. Das hatten sie nicht notwendig. Und Samstag/Sonntag ging es bei uns rund. Da war Hochbetrieb. Jemand musste ja die Arbeit machen, damit andere in die Kirche gehen konnten! „Wenn die mal in den Himmel kommen, dann will ich lieber in die Hölle!“ meinte meine Mutter. Und das sagte ja wohl alles. Und deshalb war ich mir manchmal gar nicht so sicher, ob ich mal in den Himmel wollte. Denn meine Mutter hatte ich zu gerne.
Wenn man vor dem Sebbel (Stadtmühle) nach rechts abbog, Richtung Sythen, kam man zu einer anderen Gastwirtschaft, dem Göcke. „Eher eine ‚Kneipe‘“ meinten die Eltern abwertend, „da möchte ich nicht essen!“ Über die Terrassenfläche war eine riesige, rot/weiß gestreifte Plane gespannt, die den oft zahleichen Gästen Schutz vor Sonne und Regen geben sollte. Einmal zerriss der Sturm diese und die Fetzen flogen bis zu uns. So kam ich zu meinem ersten Zelt. Hier bediente der ‚Thekenschreck‘, eine ziemlich aufgetakelte Frau mit einem enormen Pferdegebiss. Doch war diese, zumindest bei den Männern, sehr beliebt. Das konnten wir aus den Umarmungen und Klapsen auf das Hinterteil schließen. Wir durften dort eigentlich nicht hin. Irgendwie war der Ort verrufen, zumindest bei den biederen Frauen. Das merkten wir daran, dass die Frauen immer den Ton senkten, wenn sie auf den ‚Thekenschreck‘ zu sprechen kamen.
Der Göcke hatte auch einen Paddelbootverleih. Schwere Dinger, aus Presspappe und Leisten zusammengebaut, mit Teer und dunkelblauer Farbe abgedichtet. Wir nannten sie ‚Schlickrutscher‘, wegen ihrer Bauart. Diese Dinger liefen vorne und hinten spitz zu. Die meisten Leute, die sich so ein Boot mieteten, wussten damit nicht umzugehen. Durch einen Arm des ‚Mühlbaches‘ gelangten sie unter einer Brücke hindurch in den See. In dieser Brücke konnte man ein Stauwehr hochkurbeln, um in trockenen Sommern den Mühlbach hoch zu halten. Fuhren wir Kinder unter dieser Brücke durch, riefen wir jedes Mal: „Wie heißt der Bürgermeister von Wesel?“ „Esel!“ antwortete dann die Brücke. Wenn also die Paddler in den See einmündeten, hatten sie genügend paddeln gelernt, um vorwärts zu kommen. Das Lenken versuchten sie zu lernen, wenn sie, gleich einer schwimmenden Windmühle, zwischen die gleich anschließend an den Bojen liegenden Segelboote gerieten. Da bummsten und kratzten sie sich dann durch. Oft gab es Schäden, sogar Löcher im Mahagonirumpf der Segler. Diese blauen Boote waren für meine Eltern ein rotes Tuch.
Vergiftete Bonbons
Unser Haus und die Bootsschuppen lagen auf einer Insel, umflossen von dem in zwei Arme geteilten Mühlbach. Eine Straße, die ‚Strandallee‘, durchquerte diese Insel und verband sie durch zwei Brücken mit dem ‚Festland‘. Auf der anderen Straßenseite erstreckte sich ein ziemlich großes Feld und eine etwas verwilderte Wiese, auf der im Sommer ein paar Wohnwagen standen, im Winter ein Wanderschäfer sein Wägelchen und die Schafe parkte. Auf unserer Seite bedeckten die ebenerdig liegenden Bootshäuser so mindestens die halbe Fläche. Ungefähr 500 Paddelboote hatten darein Platz. Davor säumte ein eichener, geschwungener Steg das Ufer, rechter Hand lief ein schmaler Schwimmsteg in den See, woran die ‚Möwe‘, ein motorgetriebener Fahrgastdampfer lag. Darauf konnten wir nach Herzenslust mitfahren, war doch der Sohn des Kapitäns in meinem Alter. Sein Großvater fuhr auf dem Rhein ein Frachtschiff. Schwimmen konnte in der Familie aus Tradition niemand. Und dieses wurde dem Opa mal zum Verhängnis. Bei einem Zusammenstoß fiel er über Bord und tauchte nie wieder auf.
Auch mein Vater trug eine Schiffermütze, war aber kein richtiger Kapitän. Er war der Wärter der Boote, der Bootswart! Und meine Mutter ging ihm dabei zur Hand. Das fing im Winter an, mit dem Karteikarten ausfüllen. Die Umgebung der Bootshäuser musste gepflegt werden, das Holz gestrichen, der Steg ausgebessert. Losgerissene oder vom Sturm umgeworfene Boote mussten geborgen werden, und so fort. Wo möglich, waren wir dabei und halfen, so gut wir konnten. Aus alten Zeitungen schnitten wir mit der Schere rechteckige Blätter als Klopapier und fädelten sie auf Bindfäden zum Aufhängen. Fegte die Mutter die Gänge zwischen den übereinander, auf schwenkbaren Holzkonsolen liegenden Booten, sprengte ich mit einer Gießkanne, oder mit der Hand direkt aus einem Eimer Wasser auf den rauen, staubigen Betonboden. Ich lief nie langsam. Ich rannte wie ein wildgewordener Handfeger durch die Gegend, wollte überall sein, freute mich, wenn man mich etwas tun ließ. Oft saß ich auf dem hölzernen Steg und paddelte stundenlang mit einem Stechpaddel, schaute auf die vorbeiziehenden Strudel und stellte mir vor, ich paddle auf dem Yukon-River durch Kanada. Ein Onkel meiner Mutter hatte da lange als Pelzjäger gelebt und ein dickes Buch geschrieben, aus dem die Mutter uns vorlas, mit Fotos drin, von Blockhäusern und seinen treuschauenden Schlittenhunden. Ich träumte gerne in den Tag hinein. Einmal schaute meine Mutter auf meine Füße und sagte: „Du wirst mal große Reisen machen, deine ersten zwei Zehen stehen so weit auseinander!“ „Nein, Mami, ich bleibe immer bei dir!“ tröstete ich sie.
Eine Gruppe Zigeuner hatte uns gegenüber, auf der Wiese neben dem Feld, wo im Sommer die paar Wohnwagen stehen, für einige Tage ihre Wohnwagen und Zelte aufgestellt. Sie gingen von Tür zu Tür und verkauften Bürsten und Wäscheklammern. Manche bettelten auch. Diesmal kam das Verbot vorher. „Geht da ja nicht hin! Die stehlen euch und verkaufen euch an andere Leute, die keine Kinder haben, oder essen euch auf!“ „Ja aber die haben doch eigene Kinder, warum essen sie die nicht erst auf?“ „Die essen lieber die Kinder von anderen Leuten, die schmecken besser! Habt ihr nicht gemerkt, wie die Zigeuner riechen?“ „Nein. Du hast doch gesagt, wir dürfen da nicht hingehen!“ „Die stehlen auch Hühner und alles, was nicht eingeschlossen ist! Haltet ja immer ein Auge offen!“ Ich fragte mich, warum nur eines. Das war anstrengend, und ich fand, man sah besser mit beiden! Wir beobachteten sie von ferne. Nach einer Weile kamen welche rüber. Meine Mutter drückte uns an sich. Sie kaufte ihnen aber eine Bürste ab. Als sie wieder weg waren schickte sie uns ums Bootshaus. „Schaut schnell nach, ob sie nicht hinterm Haus sind! Oft, wenn sie einem vorne etwas verkaufen, kommen Andere von hinten und stehlen was sie finden!“
Hinter der Brücke zur Stockwiese stand an Wochenenden immer ein Mann und verkaufte leckeres Eis. Mit einem Löffel, dessen Griff man, ähnlich wie an der Haarschneidemaschine vom Vater, zusammendrücken konnte, kratzte er es aus einem seiner Behälter und drückte es als Kugel auf ein Waffelhörnchen. Das kostete nur 10 Pfennig. Und diese hatten wir oft, weil wir einen Segler mit dem Ruderboot übergesetzt hatten. Manchmal schenkte er mir noch ein paar angebrochene Waffeln dazu. „Ach, bist du aber ein süßer Junge!“ sagte einmal eine Frau zu mir, die sich auch ein Eis kaufte. „Sag mal, wie heißt du denn?“ Ich sagte ihr meinen Namen, obwohl man mir verboten hatte, mit Fremden zu sprechen. „Da hast du eine Tüte Bonbons, weil du so nett bist, die isst du doch bestimmt gerne!“ Sie reichte mir die Tüte. Ich zögerte, weil ich von den Eltern wusste, dass mit solchen Tricks Kinder gefangen werden, und dann weit weg verschleppt. Doch diese dickliche Frau sah nicht wie eine Kinderfängerin aus. Ich hielt vorsichtshalber genügend Abstand. Ich nahm die Tüte und bedankte mich, passte aber trotzdem auf, dass sie mich nicht fangen konnte! Aber dann fiel mir ein, dass Bonbons oft vergiftet sind. Mein Bruder war nämlich mit der Mutter beim Zahnarzt gewesen, und dieser hatte gesagt, „Süßigkeiten sind Gift für die Zähne!“ Ich steckte die Tüte erst mal ein und während ich mein Eis leckte, überlegte ich, was ich damit anfangen könnte. Die Eltern fragen? Diese würden mich nur schimpfen, weil ich mit jemanden gesprochen hatte! Also aß ich nur eines und versteckte den Rest in einem der Paddelboote. Wenn sie vergiftet sind, dürfte eines mir nichts ausmachen können. Und ich hatte richtig gehandelt. Nach ein paar Tagen war die Tüte leer, und ich lebte immer noch!
Der Hausdrachen
Manchmal kam der Opa, der Vater von meinem Vater, zu uns zu Besuch. Er schleppte immer einen ‚Bollerwagen‘, einen kleinen Handwagen, mit einem oder zwei Säcken Kartoffeln hinter sich her. Die waren aus seinem Garten und für uns. Er war vom ersten Weltkrieg her taub. Eine Granate war neben seinem Kopf explodiert. Weil er nichts hörte, nicht mal seine eigene Stimme, sprach er immer sehr laut, schrie fast. Das machte uns anfangs Angst. Wir hatten ihn gerne, nur blieb er nie lange. Er musste immer bald wieder weg. Wir wussten nicht, warum. Einmal hörte ich, wie er sagte: „Die weiß nicht, dass ich hier bin!“ Er redete ja laut genug. „Wer ist die?“ fragte ich den Vater. „Niemand! Er hat keine Zeit! Er muss die Kaninchen füttern!“ Ich war sicher, dass meine Eltern mir nicht die Wahrheit sagten. Wir wussten damals nichts von der Tragik, die manche Familien umgibt.
Nicht sehr weit, in Sythen, wohnte ein Halb-Bruder meines Vaters mit seiner Familie. Was das wieder bedeuten sollte! Ich hatte Beinamputierte gesehen, Männer mit nur einem Arm. Andere mit einer grauslichen Verletzung im Gesicht, die halbe Backe fehlte. Mutter sagte, das sei ein Säbelhieb, das machten die Studenten manchmal. Ich fragte lieber nicht, was Studenten sind. Manchmal brachte die Mutter ‚Studentenfutter‘ mit. Das war eine Mischung aus Nüssen und Rosinen. Das schmeckte uns. Waren Studenten so etwas wie Hamster oder Bieber? Ich verstand sowieso nicht, warum manche Erwachsenen Kriege machten und sich dabei verstümmelten, während andere wiederum alles taten, wie meine Mutter und die Ärzte, um diese wieder zusammen zu bauen! Wenn es nach mir ginge, könnte man die Kriege aufhören! Es würde reichen, wenn die Streithähne einen Boxkampf austrugen, wie Max Schmeling gegen Joe Louis, damals! Unter solchen Gedanken liefen wir Richtung Sythen. Ich war gespannt darauf, zu sehen, wie sich dieser halbe Bruder fortbewegte. Und wie er überhaupt aussah! Ich war enttäuscht. Er war wie jeder andere! Es fehlte ihm nichts. Vielleicht hatte man ihn so gut wieder zusammengesetzt? Mit den Teilen Anderer, denn in einem Krieg würden die Menschen oft von Granaten zerstückelt…
Er hatte zwei Töchter, die aber viel älter als wir waren. Sie beachteten uns wenig. Sie kitzelten uns, um uns zum Lachen zu bringen. Und eine hatte einen Jungen. Mit ihnen im Haus wohnte die Tante Liesbeth, von der man sagte, sie sei ein Hausdrachen. Was eine Hauskatze war, das wusste ich, aber ein Hausdrachen… ob sie sich verwandeln konnte, wie in einem Märchen, und vielleicht auch Feuer speien? Bei Tisch beobachtete ich sie genau. Sie hatte einen strengen Knoten in ihrem grauen Haar, eine schmale, leicht gebogene Nase. Gekleidet war sie ganz in schwarz. Eine Hexe konnte sie nicht sein, sie hatte keinen Buckel. Oder gab es Hexen ohne Buckel? Oder hatte sie einen künstlichen, aus Schaumgummi, wie meine Mutter so dicke Polster in einer Jacke hatte, die ihr breite Schultern gaben? Und ich hatte einen Reisigbesen im Gang stehen sehen, und eine schwarze Katze schnurrte um meine Beine! Ich hatte meine Mutter mit dem Vater auf dem Herweg flüstern hören, „weißt du noch, beim letzten Besuch, da hat sie Gift und Galle gespuckt!“ Vorsicht war also geboten. Es wurde kaum geredet am Tisch. Uns Kindern, auch dem Uwe, war Sprechen am Tisch verboten. Vor allem, wenn die Erwachsenen sich unterhielten. Es war stinklangweilig für uns. Nur sitzen, die Hände auf dem Tisch, nur antworten, wenn man gefragt war, und dann meist „ja, liebe Tante, nein, liebe Tante!“ Oder „danke schön“ mit einem Diener dazu. Ich wartete darauf, dass sie sich in einen Drachen verwandelte. Aber nichts geschah.
Dann schickte man uns endlich raus zum Spielen. Der Onkel, der leidenschaftlicher Fotograf war, wollte ihnen seine letzten Bilder zeigen. Er hatte eine Leica, hatte ich gehört, konnte mir aber nichts darunter vorstellen, vielleicht war das eine Krankheit. „Macht euch nicht schmutzig! Und keinen Lärm!“ rief uns der Drachen noch hinterher. Endlich erlöst! Wir schlichen uns in Onkel Heiners Schreinerwerkstatt und bewarfen uns mit Hobelspänen. Uwe meinte, dass hier die Tante nie herkäme. Nach einer Weile rief man uns. Wir eilten hinaus. „Ja wie seht ihr denn aus!“ rief die Tante. „Sind eben Jungens!“ nahm uns der Onkel in Schutz. Man staubte uns ab, vor allem die Tante. Deren Gesten glichen mehr Schlägen zur Bestrafung. Der Onkel wollte ein Foto von uns allen machen. Der Fotoapparat stand schon auf einem Dreibein. Wir stellten uns auf. Die Kinder vorne. „Lächeln!“ befahl man uns. „Nicht bewegen!“ herrschte uns der Vater an. Aber bis alles richtig eingestellt war, der Onkel auf einen Knopf gedrückt hatte, der Apparat zu surren anfing, er zu uns rannte und sich neben die Tante stellte, hatten wir uns natürlich bewegt. „Gleich kommt das Vögelken!“ meinte der Onkel. Ich dachte, das ist wie bei einer Kuckucksuhr. Stattdessen gab es einen grellen Blitz, so dass ich erschreckt zurückfuhr. „Ich hatte doch gesagt, nicht bewegen!“ fauchte mein Vater. Alle lachten über mich. Nicht mal meine Mutter nahm mich in Schutz!
Da war noch die Tante Maria, die Schwester meines Vaters. Sie war Klosterschwester und wohnte in Essen. Dieser Name gefiel mir, machte mir richtig Appetit. Sie arbeitete in einem Krankenhaus im Labor. Ich wusste nicht, was das war. Traute mich auch nicht zu fragen, weil dann bestimmt mein Bruder anfing „das Baby weiß noch nicht mal, was Labor ist!“ Dabei wusste der das selber nicht mal! Wir nahmen erst den Zug. Dritter Klasse, auf von Hosen glänzend polierten Holzbänken. Das war immer ein Erlebnis, die Bahn zu nehmen! Alles war riesig, roch nach heißem Öl und Russ. „Tut nichts anfassen!“ mahnte die Mutter, „das ist alles schmutzig!“ Aber in einen Eisenbahnwagen zu gelangen, ohne was anzufassen… Dafür mussten wir uns bei der Tante erst mal gut die Hände waschen und mit einem Stinkzeug einreiben. Es roch komisch bei ihr. Wo sie arbeitete, standen viele Flaschen rum. Sie führte uns durch das Krankenhaus. Ich hatte gar nicht gewusst, dass es noch so viele Kranke gab. Auf den Fotos meiner Mutter aus dem Krieg, sie war Krankenschwester gewesen, hatte ich auch viele Kranke gesehen. Aber der Krieg war doch schon lange vorbei…
Dann mittags mit der Tante essen. Mit Tischgebet. Das machte selbst unsere Eltern verlegen. „Dein Essen schmeckt aber viel besser, Mami!“ entfuhr es mir. „Sowas sagt man nicht!“ herrschte sie mich an. Ich verstand die Welt nicht mehr! Zuhause hätte sie mich dafür umarmt! Am Nachmittag begleitete uns die Tante in der Straßenbahn bis zum Bahnhof. Die Straßenbahn ruckte nach links und rechts. Das gefiel mir. Ich dachte, gleich muss sie entgleisen! Surrend hielt sie an. Ein paar Leute stiegen aus, dann stiegen andere ein. Was war denn das? War das der Schornsteinfeger? Da kam ein schwarzer Mann durch die Tür. „Ein Negerpimmel!“ hörte ich jemanden sagen. Von ‚Neger‘ hatte ich schon gehört. Einer der Heiligen Drei Könige war ein Neger, der Melchior. Und ‚Pimmel‘? Sollte ich die Tante fragen? „N‘ Schwatter!“ stellte die ihrerseits fest, „nicht anfassen, der färbt ab!“ Nur meine Mutter sagte nichts und drückte mich fest an sich. Heimlich betrachtete ich die Hände des Mannes. Und wirklich, innen waren sie heller als außen! Die Tante hatte Recht! Beim Aussteigen passte ich genau auf, wo ich hinfasste. Hundemüde kamen wir nach diesem Großstadtausflug wieder zu Hause an. Man steckte uns gleich ins Bett und ich vergaß sogar nach der Bedeutung der neu gelernten Wörter zu fragen.
Aa-Hund
Meine Mutter hatte mehr Verwandtschaft als mein Vater. Aber die wohnten alle weit weg, in der Ostzone. „Das heisst nicht Ostzone, das heisst DDR!“ „Sogenannte DDR!“ korrigierte mein Vater. Mehrmals im Jahr schickten meine Eltern Pakete rüber. Ich durfte beim Einpacken helfen. Seife, Zahnpaste, Schokolade, Nähgarn, Rasierklingen, Socken, Nylonstrümpfe. Und natürlich Zigaretten, Bohnenkaffee, Dosenmilch, Zitronen, eigentlich ziemlich alles. Wir wickelten meist die einzelnen Dinge in Zeitungspapier ein, denn ganze Zeitungen zu schicken war verboten. Ich wunderte mich, dass die das nicht selber kaufen konnten. „Denen fehlt im Augenblick noch vieles, aber ihr werdet sehen, bald werden die da drüben uns überholen!“ meinte der Vater, „denn bei denen ist die echte Demokratie, da herrscht das Volk. Bei uns machen die Kapitalisten die Politik!“ Ich schwieg. Das waren zu viele neue Wörter auf Mal. Wir kriegten dafür an Weihnachten immer eine große Flasche ‚Radeberger Bitterlikör‘ geschickt, Verdauungsmedizin für meine Mutter und die Pötterstante, und einen ‚Christstollen‘, der ab Ostern am besten war.
Schon lange hatten die Eltern davon gesprochen, mit uns zu den Verwandten im Osten zu fahren. Doch das war gar nicht so einfach. „Da ist zuerst eine Menge Papierkrieg zu erledigen!“ sagte die Mutter. Ich fragte mich, wie das ginge. Mit Papierflugzeugen? Oder sich mit Papierknäuel bewerfen? - An einem Wintertag fuhren wir los, weil im Winter weniger zu tun war. Der Herr Mühlbäumer schaute inzwischen am Bootshaus nach dem Rechten. Ich fand, er könne doch auch mal nach links schauen… Es war bitterkalt. Vor Morgengrauen schon holte uns ein früherer Schulfreund unseres Vaters mit dem Taxi ab. Das erste Mal, dass ich Auto fuhr! Und dazu noch mit einem Mercedes, mit einem Stern vorne drauf. Wie die Sebbels, die mal in den Himmel kommen sollen. Ob deshalb schon der Stern auf deren Auto ist? Es ging zum Bahnhof.
Über Eis und harschigen Schnee stapfen wir durch die Sperre auf den Bahnsteig. Der Zug steht schon da. Ein beißender Kohlegeruch liegt in der kalten Luft. Nur die riesige Lokomotive strahlt eine Welle von Wärme aus. Dampf strömt aus mehreren Öffnungen, hier klickt es, dort klackt es, wie der Herzschlag eines enormen, schwarzen Tieres. Aus einem Überdruckventil zischt laut ein Dampfstrahl in den dunklen Himmel und lässt uns zusammenfahren. Das Fahrerhaus wird vom flackernden Feuerschein des Kessels erhellt, ich erkenne den rußgeschwärzten Lokführer in der Fensteröffnung. Wir Kinder bestaunen die vielen riesigen Speichenräder, alle durch langen Eisenstangen miteinander verbunden. Weiter vorne sind zwei kleinere Räder. Darüber sehen wir ein waagerecht liegendes, fassartiges Teil, aus dem eine runde, silbern glänzende Stange herausragt, welche mit den Rädern verbunden ist. „Das ist der Zylinder mit dem Kolben drinnen!“ erklärt mein Bruder stolz, weil er das von seiner kleinen Dampfmaschine her kennt. Bisher wusste ich nur, dass der Schornsteinfeger einen Zylinder hat. Ein schwarz gekleideter Mechaniker hastet mit einer Ölkanne herum und lässt an bestimmten Stellen Öl aus deren langem Schnabel auf die Lager laufen. Im Dunkel über der Lokomotive schwenkt ein riesiges gebogenes Rohr über eine große Öffnung und ein Wasserschwall ergießt sich in das Innere der Maschine. Funken rieseln auf die Gleise und geben der Lok das Aussehen eines enormen, ruhenden Drachens. Rohrleitungen führen am Kessel entlang und verbinden die verschiedenen Teilen der Maschine.
Die Eltern ziehen uns ungeduldig weiter. Wir laufen am Kohlenwagen vorbei, in dem so viel Kohle liegt, dass wir bestimmt 100 Jahre damit heizen könnten! Dann hebt man uns die Stufen hinauf, dann die Koffer, als letztes steigt der Vater zu. Drängeln durch den engen Gang, bis wir endlich unser Abteil gefunden haben. Hier drinnen ist es mollig warm. Einen Moment bleibt das Licht weg. Aber es kommt wieder und wir machen es uns bequem. Wir finden bald heraus, dass man die braunen Sitzpolster verschieben kann, um eine Liegefläche daraus zu machen. Bald geht ein Rucken durch den Zug. Er setzt sich in Bewegung, wir ruckeln über Weichen, sehen grüne und rote Signallampen vorbeigleiten. Als die Lichter des Bahnhofs hinter uns verschwinden, bemerken wir den ersten Schein der Morgendämmerung.
Wir haben gute 12 Stunden Bahnfahrt vor uns, erklären uns die Eltern. Über Halle und Leipzig nach Dresden. Uns Kindern unbekannte Namen. Bei Helmstedt ist der Grenzübergang. Dort zeigt der Vater auf riesige Fabrikhallen, wo die Volkswagen gebaut werden. Dann hält der Zug an. Unser Vater schärft uns mehrmals ein, nichts zu sagen, uns nicht zu rühren, nicht zu streiten. Und eine Menge andere Nichts. Trotz seiner hohen Meinung vom ‚anderen‘ Deutschland scheint er deren Vertreter zu fürchten. Und schon sind sie da. Fehlt nur noch, dass wir uns ganz ausziehen müssen! Alle werden abgetastet, selbst wir Kinder. Ewig langes Abwickeln der Formalitäten. Ihre größte Sorge ist es, dass Mutter nicht mehr mit uns ausreisen darf, da sie in der Nähe von Dresden, also dem jetzigen Ostdeutschland geboren war. Dann verschwinden die ‚Vopos‘, wie die Eltern sie nennen, wieder. „Endlich sind die ‚Popos‘ weg,“ sagt mein Bruder. „Pssst! Wirst du wohl still sein! Wenn die das hören, werden wir alle eingesperrt!“ Weiter geht es. Nur in den großen Bahnhöfen hält der Zug an. Wir dürfen aber nicht aussteigen. Auf den Bahnsteigen patrouillieren dickbemäntelte, schwer bewaffnete Soldaten mit Pelzkappen auf dem Kopf. In Leipzig besteht der Bahnhof aus einer riesigen, mit Glas gedeckten Halle. Unter ihr sammelt sich der Rauch der vielen anwesenden Lokomotiven und zieht langsam durch die Öffnungen ab. Ich finde, dass eher Leipzig den Namen Halle verdient hat, und nicht die Stadt Halle, wo der Bahnhof nur Dächer über den Bahnsteigen hatte. „Wir sind in Sachsen, wo die schönen Mädchen auf den Bäumen wachsen!“ rief meine Mutter freudig aus. ‚Was - haben die hier nicht einmal einen Klapperstorch? Denen fehlt aber auch alles!‘ dachte ich mir, sagte aber nichts. Ich wollte ja auch mal wieder nach Hause kommen!
In Dresden ist dann Umsteigen und weiter geht’s bis Radeberg. Dort wartete auf dem Bahnsteig schon eine Menge Verwandte auf uns. Dann folgt ein herzliches Umarmen und Abküssen lassen von lauter fremden Leuten. Wir wurden allen vorgestellt. Zwei Jungen! Damit konnte das ‚Ruthsche‘, wie hier alle meine Mutter nannten, sich schon sehen lassen! Wir wohnten bei den Großeltern in deren ‚Mietskaserne‘. Das wundert mich, dass man eine Kaserne auch mieten kann! Ich dachte, das seien nur Wohnungen für Soldaten. Sie wohnen am ‚Hügelweg‘, auf der ‚Kohlrabi-Insel‘. Ich fand, das war eine schöne Adresse. Selbst wenn ich den Hügel nie gefunden habe. Dafür aber einen kleinen Teich mit einer glatten Eisfläche darauf.
Wir lernten unsere zwei Cousinen kennen, und den Cousin, der so hieß wie ich. Und die Onkel und Tanten und deren Nachbarn. Der Onkel Heinz war der Halbbruder meiner Mutter. Wieder dieses Wort! „Aber der ist doch ganz!“ sagte ich. Meine Mutter schaute mich verständnislos an. Dann kapierte sie. „Mein Stiefbruder, kann man auch sagen. Meine Mama und mein Papa waren schon mal verheiratet gewesen. Aber im ersten Krieg fiel der ihr Mann, und meines Papas Frau. Da jeder Kinder hatte, heirateten sie, dass die alle wieder einen Papa und Mama hatten. Weil, einer muss sich ja um die Kinder kümmern, damit der andere arbeiten gehen kann! Opa und Oma sind aber meine beiden Eltern!“ Da musste ich erst mal in Ruhe drüber nachdenken… Eigentlich wollte ich sie noch fragen, warum die Gefallenen nicht wieder aufgestanden waren. Opa hatte Magenkrebs. Man hatte ihm schon einen Großteil des Magens herausoperiert. „Wäre das nicht einfacher gewesen, den Krebs herauszunehmen, wie die Geißlein aus dem bösen Wolf, und den Magen wieder zuzunähen?“ fragte ich meine erstaunte Mutter. „Ach Junge, das verstehst du noch nicht!“
Mein Vater war in Hundekacke getreten. „So ein scheiß Köter!“ hatte gerufen und sich die Schuhsohle am Bordstein abgekratzt. Das waren gleich zwei neue Wörter für mich! Ich hüpfte herum und rief „scheiß Köter! Scheiß Köter!“ Stolz darauf, etwas Neues zu wissen. Das hätte ich lieber nicht machen sollen! Denn deshalb wurde ich ganz schön angeschnauzt. „Sowas sagen Kinder nicht! Also wandelte ich es ab in erlaubte Kindersprache. Daraus wurde dann ‚Aa-Hund‘. Das brachte die Großen dermaßen zum Lachen, und sie benannten mich manchmal mit diesem Namen. Am liebsten hätte ich ihnen gesagt: „Sowas sagen Erwachsene nicht!“
Wir fuhren Schlitten, besuchten ein Museum. Die Zeit verging zu schnell. Bis auf die mir verhassten Kaffeestunden, die sich ewig hinzogen. Wir klapperten die ganze nahe und weitere Verwandtschaft ab. In deren Wohnungen roch es anders als bei uns, obwohl sie alle gleich schlicht eingerichtet waren wie zu Hause. War das das Linoleum, die Farbanstriche, das Bratfett? „Das riecht nach Osten!“ meinte der Vater. Ich hatte bisher noch nicht gewusst, dass Himmelsrichtungen einen speziellen Geruch hatten! Auch die Gegend roch anders. Das kam wohl daher, dass man hier mit Braunkohle heizte, nicht Steinkohle, wie bei uns. Wir kamen bis Görlitz, wo die Tante Mieke wohnte. Zur Untermiete. Aber sie wohnte doch im dritten Stock! In einer Kellerwohnung wäre das klar gewesen. Wieder so ein Wort, was ich nicht kannte, aber bald schmerzhaft dessen Bedeutung kennenlernen sollte!
Nach einem nicht enden wollenden Kaffeenachmittag mit Kaffee, den wir mitgebracht hatten (daheim wurde nur sonntags Bohnenkaffee getrunken) (und auch nur von den Eltern) (wir Kinder wurden mit ‚Kaffeesurrogat- Extrakt‘ aufgezogen), und bröseligem Weihnachtsstollen, wurden wir Kinder bald ins Bett gesteckt. Wir schliefen zu viert in der Tante ihrem Ehebett. Zum Glück war der ihr Mann nicht da, er war noch nicht aus dem Krieg zurückgekehrt, sonst wäre es noch enger geworden! Die Tante passte nicht mehr da rein und schlief deshalb auf einem kleinen Sofa. Die Tante hatte nur dieses eine Zimmer gemietet, von Leuten die auch zur Miete wohnten, aber in der restlichen Wohnung. Dort befand sich auch das Klo. Nach dem Krieg und seinen Zerstörungen, waren in beiden Teilen Deutschlands die Wohnungen knapp. Vor dem Schlafenlegen waren wir alle zusammen noch schnell zum Pippi machen zu den Leuten gegangen, um sie möglichst wenig zu stören. Für später war unter dem Bett ein Goldfischglas mit Henkel. Ein Nachttopf. So etwas kannte ich noch nicht. Doch vor allen anderen da ‚reinbullern‘, wie hier der Fachausdruck hieß, war für mich schamhaft erzogenen Jungen nicht einfach. Ich wartete also ab. Andere waren aber weniger schamhaft gewesen. Und als ich es nicht mehr aushielt und es vorzog meine Schamhaftigkeit zu opfern, bevor ich die Familie mit dem Ruf eines Bettnässers lächerlich machte, weckte ich meine Mutter. „Kannst du nicht bis zum Morgen warten? Wir können doch jetzt nicht alle wecken!“ „Aber ich muss dringend!“ „Klein oder groß?“ „Klein!“ antwortete ich, obwohl ‚groß‘ bei meinem Überdruck eher zutreffend gewesen wäre. Meine Mutter zog das Goldfischglas ganz vorsichtig unter dem einer leicht geöffneten, großen Sardinendose gleichendem Bett hervor.
Da alle viel getrunken hatten und schon ihrem inneren Drang gefolgt waren, war das Glas fast voll. Ein kleiner Goldfisch hätte vielleicht noch reingepasst, aber ohne Bewegung. Doch den brauchte man gar nicht, denn das Glas schimmerte durch seinen Inhalt golden genug. Jetzt nur nichts verschütten! Das hätte mir zwar geholfen, aber um diese Zeit den Schläfern der unteren Etage eine Dusche zu verpassen… Ich kniete mich davor, vergewisserte mich, dass die Mutter nicht herschaute, und ließ ganz vorsichtig laufen. Ich kam mir vor wie in einem nicht endenden Alptraum, wenn man pinkelt und pinkelt und der Druck nimmt kein Ende. Meine Mutter äugte zu mir rüber, aber das war mir jetzt egal! „Halt! Halt an, sonst läuft es über!“ Unter größter Mühe hielt ich an. „So, das reicht! Du bist ja ein großer Junge! Den Rest kannst du morgen früh machen, wenn die Leute aufgestanden sind!“ Ganz vorsichtig, damit ja nichts daneben schwabbelte, schob sie das Gefäß wieder unter das Bett, damit auch niemand hineintreten könnte. Ich kroch wieder ins Bett und hielt mir mit der Hand das ‚Pippilein‘ zu. Ich konnte nicht schlafen und wartete zuerst auf die Morgendämmerung, dann, dass sich nebenan etwas rührte. Es war die schrecklichste Nacht meines kurzen Lebens, die schrecklichste Nacht meines ganzen Lebens überhaupt! Daran änderte auch nicht, dass wir am nächsten Tag den Viadukt, eine Art Brücke, anschauten, der die Neiße überquerte und in der Mitte mit Stacheldrahtrollen abgesperrt war. Dort drüben wohnten die ‚Pollacken‘, denen es noch schlechter ging als den Menschen hier. Soldaten patrouillierten auf der Brücke. Einer von denen pinkelte gerade über das Geländer in den Fluss. In dieser Hinsicht waren die dennoch besser dran als ich…