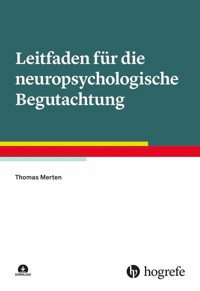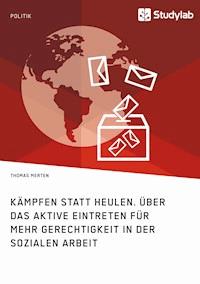
Kämpfen statt Heulen. Über das aktive Eintreten für mehr Gerechtigkeit in der Sozialen Arbeit E-Book
Thomas Merten
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Arbeitsplatzabbau, Lohndumping, Fachkräfte ohne akademischen Abschluss und Ausstieg aus Tarifverträgen. All diese Schlagworte fallen, befasst man sich mit der aktuellen Situation der Sozialen Arbeit. Sie beschreiben nicht nur Zustände, sondern stellen auch die Fachlichkeit und Qualität der Sozialen Arbeit an sich in Frage. Ein kollektiver Aufschrei bei freien Trägern, Berufsverbänden oder der Gewerkschaft bleibt jedoch aus. Fast könnte man den Eindruck gewinnen, dass vielen die Probleme zwar bekannt sind, sie aber hinsichtlich der Lösungsfindung resigniert haben. Diese Arbeit will Sozialarbeiter motivieren, aktiv für eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen einzutreten. Hierzu wird zunächst näher auf die aktuelle Situation innerhalb der Sozialen Arbeit eingegangen, die größtenteils von Wehklagen und Jammern geprägt ist. Der Autor sucht nach den Gründen für diese Situation und führt den Sozialarbeitern vor Augen, dass sie die Fähigkeiten, die sie ihren Klienten zu vermitteln versuchen, ausgerechnet für sich selbst nicht anwenden. Im Anschluss zeigt er auf, über welche Macht Sozialarbeiter verfügen und wie sie diese zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen einsetzen können. Es werden konkrete Strategien des Widerstandes vorgestellt, mit deren Hilfe sich Sozialarbeiter aktiv gegen die aktuellen Bedingungen wehren können. Aus dem Inhalt: - Das Bild der Sozialarbeit; - Prekäre Arbeitsverhältnisse; - Politische Handlungsmacht; - Gewerkschaftliche Organisierung; - Kreative Widerstandsformen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 102
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Weswegen wir jammern
1.1 Wir jammern aufgrund unserer Tradition
1.2 Wir jammern aufgrund unseres Bildes in der Öffentlichkeit
1.3 Wir jammern über Ökonomisierung und Neoliberalismus
1.4 Wir jammern über prekäre Arbeitsverhältnisse
1.5 Wir jammern aufgrund von Überlastung
2 Wir sind mächtig!
2.1 Die Bedeutung von Macht
2.2 Das macht uns mächtig
2.3 Wir sind professionell
3 Wehren wir uns!
3.1 Wir werden unterdrückt!
3.2. Schaffen wir ein kritisches Bewusstsein!
3.3 Organisieren wir uns!
3.3.1 In Gewerkschaften
3.3.2 In Mitarbeitervertretungen
3.4 Werden wir politisch!
3.4.1 In der Kommunalpolitik
3.4.2 Im Jugendhilfeausschuss
3.4.3 In Politberatung und Lobbyarbeit
3.5 Werdet wir kreativ!
Fazit
Literatur
Einleitung
Arbeitsplatzabbau, Lohndumping, Fachkräfte ohne akademischen Abschluss und Ausstieg aus Tarifverträgen. All diese Schlagworte fallen, befasst man sich mit der aktuellen Situation der Sozialen Arbeit. Das Problem hierbei ist, dass sie nicht nur Zustände beschreiben, sondern auch die Fachlichkeit und Qualität der Sozialen Arbeit an sich in Frage stellen, ein kollektiver Aufschrei bei freien Trägern, Berufsverbänden oder der Gewerkschaft aber ausbleibt. Vielmehr könnte man den Eindruck gewinnen, dass vielen die Probleme zwar bekannt sind, diese aber hinsichtlich der Lösungsfindung resigniert haben. (vgl.: Mergner 2007, S. 117-118)
Diese Bestandsaufnahme von Mergner verfestigt sich auf vielen Tagungen, Weiterbildungen oder Kongressen. Bei diesen hört man von der Mehrzahl aller Teilnehmer Klagen über zu geringe Bezahlung, über befristete Verträge und über zu viel Arbeit. Auch meine Kollegen in der Sozialpädagogischen Familienhilfe beklagen sich oftmals über die aktuellen Zustände. Fordert man sie dann jedoch auf, aktiv gegen diese vorzugehen, knicken viele ein und ertragen eher die negativen Auswirkungen. Wenn man bedenkt, dass es eine unserer zentralen Aufgaben ist, mit unseren Klienten dahingehend zu arbeiten, dass diese ihr Leben selbständig und eigenverantwortlich führen können, stelle ich mir die Frage, ob dies Personen, die nicht dazu in der Lage sind, aktiv an einer Verbesserung ihrer eigenen Arbeits- und Lebensumstände zu arbeiten, überhaupt gelingen kann. Vielmehr ist es so, dass das Bild eines Sozialarbeiters in der Öffentlichkeit und auch in Kreisen anderer Akademiker eben von diesen Kollegen geprägt wird und sich so diese negative Zuschreibung nicht nur festigt, sondern auch fortsetzt. Diesen Umstand habe ich zum Anlass für meine Arbeit genommen, der die Idee zu Grunde liegt, dass Sozialarbeiter lieber jammern und wortwörtlich heulen, statt zu handeln und für sich selbst und den Berufsstand zu kämpfen. Ich bin der Überzeugung und vertrete die These, dass man, um erfolgreich für eine bessere soziale Arbeit zu kämpfen, vielen Sozialarbeitern klar machen müsste, welche Macht und Bedeutung sie haben. Wenn ihnen dies bewusst wäre, würden viel mehr Kollegen aktiv werden und versuchen, etwas zu ändern. Da aber den meisten ihre Macht und auch ihre gesellschaftliche Bedeutung nicht bewusst ist, fällt es ihnen auch schwer, aus der Position des Jammernden herauszukommen. Gerade die Anerkennung der eigenen Professionalität und Macht ist aber die unabdingbare Voraussetzung dafür, sich zu wehren und aktiv gegen gesellschaftliche Ungerechtigkeiten vorzugehen.
Bei meinen Recherchen ist mir aufgefallen, dass fast alle Autoren beschreiben, wie man als Sozialarbeiter für die Klienten einstehen kann, wie man für diese etwas verändern kann und wie man sich gegen das bestehende System einsetzt, um Verbesserungen für die Gemeinschaft zu erwirken. All dies sind gute und auch wichtige Punkte die soziale Arbeit ausmachen. Dennoch war ich ein wenig erschrocken, kaum Ansätze zu finden, wie man sich selbst gegen Ungerechtigkeiten im politischen System wehrt beziehungsweise wie man dieses in Richtung eines wertschätzenderen Umgangs mit sozialer Arbeit verändert. Das Positive an allen Vorschlägen hinsichtlich einer positiven Veränderung zu Gunsten der Klienten ist, dass man diese auch wunderbar auf die Sozialarbeiter selbst anwenden kann, da auch diese in der aktuellen Zeit von Armut und Ausbeutung bedroht sind. Somit möchte ich mit dieser Arbeit auch versuchen, Sozialarbeitern vor Augen zu führen, wie es aktuell um die Profession bestellt ist, und sie ermutigen, dem öffentlichen Bild von Sozialarbeitern entgegenzutreten, um etwas zu verändern. Dementsprechend habe ich die Überschriften der Kapitel so gewählt, dass sie zum einen mich mit einschließen, da auch ich nicht gegen Jammern immun bin, und zum anderen einen klaren Aufforderungscharakter haben, der Kollegen zum Handeln ermuntert.
1 Weswegen wir jammern
In diesem Kapitel habe ich versucht, Gründe zusammenzutragen, über die viele Kollegen und auch ich aktuell jammern und klagen. Beginnen werde ich dabei mit dem Grund, auf dem aus meiner Sicht alle anderen Gründe aufbauen. Dieser ist die Tradition der Sozialen Arbeit. Aufgrund dieser ist über die Jahrzehnte ein öffentliches Bild von sozialer Arbeit entstanden, welches wiederum dazu führt, dass wir uns heute der fortschreitenden Ökonomisierung unterwerfen. Diese Unterwerfung hat die Folge, dass wir schlecht bezahlt werden und dass wir überarbeitet sind. Wie bereits geschrieben werde ich im folgenden Punkt die Entwicklung der Sozialen Arbeit darlegen, die in meinen Augen ursächlich für viele weitere Probleme des Berufsfeldes ist.
1.1 Wir jammern aufgrund unserer Tradition
Die soziale Arbeit hat, im Gegensatz zu anderen Professionen, keine lange Tradition. Sie entstand mit der zunehmenden Industrialisierung im neunzehnten Jahrhundert. Hier war eine ihrer Hauptaufgaben, die Begleiterscheinungen des zunehmenden Kapitalismus zu entschärfen. Sie übernahm somit Aufgaben, die früher beispielsweise von kirchlichen Wohltätigkeitsverbänden übernommen wurden. Diese hatten bereits in den vergangenen Jahrhunderten über Zucht- und Armenhäuser oder aber auch Waisenhäuser versucht, die Gesellschaft zu disziplinieren und die staatliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Diese zuerst noch überschaubaren Auswüchse der beginnenden Urbanisierung und Industrialisierung wuchsen im neunzehnten Jahrhundert immer mehr an und führten dazu, dass Armut und Elend immer breitere Gesellschaftsschichten betrafen und dies nun zu einer Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden wurde. In dieser Zeit liegen die Wurzeln der Sozialen Arbeit. Die ersten nachweisbaren Sozialarbeiter konnte man beispielsweise in Elberfeld finden. Hier wurde 1853 eine neue Armenversorgung aufgebaut, die den Einsatz von kommunalen, ehrenamtlichen Armenpflegern vorsah, die innerhalb der Bevölkerung den Hilfebedarf ermittelten, um die Betroffenen schnell in Arbeit zu vermitteln, um die materielle Unterstützung zurückfahren zu können. Später wurde dann das so genannte „Straßburgersystem“ eingeführt, bei dem die Ehrenamtler durch Beamte ersetzt wurden. Die folgenden Jahrzehnte brachten die Sozialgesetzgebung und die Entstehung von Wohltätigkeitsverbänden und Vereinen wie der AWO und der Caritas. Mit deren Entstehung differenzierte sich das Hilfesystem aus. Auf der einen Seite fand man nun die sozialpolitische und bürokratisch organisierte Versicherung und auf der anderen die privat organisierte Hilfe der Verbände. Dies führte dazu, dass es um die Jahrhundertwende nun die ersten vollberuflichen Sozialarbeiter gab. Vor und mit dem ersten Weltkrieg entwickelte sich der Bereich zu einer Frauendomäne, da die soziale Hilfe für Frauen eine Chance darstellte, sich beruflich zu engagieren und dies mit einer akademischen Ausbildung zu verbinden. Die Folgen des ersten Weltkriegs stellten die soziale Arbeit vor große Herausforderungen, da viele Menschen in Not und Elend lebten. Einen weiteren Aufschwung erlebte die Profession durch die Weimarer Republik. In dieser wurden soziale Grundrechte gesetzlich verankert und Kinder und Jugendliche bewusst staatlich gefördert. Dies führte unter anderem zur Einrichtung von Jugendämtern. 1922 wurde diesbezüglich das Reichswohlfahrtsgesetz geschaffen, welches die öffentliche und freie Jugendhilfe organisierte. Diese erfreulichen Entwicklungen fanden mit der Machtübernahme der Nazis eine jähes Ende, da durch diese alle Organisationen, die neben der Volkswohlfahrt bestanden, ausgeschaltet wurden.
Nach dem zweiten Weltkrieg verlief die Entwicklung in den beiden deutschen Staaten unterschiedlich. Während in der DDR die soziale Arbeit in die Bildungspolitik überging und sozialpädagogische Hilfestellungen ehrenamtlich organisiert waren, prägten in der BRD die in der Nazizeit ausgewanderten und nun zurückkommenden Sozialarbeiter die Profession. Mit den in den USA erworbenen Arbeitsweisen und Methoden veränderten sich auch der Arbeitsansatz und das Arbeitsfeld. An die Seite des Jugendamtes und der Wohlfahrt traten nun Nachbarschaftshäuser, Gruppenarbeit und Gemeinwesensarbeit. Zudem wurden der Sozialstaat und auch die soziale Arbeit nach und nach ausgebaut. Das Hauptaugenmerk lag nun auf der Lebenswelt der Menschen. Zudem standen besonders in den sechziger Jahren Chancengleichheit und Absicherung im Mittelpunkt der Politik, was zu einem immensen Aufschwung der Sozialen Arbeit führte. In dieser Zeit entstanden auch die Sozialpädagogische Familienhilfe, Frauenhäuser, Obdachlosenhilfe und Mobile Jugendarbeit. Aufgrund der Kritik an dem bevormundenden Stil innerhalb vieler Heime lag nun der Hauptschwerpunkt von sozialer Arbeit auf ambulanten Hilfen. (vgl.: Seithe 2007, S. 39-47)
Betrachtet man diese Entwicklung der Sozialen Arbeit, so kann man festhalten, dass diese bis in die siebziger Jahre durchweg positiv verlief. In den achtziger und neunziger Jahren setzte dann eine zunehmende Professionalisierung ein, die bis heute immer weiter voranschreitet. (vgl.: ebd.: S. 38) Hinzu kommt, dass durch diese Entwicklungen der beschriebene Korporatismus früherer Tage zunehmend durch Wettbewerb zwischen den Trägern ersetzt wird. (vgl.: Dahme 2007, S. 22) Dies und auch die zunehmende Dokumentationspflicht führen dazu, dass aktuell Beziehungsarbeit in der Sozialen Arbeit eher klein geschrieben wird und betriebswirtschaftliche Kennziffern dominieren. Zu diesem Aspekt werde ich mich jedoch nochmals in Kapitel 1.3. ausführlicher äußern. Die skizzierte positive Entwicklung bis weit in die siebziger Jahre hinein scheint die von mir aufgestellte Hypothese, dass hierin ein Grund für das Jammern einer ganzen Profession liegt, erst einmal zu widerlegen. Die geschichtliche Entwicklung, mit ihren Ursprüngen im kirchlich-karitativen Kontext, hat laut Mergner dazu geführt, dass es sich bei der Profession um eine bescheidene und wenig politische handelt, die sich oftmals nur zum Helfen verpflichtet sieht. (vgl.: Mergner 2007, S. 118) Sie wird aus meiner Sicht somit auch kaum von der Öffentlichkeit wahrgenommen, was wiederum dazu führt, dass viele „wichtige“ Personen in Politik und Wirtschaft kaum Notiz von ihr nehmen.
Mergner verweist zudem darauf, dass die Geschichte der Profession zur Herausbildung eines „kollektiven Sozialcharakters“ geführt hat, dessen Züge man bei vielen Sozialarbeitern findet. So zeichnen sich diese oftmals nicht durch offensive Interessenvertretung aus, sondern vielmehr durch eine erlernte Hilflosigkeit, die auch eine weitgehende Identifikation mit den eigenen Klienten beinhaltet und so zu einem Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber äußeren Einflüssen führt. Zusätzlich attestiert er diesem „Sozialcharakter“ ein Gefühl der fehlenden Wertschätzung für die eigene Arbeit, das zu einem Rückzug und zu einer klagenden Hinnahme führt. (vgl.: ebd.: S. 119-121) Hinzu kommt meiner Meinung nach, dass die von Beginn an bestehende Organisation in Wohlfahrtsverbänden dazu geführt hat, dass diese und somit auch die Personen, die innerhalb der Träger arbeiten, sich kaum mit wirtschaftlichen Themen und dem aufkommenden Neoliberalismus befasst haben und nun vollkommen von den aktuellen Entwicklungen überrascht sind und sehr unter diesen leiden. Kurz gesagt führt die Tradition der Sozialen Arbeit dazu, dass auch heute noch mehr Wert auf das Helfen und Unterstützen gelegt und das Wirtschaftliche vollkommen außer Acht gelassen wird. Da dies aber unter den aktuellen Bedingungen kaum noch möglich ist, haben es viele Sozialarbeiter sowie ihre jeweiligen Träger schwer, in dem aktuellen wirtschaftlichen System zu bestehen.
Die enormen Fortschritte hinsichtlich der verschiedenen Bereiche, in denen die soziale Arbeit aktiv wird, und die zunehmende Professionalisierung wurden jedoch kaum der Öffentlichkeit bekannt gemacht, wodurch ein Bild der Profession entstand, welches bis heute noch gültig ist und welches ich im Folgenden darstellen möchte, da hierin ein zweiter Grund des Jammerns von Sozialarbeitern liegt.