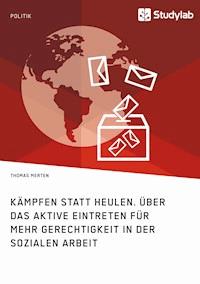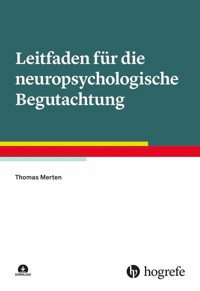
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Begutachtung von Personen mit geltend gemachten oder vermuteten kognitiven Funktionsstörungen im Rahmen von Erkrankungen oder Verletzungen des Gehirns stellt ein wichtiges neuropsychologisches Arbeitsgebiet dar, das neben der fachlichen Expertise ein breites gutachtliches Spezialwissen erfordert. Auftraggebern und Angehörigen anderer Berufsgruppen soll durch eine Einführung in die testbasierte Befunderhebung und die Grundlagen normativer Interpretationen ermöglicht werden, neuropsychologische Ergebnisse besser nachvollziehen zu können. Der Band behandelt alle Aspekte, die für die neuropsychologische Sachverständigentätigkeit von Bedeutung sind, von Qualifikationsvoraussetzungen und der Auftragsannahme bis zur Erstellung einer Kostenrechnung. Der Aufbau eines schriftlichen Gutachtens wird Schritt für Schritt erläutert. Zahlreiche Materialen können nach erfolgter Registrierung von der Website des Hogrefe Verlags heruntergeladen werden und in adaptierter Weise für die eigene Gutachtenerstellung genutzt werden. Neben einer Erörterung der Kausalitätsregeln, die bei Zusammenhangsgutachten gelten, werden auch Besonderheiten in wichtigen Anwendungsgebieten des Sozial-, Zivil- und Verwaltungsrechts dargestellt. Schließlich ergänzen fünf Exkurse die Darstellung um einen Einblick in spezielle Fragen der neuropsychologischen Begutachtung (Interkulturelle oder kultursensitive Begutachtung; Begutachtung von Kindern und Jugendlichen; Begutachtung der Geschäfts- und Testierfähigkeit; Begutachtung von Erwachsenen mit ADHS; Leichtes Schädel-Hirn-Trauma).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Thomas Merten
Leitfaden für die neuropsychologische Begutachtung
unter Mitarbeit von Thomas Bodner, Anselm Fuermaier, Rainer John und Oliver Tucha
Dr. Thomas Merten, geb. 1959. 1981 – 1986 Studium der Klinischen Psychologie in Berlin. 1991 Promotion. 2000 Habilitation. Seit 1992 Tätigkeit im Klinikum im Friedrichshain; seit 1993 umfassende Lehrtätigkeit, u. a. Humboldt-Universität zu Berlin, Universität Leipzig, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Psychologische Hochschule Berlin; seit 1994 Gutachtentätigkeit. Forschungsschwerpunkte: Testentwicklung und angewandte Testdiagnostik, neuropsychologische Diagnostik, Beschwerdenvalidierung, psychologische Begutachtung im Zivil-, Sozial- und Verwaltungsrecht.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Alle Rechte, auch für Text- und Data-Mining (TDM), Training für künstliche Intelligenz (KI) und ähnliche Technologien, sind vorbehalten. All rights, including for text and data mining (TDM), Artificial Intelligence (AI) training, and similar technologies, are reserved.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
www.hogrefe.de
Satz: Mediengestaltung Meike Cichos, Göttingen
Format: EPUB
1. Auflage 2025
© 2025 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3242-7; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3242-8)
ISBN 978-3-8017-3242-4
https://doi.org/10.1026/03242-000
Nutzungsbedingungen:
Durch den Erwerb erhalten Sie ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernt werden.
Das E-Book darf anderen Personen nicht – auch nicht auszugsweise – zugänglich gemacht werden, insbesondere sind Weiterleitung, Verleih und Vermietung nicht gestattet.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet umrandete Seitenzahlen (Beispiel: 1) und in einer Seitenliste, die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Übersicht
Cover
Titel
Über die Autor:innen
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Vorwort
Inhalt
VInhaltsverzeichnis
Leitfaden für die neuropsychologische Begutachtung
Abkürzungsverzeichnis
Vorwort
Teil I: Einführung und Überblick
1
Gutachten und Sachverständige, Abgrenzung zu Befundberichten
1.1
Gutachten und Sachverständige, Grundbegriffe
1.2
Befundberichte als Zuarbeit für Gutachten anderer Disziplinen
2
Auftraggeber und Fragestellungen zur neuropsychologischen Begutachtung
3
Neutralität, Aufgaben und Qualifikation des Sachverständigen
3.1
Aufgaben des Sachverständigen und Gebot der Unparteilichkeit
3.2
Qualifikation des neuropsychologischen Sachverständigen
3.3
Besorgnis der Befangenheit
3.4
Gutachtervorschläge und Gutachterwahlrecht
Teil II: Vorbereitung und Durchführung der Begutachtung
4
Vorbereitung auf die Gutachtenerstellung
4.1
Erstsichtung des Auftrags und der Unterlagen
4.2
Vertiefende Aktensichtung
4.3
Terminplanung und Einladung
4.4
Nichterscheinen und Untersuchungsverweigerung
4.5
Vorabkommunikation durch den Probanden
5
Die gutachtliche Untersuchung
5.1
Kontaktaufnahme und informierte Einwilligung
5.2
Anwesenheit von Begleitpersonen in der Begutachtung
5.3
Fremdanamnese
5.4
Untersuchungen mithilfe von Dolmetschern
5.5
Gestaltung der gutachtlichen Untersuchung
5.6
Schwierige Probanden und Problemkonstellationen
5.7
Ergebnismitteilung und Rückmeldungen an die Probandin
Teil III: Aufbau eines schriftlichen Gutachtens
6
Aufbau und Gestaltung eines Gutachtens im Überblick und im Detail
6.1
Grundaufbau
6.2
Sprachstil und formale Gestaltung
6.3
Deckblatt und einleitende Bemerkungen
6.4
Informationen nach Aktenlage
6.5
Eigene Befunde
6.5.1
Exploration, Krankheitsanamnese
6.5.2
Entwicklungs-, Bildungs-, Berufs-, Sozialanamnese und die Schätzung der prämorbiden kognitiven Leistungsvoraussetzungen
6.5.3
Beschwerdenschilderung
6.5.4
Verhaltensbeobachtungen und psychopathologischer Befund
6.5.5
Testergebnisse und Fragebogendiagnostik
6.6
Beurteilung und Beantwortung der Fragestellungen
6.6.1
Zusammenfassende (epikritische) Darstellung und Beurteilung
6.6.2
Beantwortung der Fragestellungen
6.7
Abschließende Bemerkungen
6.8
Nach Abschluss des Gutachtens
Teil IV: Der psychologische Test, die normative Beurteilung und Beschwerdenvalidierung
7
Der psychologische Test
7.1
Leistungstests, neuropsychologische Tests
7.1.1
Definition und Überblick
7.1.2
Anwendungsbeschränkungen
7.1.2.1
Siebtests und ihre begrenzte Aussagefähigkeit
7.1.2.2
Einfluss unzureichender Anstrengungsbereitschaft auf Testleistungen
7.1.2.3
Bereichsspezifische Eignung von Verfahren
7.2
Fragebögen
7.3
Projektive Verfahren
7.4
Gütekriterien von Tests
7.5
Der Daubert-Standard in den USA
8
Psychologische Testnormen und klassifikationsbasierte Diagnostik
8.1
Verteilungsnormen und Prozentränge
8.2
Klassifikationsbasierte Diagnostik und die Verwendung von Grenzwerten
8.3
Erläuterung des Normenbezugs im Gutachten
8.4
Alternative Interpretationsansätze
8.5
Interpretationsrichtlinien für nicht normalverteilte Merkmale
9
Beschwerdenvalidierung, Konsistenz- und Plausibilitätsprüfung
9.1
Beschwerdenvalidierung
9.2
Auftretenshäufigkeit nicht glaubhafter Beschwerdendarstellungen
9.3
Konsistenz- und Plausibilitätsanalyse
9.4
Kognitive Beschwerdenvalidierungstests
9.5
Eingebettete kognitive Validitätsindikatoren
9.6
Kontrollskalen zur Validitätsprüfung in der Beschwerdenschilderung
9.7
Bewertung von Ergebnissen der Beschwerdenvalidierung
Teil V: Weitere wichtige Aspekte der Begutachtung
10
Zustands- und Zusammenhangsgutachten
10.1
Unterscheidung von Zustands- und Zusammenhangsgutachten
10.2
Kausalität
10.3
Die Äquivalenztheorie oder Bedingungstheorie
10.4
Die Relevanztheorie oder Lehre von den wesentlichen Bedingungen
10.5
Die Adäquanztheorie oder Theorie von der adäquaten Bedingung
11
Qualitätsstandards von Gutachten
11.1
Systematik von Qualitätsstandards
11.2
Leitlinienbezug und Standards der Begutachtung
11.3
Probleme der realen Gutachtenqualität und häufige Fehlerquellen
11.4
Fallstricke bei der neuropsychologischen Begutachtung
12
Liquidation von Gutachten
13
Gutachterhaftung
Teil VI: Wichtige Anwendungsgebiete neuropsychologischer Gutachten
14
Neuropsychologische Gutachten in unterschiedlichen Rechtsbereichen
14.1
Einleitung: Kenntnis der Besonderheiten des jeweiligen Rechtsbereichs
14.2
Sozialrechtliche Anwendungsgebiete
14.2.1
Gesetzliche Unfallversicherung
14.2.2
Gesetzliche Rentenversicherung
14.2.3
Schwerbehindertenrecht
14.2.4
Soziales Entschädigungsrecht
14.3
Zivilrechtliche Anwendungsgebiete
14.3.1
Private Unfallversicherung
14.3.2
Kfz-Haftpflicht
14.3.3
Private Berufsunfähigkeitsversicherung
14.4
Verwaltungsrechtliche Anwendungsgebiete
14.4.1
Beamtenrechtliche Begutachtung
14.4.2
Berufsständische Versorgungswerke
Teil VII: Exkurse
15
Interkulturelle oder kultursensitive Begutachtung
15.1
Begutachtung im interkulturellen Kontext
15.2
Besonderheiten in der Untersuchungsdurchführung
15.3
Hauptprobleme der neuropsychologischen Begutachtung
15.4
Schwierigkeiten bei der Testauswahl und Verwendung verfügbarer Normen
15.5
Zusammenfassung und Ausblick
16
Besonderheit der neuropsychologischen Begutachtung von Kindern und Jugendlichen
16.1
Fallvignette
16.2
Potenzielle Begutachtungskontexte
16.3
Voraussetzungen für die Sachverständigentätigkeit
16.4
Ablauf der neuropsychologischen Begutachtung
16.5
Prognostische Beurteilung von Entwicklungsverläufen
16.6
Zusammenfassung
17
Neuropsychologische Besonderheiten bei der Begutachtung der Geschäfts- und Testierfähigkeit
17.1
Begrifflichkeiten und Kernaufgabe des Sachverständigen
17.2
Neuropsychologische Sachverständigentätigkeit in den genannten Bereichen
17.3
Erschwerte Untersuchungsbedingungen
17.4
Rückwirkende Beurteilung der Geschäfts- oder Testierfähigkeit
17.5
Beschwerdenvalidierung bei Fragen zur Prüfung der Geschäftsfähigkeit
18
Die neuropsychologische Begutachtung von Erwachsenen mit ADHS
18.1
Falsch-negative und falsch-positive Diagnosen
18.2
Selbst- und Fremdbeurteilungsfragebögen zur Erfassung von ADHS-Symptomen
18.3
Beurteilung von Beeinträchtigungen im Alltag
18.4
Neuropsychologische Testverfahren
18.5
Beschwerdenvalidierung
18.6
ADHS im Kontext eines psychologischen Gutachtens
19
Leichtes Schädel-Hirn-Trauma
19.1
Definition und Besonderheiten der Begutachtung
19.2
Diagnostische Kriterien
19.3
Einfache und komplizierte leichte Schädel-Hirn-Verletzungen
19.4
Traumatische axonale Schädigungen
19.5
Wichtige Gesichtspunkte bei der Begutachtung
20
Schlusswort – und ein Ausblick für künftige Sachverständige
Literatur
Anhang
Hinweise zu den Online-Materialien
Sachregister
Abbildungsverzeichnis
Kasten 1: Beispiel für eine schriftliche Einladung, mit Anmerkungen
Kasten 1: Fortsetzung
Kasten 2: Beispielvorlage für eine informierte Einwilligung
Kasten 2: Fortsetzung
Kasten 3: Grundgliederung eines neuropsychologischen Gutachtens
Kasten 4: Beispielhafte Empfehlungen, wie Fachbegriffe zur Gewährleistung der Lesbarkeit und damit Nachvollziehbarkeit eines Gutachtens umgesetzt werden können
Kasten 5: Wichtige Rahmeninformation zum Gutachten, die auf dem Deckblatt dargestellt werden sollte
Kasten 6: Vorschlag für einen Anamnesebogen
Kasten 6: Fortsetzung
Kasten 7: Vorschlag für die Form, in der standardisierte Verfahren und die zugehörigen Testergebnisse im Gutachten dargestellt werden können
Kasten 8: Vorschlag für eine tabellenförmige Auflistung aller als relevant erachteten quantitativen Untersuchungsergebnisse
Kasten 9: Beispiel für die Erläuterung der verwendeten Normen und ihre Interpretation im Rahmen eines Gutachtens
Kasten 10: Beispielrechnung im Rahmen der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) bzw. Psychotherapeut*innen (GOP)
Kasten 11: Beispielrechnung im Rahmen des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG)
Kasten 12: Auszüge aus der Versorgungsmedizinverordnung, Anlage zu § 2, zur Bemessung von Hirnschäden
Kasten 13: Hypothetische Fallkonstellation und Ableitung einer vorgeschlagenen Invalidität von 30 %
Kasten 14: Beispielhafter Fragenkatalog im Gutachtenauftrag einer Kfz-Haftpflichtversicherung
Kasten 15: Beispiel für ein im Gutachtenauftrag mitgeteiltes Tätigkeitsprofil, das der Beurteilung zugrunde zu legen ist
Kasten 16: Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER)
Kasten 17: Zusammenfassung der wichtigsten Information in den neuen Diagnosekriterien für leichte Schädel-Hirn-Traumen
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Beispiele für Auftraggeber neuropsychologischer Gutachten, die in verschiedenen Rechtsbereichen und zu verschiedenen rechtlich relevanten Fragestellungen angesiedelt sind
Tabelle 2: Aufgaben und Rolle der Sachverständigen, in Abgrenzung zu einer Behandlerrolle
Tabelle 3: Neuropsychologisch bedeutsame Funktionsbereiche und Testbeispiele (Auswahl)
Tabelle 4: Siebtests und Kurztests, die teils auch häufig in Gutachtenkontexten eingesetzt werden (Auswahl)
Tabelle 5: Beispiele für Fragebogenverfahren in unterschiedlichen Erfassungsbereichen
Tabelle 6: Auswahl projektiver Verfahren
Tabelle 7: Häufig verwendete Normen für psychologische Tests
Tabelle 8: Wichtige Grundbegriffe zur Beschreibung der Güte von Verfahren der klassifikationsbezogenen Diagnostik
Tabelle 9: Einordnung von Testleistungen in einer Dichotomie von normgerechten und gestörten Leistungen
Tabelle 10: Klassifikationssystem von Wechsler zur Interpretation von Normwerten
Tabelle 11: Klassifikationssystem nach Heaton zur Interpretation von Normwerten
Tabelle 12: Klassifikationssystem von Guilmette et al. (2020) zur Interpretation von Normwerten
Tabelle 13: Kognitive Beschwerdenvalidierungstests, die zur Überprüfung der Validität der ermittelten Profile in Leistungstests herangezogen werden können
Tabelle 14: Eingebettete Indikatoren für die kognitive Beschwerdenvalidierung (Auswahl)
Tabelle 15: Antworttendenzen, die die standardisierte Selbstbeurteilung in Fragebögen beeinflussen können
Tabelle 16: Im deutschen Sprachraum einsetzbare fragebogenbasierte Beschwerdenvalidierungstests sowie Persönlichkeitsfragebögen mit integrierten Validitätsskalen
Tabelle 17: Mögliche Ursachen und Kontexte für das Auftreten negativer Antwortverzerrungen in der Begutachtung
Tabelle 18: Zustand- und Zusammenhangsgutachten, Beispiele aus verschiedenen Rechtsgebieten
Tabelle 19: Bewertung von gesundheitsbedingter Einschränkung der Leistungsfähigkeit nach verschiedenen Bemessungsgrundlagen
Tabelle 20: Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) für die Gesetzliche Unfallversicherung – zusammenfassende Beschreibungen in Anlehnung an Wurzer (1992, S. 188 f.)
Tabelle 21: Anforderungen an spezifisch neuropsychologische Kompetenzen in Abhängigkeit von Diagnosegruppen
Tabelle 22: Diagnosekriterien für das leichte Schädel-Hirn-Trauma
V
1
2
3
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
83
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
157
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
245
247
249
1Abkürzungsverzeichnis1
ABGB = Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (Österreich)
AUB = Allgemeine Unfallversicherungsbedingungen
AWMF = Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften
BayObLG = Bayerisches Oberstes Landesgericht
BdL = Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit
BeamtStG = Beamtenstatusgesetz
BeamtVG = Beamtenversorgungsgesetz
BGB = Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl. = Bundesgesetzblatt (Österreich)
BGH = Bundesgerichtshof
BRAO = Bundesrechtsanwaltsordnung
BSG = Bundessozialgericht
BTHG = Bundesteilhabegesetz
BU = Berufsunfähigkeit
BVerfG = Bundesverfassungsgericht
BVerwG = Bundesverwaltungsgericht
BVG = Bundesversorgungsgesetz
DGUV = Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
GdB = Grad der Behinderung
GdS = Grad der Schädigungsfolgen
GDV = Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft
GNP = Gesellschaft für Neuropsychologie
GOÄ = Gebührenordnung für Ärzte
GOP = Gebührenordnung für Psychotherapeut*innen
2GRV = Gesetzliche Rentenversicherung
GUV = Gesetzliche Unfallversicherung
IfSG = Infektionsschutzgesetz
JVEG = Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz
KG = Kammergericht
LBG = Landesbeamtengesetz
LG = Landgericht
LSG = Landessozialgericht
MdE = Minderung der Erwerbsfähigkeit
MDK = Medizinischer Dienst der Krankenkassen
OEG = Opferentschädigungsgesetz
OLG = Oberlandesgericht
OVG = Oberverwaltungsgericht
PUV = Private Unfallversicherung
RLV = Restleistungsvermögen
SchwbAwV = Schwerbehindertenausweisverordnung
SED-UnBerG = SED-Unrechtsbereinigungsgesetz
SGB = Sozialgesetzbuch
SGB V = Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (Gesetzliche Krankenversicherung)
SGB VI = Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (Gesetzliche Rentenversicherung)
SGB VII = Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (Gesetzliche Unfallversicherung)
SGB VIII = Sozialgesetzbuch Achtes Buch (Kinder- und Jugendhilfe)
SGB IX = Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen)
SGB X = Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz)
SGB XIV = Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch (Soziale Entschädigung)
SGG = Sozialgerichtsgesetz
SVG = Soldatenversorgungsgesetz
UrhG = Urheberrechtsgesetz
UStG = Umsatzsteuergesetz
UV-GOÄ = Gebührenordnung für Ärzte – Gesetzliche Unfallversicherung mit Krankenhaus-Nebenkostentarif
3VersMedV = Versorgungsmedizinverordnung
VVG = Versicherungsvertragsgesetz
ZPO = Zivilprozessordnung
1
Nicht aufgenommen wurden Abkürzungen für medizinische Sachverhalte und für Testverfahren sowie allgemeinsprachlich bekannte Abkürzungen.
5Vorwort
Seit dem Erscheinen der ersten eigenständigen deutschsprachigen Buchveröffentlichung zur neuropsychologischen Begutachtung (Hartje, 2004) und einer umfassenderen Darstellung durch Wilhelm und Roschmann (2007) hat sich das Gutachtenwesen in den deutschsprachigen Ländern enorm verändert. Bedeutsame positive Entwicklungen sind auch für die neuropsychologische Begutachtung festzustellen. Für diesen Bereich sind weitreichende Initiativen auf internationaler Ebene, besonders aus den USA und Kanada, von Bedeutung, die zur Veröffentlichung einer Vielzahl von Positionspapieren und anderen Arbeiten zu gutachtenrelevanten Themen führten. Auch in Deutschland haben sich die gutachtlichen Standards, die neben zahllosen Veröffentlichungen in eine allgemeine (Marx et al., 2019) und zahlreiche spezifische Leitlinien zur Begutachtung mündeten, in den letzten zwei Jahrzehnten ganz erheblich verfeinert, was die mittlere Qualität von Gutachten vermutlich ebenso erheblich angehoben hat. Für viele gutachtliche Bereiche, die Neuropsychologie inbegriffen, weisen zudem von Fachverbänden und Heilberufekammern vorgenommene Zertifizierungen zumindest formal aus, dass eine spezifische Zusatzqualifikation für die Sachverständigentätigkeit erworben wurde.
Zusätzlich zur Komplexität des Fachgebiets der Klinischen Neuropsychologie stellt die Begutachtung, also die sachverständige Anwendung des Fachs in einem rechtsrelevanten Kontext, große Herausforderungen an jede Fachvertreterin, denn das dazu notwendige Wissen stellt sich ähnlich umfangreich und komplex dar und weist darüber hinaus eine bedeutsame zeitliche Dynamik auf, die u. A. durch Gesetzesänderungen, aktualisierte Verordnungen und die laufende höhere Rechtsprechung bedingt ist. Der vorgelegte Band versucht, wesentliche Aspekte des Wissens, über das eine neuropsychologische Gutachterin neben ihrer hohen fachlichen Qualifizierung verfügen sollte, zusammenzustellen und systematisch zu ordnen, gleichzeitig aber auch Mediziner, Juristen sowie Verwaltungen und andere Auftraggeber von neuropsychologischen Gutachten zu befähigen, diese besser zu verstehen und nachvollziehen zu können. Auch psychologische Sachverständige, die nicht neuropsychologisch tätig sind, sollten, so ist zu wünschen, zahlreiche Anregungen in diesem Band finden.
6Aufgrund der Heterogenität der angezielten Leserschaft ist in Kauf zu nehmen, dass nicht jedes Kapitel für jeden potenziellen Leser von Interesse sein wird oder in Gänze nachvollzogen werden kann. Gleichwohl ist zu hoffen, dass der Band sowohl für den Fachlaien wie für die Fachvertreterin, für den gutachtlichen Anfänger wie für Fortgeschrittene Lesenswertes enthält. Durch eine Reihe von Materialien und Vorlagen, die in der Regel in Form von Kästen Darstellung finden, soll die mühevolle, oft über Jahre hinweg notwendige Erarbeitung von Routinen und Ressourcen erleichtert werden.
Der Text fokussiert auf gutachtlich relevante Fragen und Probleme, ohne im Einzelnen auf die eigentlich neuropsychologischen Grundlagen der funktionellen Hirnmorphologie und der neuropsychologischen Störungslehre einzugehen, ebenso wie eine Beschreibung von relevanten Krankheiten und Verletzungen, die Grundlagen der Diagnostik, Therapie und Prognosestellung keine Darstellung finden. Die ausweisbare Beherrschung des Fachs ist Voraussetzung dafür, überhaupt auf neuropsychologischem Gebiet gutachtlich tätig zu werden. Eine ausführliche Darstellung der Natur von Testverfahren und der Normierung wurde in den Text aufgenommen, insbesondere um Nicht-Psychologen in der anvisierten Leserschaft einen vertiefenden Einblick in diese zentrale Methode der Datengewinnung zu geben.
Der Text basiert auf mehr als drei Jahrzehnten gutachtlicher Tätigkeit mit einer wohl vierstelligen Zahl übernommener neuropsychologischer und klinisch-psychologischer Gutachtenaufträge, die vorwiegend von institutionellen Auftraggebern stammten (Gerichte der Sozial-, Zivil-, Verwaltungs- und Strafgerichtsbarkeit, Behörden und Verwaltungen, private und Sozialversicherungen), deutlich seltener von Anwälten und Privatpersonen. Im Laufe der Zeit wurden zahllose Quellen in der deutschsprachigen und internationalen Literatur konsultiert, es erfolgte ein kontinuierlicher Austausch mit Fachkolleginnen, Juristen und Ärztinnen, besonders intensiv im langjährig aktiven Arbeitskreis Begutachtung der Berliner Gesellschaft für Psychiatrie und Neurologie wie auch in der Kommission Sachverständigentätigkeit an der Landespsychotherapeutenkammer Berlin. Beim Literaturverzeichnis wurde der Fokus mehr auf die weiterführende Literatur denn auf den Beleg jeder einzelnen getroffenen Aussage und jeder gegebenen Empfehlung gelegt. Verweise auf die Gesetzgebung und die höhere Rechtsprechung finden sich in Form von Fußnoten hinzugefügt. Im Teil IV wurden jeweils nur wenige Beispieltests zitiert und in das Literaturverzeichnis aufgenommen, was mit Verweis auf einschlägige verfügbare Testkompendien (z. B. Dohrenbusch, 2015; Schellig, Drechsler, Heinemann & Sturm, 2008; Strauss, Sherman & Spreen, 2006) sinnvoll erschien.
Nur wo nicht gearbeitet wird, heißt es, würden keine Fehler begangen. Die Liste möglicher Fehler in der Begutachtung und in der Abfassung der Schriftform eines Gutachtens ist lang und reicht von banalen und lässlichen Fehlern bis zu schlim7men, unerfreulichen und unverzeihlichen. Wenn ein Sachverständiger etwa in einem Unfall- oder Rentengutachten den verbliebenen Schaden als Grad der Behinderung (GdB) ausweist und obendrein in Prozent graduiert, weist dies sicherlich einen nicht nur banalen Kenntnismangel bei ihm aus, doch ein solcher Fehler macht die Verwertbarkeit eines Gutachtens nicht prinzipiell unmöglich (sofern nicht andere substanzielle Fehler dies bedingen). Bei der Komplexität des Arbeitsgebiets ist eine komplette Abwesenheit von Mängeln auch eher selten zu erwarten. Wichtig sind eine angemessene Fehlerkultur, die Bereitschaft, aus eigenen Fehlern zu lernen, eine offene und produktive statt defensiv-aggressive Haltung gegenüber kritischen Rückmeldungen und ein Streben, sich kontinuierlich um eine Verbesserung der Qualität der Begutachtung zu bemühen. Dabei soll dieses Buch gutachtlich Tätigen helfen. Jedes falsche Gutachten verletzt die Rechte einer Partei mit teils gravierenden Folgen für diese, sei es eine betroffene Person, der ihr in Wahrheit zustehende Leistungen zu Unrecht vorenthalten werden, sei es die Solidargemeinschaft der Steuerzahler, Versicherten oder Mitglieder eines Versorgungswerks, die am Ende über ihre Abgaben und Beiträge objektiv ungerechtfertigte Ansprüche zu finanzieren hat. Auch wenn Sachverständige in keinem Falle die Entscheidungsträger sind, kommt ihnen eine sehr hohe Verantwortung zu, der sich jede gutachtlich tätige Neuropsychologin bewusst sein muss.
Die interessierte Leserin wird rasch feststellen, dass sich einerseits viele im Text diskutierte Fragen auf die psychologische Gutachtentätigkeit generell oder auf Begutachtungen im Bereich von Gesundstörungen (medizinische und medizinisch- bzw. klinisch-psychologische, psychotherapeutische oder schmerztherapeutische) beziehen, andererseits auch viele Quellen aus den Nachbardisziplinen herangezogen und zitiert werden, wenn sie von Relevanz für die neuropsychologische Sachverständigenarbeit erscheinen. Der Text wird gleichwohl versuchen, im Folgenden immer wieder auf die engere Thematik der Neuropsychologie zu fokussieren.
Die hier präsentierten Fallvignetten und Fallkonstellationen (insbesondere in Tabelle 1), welche die Vielfalt möglicher neuropsychologischer Gutachtenaufträge illustrieren, basieren ausnahmslos auf realen Fällen, die nicht nur anonymisiert, sondern in für die Sache unwesentlichen Details so geändert wurden, dass keine Personenidentifizierung möglich ist.
Im letzten Teil dieses Bandes findet sich einige Exkurse zu speziellen Problemen und Konstellationen für die neuropsychologische Begutachtung. Die Liste angedachter Exkurse war ursprünglich länger, doch trotz intensiver Bemühungen konnten für weitere angedachte spezielle Fragestellungen keine interessierten Autoren gewonnen werden. Eine Diskussion der Begutachtung im Rahmen von Post- oder Long-Covid wurde bewusst ausgespart, da einerseits die naturwissenschaftlichen Evidenzen für einen ursächlichen Zusammenhang zwischen den unspezifischen Beschwerdenkomplexen und der Erkrankung noch praktisch völlig ungeklärt sind 8und es für den individuellen Fall keinen objektiven Nachweis für eine gesicherte pathogenetische Einordnung gibt (z. B. Zipper, Elze & Mast, 2024), andererseits die Thematik aktuell hochgradig politisch-ideologischen und interessegeleiteten Färbungen unterliegt. Für diesen Bereich werden die zukünftigen Entwicklungen abzuwarten sein, um Irrwege und Fehlbeurteilungen zu vermeiden. Für den Zeitpunkt der Manuskriptfertigstellung kann jedoch auf eine aktuelle Arbeit von Krahl et al. (2024) verwiesen werden.
In diesen Zeiten schwieriger Entwicklungen der deutschen Sprache ist zu betonen, dass zur Gewährleistung der Lesbarkeit für Personenbezeichnungen jeweils nur eine grammatische Form verwendet wurde; bei abwechselnder Verwendung der weiblichen wie auch der männlichen Form sind natürlich stets Personen jeglicher Geschlechtsidentität gemeint.
Mein großer Dank gilt natürlich den Mitarbeiterinnen des Hogrefe Verlags, vor allem und in hervorragender Weise der Lektorin, Frau Kathrin Rothauge, sowie den Koautoren, die durch die Exkurse zu speziellen neuropsychologisch relevanten Themen wesentlich dazu beigetragen haben, dass der Band in der jetzt vorgelegten Form zustande gekommen ist.
Berlin, im Frühjahr 2025
9Teil I: Einführung und Überblick
111 Gutachten und Sachverständige, Abgrenzung zu Befundberichten
1.1 Gutachten und Sachverständige, Grundbegriffe
Zum Begriff des Gutachtens findet sich in zahllosen Quellen, jedoch ohne angegebenen originalen Nachweis, die folgende Definition:
Definition: Gutachten
Ein Gutachten ist die begründete Darstellung von Erfahrungssätzen und die Ableitung von Schlussfolgerungen für die tatsächliche2 Beurteilung eines Geschehens oder Zustands durch einen oder mehrere Sachverständige.
Wegen der besonderen Qualifikation des Sachverständigen und seiner Verpflichtung zur strikten Unparteilichkeit wird der im Gutachten gelieferten Beurteilung der Charakter des „allgemein Vertrauenswürdigen“ zugesprochen. Die gutachtliche Beurteilung erfolgt mit Hinblick auf eine oder mehrere konkret formulierte Fragestellungen, die in der Regel in einem spezifischen Rechtszusammenhang angesiedelt sind. Ein Gutachten zielt also nicht auf eine einfache Statuserhebung und -beschreibung (wie dies bei einem Befundbericht der Fall ist), sondern auf die Beantwortung explizit formulierter rechtlich relevanter Fragen. Erhobenen Befunden kommt damit der Charakter von Befundtatsachen zu, an die – unter anderen Tatsachen – bei der Beantwortung der Fragestellungen angeknüpft wird (deshalb gehören sie zu den Anknüpfungstatsachen).
Merke
Das Gutachten tritt als verbindliche (z. B. bezeugte oder unterschriebene) mündliche oder schriftliche Aussage eines Sachverständigen oder Gutachters auf.
12Als wichtig zu beachten gilt dabei, dass der Begriff des Gutachtens keine geschützte Bezeichnung darstellt. Prozessrechtlich stellt es ein Beweismittel dar3, dem unter allen Beweismitteln keine hervorragende Bedeutung zukommt. Dennoch sollte der Begriff nur im Kontext der gezielten Beantwortung rechtlich relevanter (und oft streitiger) Fragen benutzt werden, wie eingangs dargestellt, nicht jedoch zur Bezeichnung von Untersuchungs-, Befund- oder Behandlungsberichten, geschweige denn für Atteste.
Im Gegensatz zu einem Gutachten in dem Sinne, wie es in diesem Buch begrifflich verwendet wird, enthalten Berichte Mitteilungen über erhobene Befunde oder sonstige Untersuchungsergebnisse, häufig mit nur kurz gefassten Erläuterungen zur Genese einer Gesundheitsstörung und zur Differenzialdiagnostik. In der Regel fehlen eine explizite Darstellung und Diskussion der wissenschaftlichen Grundlagen der verwendeten Befunderhebungsmethoden und der getroffenen Feststellungen, die Erläuterung alternativer wissenschaftlicher Positionen, exakte Quellenangaben u. Ä. m. Untersuchungsbefunde werden im Regelfall für fachlich qualifizierte Empfänger in der jeweiligen Fachsprache verfasst, während Gutachten sprachlich so formuliert werden sollen, dass sie von einem durchschnittlich verständigen Fachlaien verstanden und nachvollzogen werden können. Dies gilt insbesondere auch mit Bezug auf die getroffenen Schlussfolgerungen.
Eine Ausnahme bei der Abgrenzung von Befundberichten und Gutachten bilden etwa die Abschlussberichte von Rehabilitationskliniken sowie Kliniken in der Trägerschaft der Berufsgenossenschaften. Sie enthalten häufig zusätzlich zu Befundmitteilungen in der Regel auch gutachtliche Anteile bzgl. einer sozialmedizinischen Fragestellung (z. B. quantitative und qualitative Einschränkungen der beruflichen Leistungsfähigkeit im ausgeübten Beruf und auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt; empfohlene Leistungen zur Teilhabe; prognostisch verbleibende Minderung der Erwerbsfähigkeit in rentenberechtigendem Ausmaß), die für die Kostenträger der Heilbehandlung oder Heilerfolgskontrolle (zum Beispiel die Deutsche Rentenversicherung oder eine Berufsgenossenschaft) verfasst werden.
Gutachten üben keine Bindungswirkung auf die Auftraggeber aus. In gerichtlich beauftragten Gutachten etwa gilt der Grundsatz der freie Beweiswürdigung4 durch den Richter. Dabei sind gerichtlich in Auftrag gegebene Gutachten grundsätzlich als Beweismittel einzustufen, Privatgutachten hingegen als besonders substantiierter Parteienvortrag. Dessen ungeachtet sind die Ergebnisse von Privatgutachten zu berücksichtigen und etwaige bedeutsame Abweichungen zwischen gerichtlich bestellten und Parteigutachten erfordern gegebenenfalls eine weitere Sachaufklärung.5
13Auch die Bezeichnung des Sachverständigen oder Gutachters ist nicht gesetzlich geschützt. Allgemein erwartet wird von einem als Sachverständiger auftretenden Fachvertreter, dass er über eine besondere Fachkunde verfügt, und zwar auf dem Gebiet, auf dem die Sachfrage des Gutachtens angesiedelt ist, sodass häufig eine überdurchschnittliche Qualifikation als Eingangsvoraussetzung für die Übernahme eines Auftrags vorausgesetzt wird. In der realen Gutachtenpraxis wird jedoch, wie leicht festzustellen ist, dieser Standard häufig verfehlt.
Vom Sachverständigen abzugrenzen ist ein sachverständiger Zeuge, also eine Person, die zwar über Sachverstand verfügt, in der Sache selbst aber nicht als unabhängiger und unparteiischer Sachverständiger auftritt, sondern in Zeugenschaft. Dies kann etwa eine behandelnde Ärztin oder Psychotherapeutin sein. Dabei beschränkt sich die Aufgabe einer Zeugin auf die Wiedergabe von Wahrnehmungen, nicht aber werden weiterreichende gutachtliche Beurteilungen erwartet.6
Prinzipiell können Gutachten schriftlich oder mündlich erstattet werden. In aller Regel werden von Neuropsychologen sogenannte freie Gutachten erstellt, in Abgrenzung zu Formulargutachten. Letztere enthalten häufig Alternativfragen oder verlangen Antworten anhand von Schätzskalen oder mithilfe von kurz gefassten Beschreibungen, was regelmäßig Mindestansprüche an die Qualität von Gutachten verfehlen muss.
Gutachten sind in der Regel umfassender als Befundberichte und werden formal nach anderen, großzügigeren Kriterien gestaltet, sie sollen für Laien in wesentlichen Zügen verständlich sein und können konzeptionelle Diskussionen, Exkurse, Literaturverweise oder methodische Details enthalten, die in diagnostischen und Therapieberichten im Regelfall fehlen. Dies ergibt sich naturgemäß sowohl aus der Aufgabe von Gutachten als auch aus den an ihre Erstellung angelegten Qualitätsmaßstäben.
In welchem Umfang ein Urheberrechtsanspruch auf Gutachten besteht, scheint nach der Rechtsprechung nicht gänzlich geklärt zu sein. Gleichwohl wird in vielen Gutachten darauf verwiesen, dass Gutachten dem Schutz nach dem Urheberrecht unterliegen.7 Eine Verwertung innerhalb der vereinbarten Verwendungszwecke, für die auch die Vergütung erfolgte, ist davon aber keinesfalls betroffen.
141.2 Befundberichte als Zuarbeit für Gutachten anderer Disziplinen
Auf die Unterscheidung zwischen Befundberichten und Gutachten ist bereits im vorangegangenen Abschnitt eingegangen worden. Gelegentlich werden neuropsychologische, testpsychologische oder leistungsdiagnostische Untersuchungen vor allem im Rahmen nervenärztlicher, neurologischer und psychiatrischer Gutachten erstellt und ihre Ergebnisse in jene integriert, ohne dass sich die Ergebnisberichte qualitativ als eigenständige Gutachten auszeichnen. Ein solches Herangehen ist auch von einer Reihe von Gutachteninstituten bekannt. Für bestimmte Fragestellungen oder Fallkonstellationen kann ein solcher Ansatz durchaus für sinnvoll erachtet werden. In diesen Fällen sollten die Befundberichte jedoch auch nicht als Gutachten ausgewiesen werden, sondern korrekterweise als Untersuchungsberichte ohne eigenständigen gutachtlichen Stellenwert.
Dies kann insbesondere im Rahmen gerichtlicher Gutachtenanordnungen, in denen überdies eine ausdrückliche vorherige gerichtliche Anordnung von Zusatzgutachten notwendig ist, erhebliche Auswirkung auf die Kostenrechnung haben. Ein psychologisches Zusatzgutachten muss den rechtlichen, inhaltlichen und formalen Anforderungen gerecht werden, die generell an ein Gutachten zu stellen sind und die sich in der psychologischen und medizinischen Gutachtenliteratur formuliert finden (z. B. Marx et al., 2019; Neumann-Zielke et al., 2015).
Für die rechtliche Unterscheidung zwischen einem Untersuchungsbericht und einem Gutachten ist ein Beschluss des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg vom 21.04.2010 (Az.: L 2 SF 234/09 B) aufschlussreich. Danach wies das Gericht den Berufungsantrag eines Bezirksrevisors zurück, ein psychologisches Zusatzgutachten lediglich als Testuntersuchung mit einem Bruchteil der in Rechnung gestellten Kosten zu vergüten, und begründete dies damit, dass der Psychologe über eine Testdurchführung hinaus eine Beurteilung und Interpretation der Befunde und eine Auseinandersetzung mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen vorgenommen hatte, wie dies geboten war. In der Begründung hieß es:
Der Sachverständige hat dem Richter die Kenntnis von Erfahrungssätzen zu vermitteln, Tatsachen festzustellen, soweit dafür eine besondere Sachkunde erforderlich ist, und aus diesen aufgrund der einschlägigen Erfahrungssätze Schlussfolgerungen zu ziehen … Dies hat der Antragsteller aufgrund der von ihm festgestellten Tatsachen … [im Gutachten] getan.
2
Wichtig für das Verständnis hier ist, dass „tatsächlich“ nicht „wirklich“ oder „in Wahrheit“ meint, sondern im juristischen Sinne verwendet wird. Der unbestimmte Rechtsbegriff der Tatsachen bezeichnet konkrete Zustände oder Vorgänge aus Gegenwart und Vergangenheit, die objektiv dem Beweis zugänglich sind. Davon abzugrenzen sind Tatsachenbehauptungen. Das sind Aussagen über Tatsachen, deren Verifizierung (noch) fehlt.
3
So etwa in der Zivilprozessordnung (ZPO) § 402 als „Beweis durch Sachverständige“ bezeichnet.
4
ZPO § 286.
5
Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 26.02.2020 (Az.: IV ZR 220/19) sowie Beschluss des BGH vom 05.11.2019 (Az.: VIII ZR 344/18).
6
Dessen ungeachtet werden nach eigenen Erfahrungen des Autors durch Gerichte oder die beteiligten Parteien mitunter auch weiterreichende (eigentlich) gutachtliche Beurteilungen erbeten. Wie damit umzugehen ist, richtet sich sicherlich nach den Besonderheiten des Einzelfalls.
7
Insbesondere mit Verweis auf die §§ 1, 2, 11 und 15 des Urheberrechtsgesetzes (UrhG).
152 Auftraggeber und Fragestellungen zur neuropsychologischen Begutachtung
Das Arbeitsgebiet der Klinischen Neuropsychologie bestimmt ihre wichtigsten Anwendungsbereiche als gutachtliche Disziplin. Bis spätestens Beginn der 1990er-Jahre war die Neuropsychologie in den USA soweit professionalisiert und anerkannt, dass sie als die Fachdisziplin galt, die sich in hervorgehobener Weise mit den Beziehungen zwischen Gehirn (also auch möglichen Hirnschädigungen) und dem Verhalten beschäftigte. Dies beförderte eine zunehmende Nachfrage nach Neuropsychologen als Sachverständige, wenn es um die Beurteilung von kognitiven und Verhaltensstörungen im Zusammenhang mit Erkrankungen oder Verletzungen des Gehirns ging. Dabei standen gutachtlich zunächst vor allem Folgen von Schädel-Hirn-Verletzungen im Vordergrund. Die Forensische Neuropsychologie (also die Anwendung klinisch-neuropsychologischer Expertise im rechtlich relevanten Kontext) nahm damit einen ungeheuren Aufschwung und heute gehört Sachverständigentätigkeit zu einem wichtigen Arbeitsgebiet vieler amerikanischer Neuropsychologen (Sweet et al., 2023; Sweet, Meyer, Nelson & Moberg, 2011).
Wie in verschiedenen geografischen Regionen die neuropsychologische Begutachtung im Einzelnen organisiert ist, hängt nicht nur vom Entwicklungsstand und der berufsständischen Organisation von Klinischen Neuropsychologen im jeweiligen Land ab, sondern wird sehr stark von den Gegebenheiten des herrschenden Rechtssystems, der Gesetzgebung und der maßgeblichen Rechtsprechung bestimmt.
Potenzielle Auftraggeber neuropsychologischer Gutachten:
Gerichte der verschiedenen Gerichtsbarkeiten (des Zivil-, Sozial-, Verwaltungs- und Strafrechts) sowie Staatsanwaltschaften;
Bundes-, Landes- und kommunale Behörden (z. B. Versorgungs-, Sozial- und Gesundheitsämter) und andere öffentlich-rechtliche Einrichtungen, Einrichtungen der Dienstunfallfürsorge für Beamte;
Dienstherren von Beamten (in Überschneidung zum vorangegangenen Punkt), Arbeitgeber;
16Sozialversicherungsträger (z. B. Berufsgenossenschaften, Unfallkassen, Deutsche Rentenversicherung);
berufsständische Versorgungswerke der kammerfähigen freien Berufe, Einrichtungen der kirchlichen Versorgung u. Ä.;
private Versicherungsgesellschaften (z. B. Unfall-, Haftpflicht- und Lebensversicherungen);
Privatpersonen oder deren rechtliche Vertreter.
Als gutachtliche Fragestellungen kommen grundsätzlich solche in Betracht, bei denen es um kognitive, Persönlichkeits-, Erlebens- und/oder Verhaltensveränderungen im Rahmen einer neurologischen Erkrankung, einer anderen Erkrankung mit Auswirkung auf die Funktionsfähigkeit des Gehirns oder einer Verletzung des Gehirns geht. In Tabelle 1 findet sich ein Überblick über das breite Spektrum, das inhaltlich und rechtlich die Indikation für ein neuropsychologisches Gutachten begründen kann. Bei einigen rechtlichen Fragestellungen, insbesondere im Bereich privater Berufsunfähigkeitsversicherungen und in der Gesetzlichen Unfallversicherung, werden aktuell auch leistungsdiagnostische oder neuropsychologische Zusatzgutachten spezifisch mit der Zielrichtung einer eingehenden psychologischen Beschwerdenvalidierung in Auftrag gegeben. Wenn sie nach den Grundsätzen neuropsychologischer Begutachtungen von dafür qualifizierten Sachverständigen ausgeführt werden, spricht auch nichts dagegen, sie als neuropsychologische Gutachten auszuweisen.
Anders als in Deutschland werden in Österreich regelmäßig auch Neuropsychologinnen mit der Begutachtung der Geschäfts- und Testierfähigkeit beauftragt (vgl. Kapitel 17). In der Schweiz ist die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit eine häufige Fragestellung (vgl. Frei et al., 2016), die dort in der rechtlichen Fassung gänzlich anders geregelt und in einer Graduierung bewertet wird. Neuropsychologische Gutachten zur Frage der Arbeits(un)fähigkeit (also insbesondere im Geltungsbereich des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch, SGB V) sind hingegen in Deutschland äußerst selten. – Zu weiteren Besonderheiten der neuropsychologischen Begutachtung in der Schweiz kann im Übrigen auf einen neueren Band von Frei (2022) verwiesen werden.
17Tabelle 1: Beispiele für Auftraggeber neuropsychologischer Gutachten, die in verschiedenen Rechtsbereichen und zu verschiedenen rechtlich relevanten Fragestellungen angesiedelt sind
Auftraggeber
Rechtsbereich
Problem
Fragestellungen (beispielhaft)
Bemessungsgrundlage/Fähigkeitsbereich
Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse
Sozialrecht (Gesetzliche Unfallversicherung, Sozialgesetzbuch SGB VII)
A erlitt bei einem versicherten Wegeunfall ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma.
Verbliebene Unfallfolgen; deren Auswirkungen auf die berufliche Leistungsfähigkeit; weiterer Therapiebedarf, Prognose
Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE in %)
Sozialgericht
Sozialrecht (Gesetzliche Rentenversicherung, SGB VI)
B war wegen chronischer Erschöpfung mit Konzentrations- und Gedächtnisschwierigkeiten hausärztlich 18 Monate lang arbeitsunfähig erkrankt und ficht nun einen abgelehnten Antrag auf Rente wegen Erwerbsminderung an.
Vorliegende Gesundheitsstörungen; quantitative Einschränkungen der beruflichen Leistungsfähigkeit; qualitative/zeitliche Einschränkungen der beruflichen Leistungsfähigkeit; Leistungsfähigkeit für Beispieltätigkeiten; Wegefähigkeit
Erwerbsminderung (in den Stufen: teilweise vs. volle Erwerbsminderung)
Zuständiges Landesamt
Sozialrecht (Soziales Entschädigungsrecht, SGB XIV)
C wurde nach einer Antikriegsdemonstration von einer Gruppe Vermummter in einem Park zusammengeschlagen und erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma.
Verbliebene Schädigungsfolgen; Auswirkungen auf die berufliche Teilhabe; weiterer Therapiebedarf
Grad der Schädigungsfolgen (GdS)
18Landessozialgericht
Sozialrecht (Schwerbehindertenrecht, SGB IX)
D leidet an einer Schizophrenie. Ihr Antrag auf Höherstufung wurde abgelehnt, was in der ersten Instanz (Sozialgericht) bestätigt wurde.
Liegen im Rahmen der Erkrankung kognitive Funktionsstörungen mehr als nur vorübergehend vor und welche Auswirkung haben diese auf die soziale Anpassungsfähigkeit der Klägerin?
Grad der Behinderung (GdB)
Versicherungsgesellschaft (Leben)
Zivilrecht (Versicherungsrecht; Berufsunfähigkeitsversicherung)
E macht nach einer Chemotherapie wegen einer Malignomerkrankung verbliebene schwere Konzentrationsstörungen geltend.
Neuropsychologisches Leistungsbild; Auswirkungen auf die berufliche Tätigkeit in ihrer konkreten Ausgestaltung (des individuellen Falles), mit Vergleichsmaßstab des Niveaus „in gesunden Tagen“
Grad der Berufsunfähigkeit (BU in %)
Schlichtungsstelle einer Ärztekammer
Zivilrecht (Arzthaftungsrecht)
F wurde nach einem einmaligen einfachen leichten Schädel-Hirn-Trauma von ihrem nachbehandelnden Neurologen nicht zur neuropsychologischen Therapie überwiesen.
Wenn die Betroffene von ihrem ambulanten Nervenarzt frühzeitig zu einer neuropsychologischen Therapie überwiesen worden wäre, würde sie dann auch Jahre nach dem Unfall nicht mehr an schweren kognitiven Störungen leiden?
(Behandlungsfehler)
19Oberlandesgericht
Zivilrecht (Unfallversicherungsrecht)
G erlitt bei einem Fußballspiel eine Verletzung am Hals mit Dissektion der inneren Karotisarterie und folgendem Schlaganfall im Stromgebiet der mittleren Gehirnschlagader.
Verbliebene Schädigungsfolgen drei Jahre nach dem Unfallereignis; Kausalität zwischen schädigendem Ereignis und verbliebenen Unfallfolgen; Bemessung des Umfangs der verbliebenen Beeinträchtigung der geistigen Leistungsfähigkeit, im Vergleich zu einer durchschnittlichen Person gleichen Alters und Geschlechts
Invalidität (in %), außerhalb der Gliedertaxe als Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit (BdL in %) zu bestimmen
Arbeitgeber
Zivilrecht (Arbeitsrecht)
H leidet an einer chronisch progredienten Multiplen Sklerose.
Ist H noch in der Lage, aufgrund der erkrankungsbedingten Einschränkungen der geistigen Leistungsfähigkeit die vertraglich geschuldeten Arbeitsleistungen als Krankenschwester zu erbringen?
Berufliche Einsatz- und Leistungsfähigkeit
20Landesarbeitsgericht
Zivilrecht (Arbeitsrecht)
Bei I wurde im Jahr vor Beginn der Covid-Pandemie ein chronisches Erschöpfungssyndrom diagnostiziert, bei unauffälligen sonstigen medizinischen Befunden.
Ist es erforderlich, I dauerhaft ausschließlich im Homeoffice zu beschäftigen oder ist eine Tätigkeit an einem behindertengerecht ausgestatteten Arbeitsplatz am Firmensitz zumutbar?
Berufliche Einsatz- und Leistungsfähigkeit
Amtsgericht
Zivilrecht (Familienrecht)
J ist an einer hereditären Kleinhirndegeneration erkrankt; ihr früherer Ehemann möchte wegen behaupteter grober Fehlhandlungen ihren weiteren Kontakt mit dem gemeinsamen Sohn unterbinden.
Ist J aufgrund ihrer Erkrankung in der Lage, regelmäßig Umgang mit ihrem achtjährigen Sohn zu pflegen, ohne dass dadurch das Kindeswohl gefährdet wäre?
Umgangsfähigkeit
Rechtsanwalt
Zivilrecht (Betreuungsrecht)
Die Kinder des inzwischen verstorbenen K machen geltend, dass die drei Jahre vor seinem Tod geschlossene Ehe nicht rechtskräftig sei.
War K zum Zeitpunkt der Eheschließung trotz seiner bereits vorliegenden Demenz in der Lage, im Rahmen der natürlichen Willensbildung die Ehe mit seiner langjährig Verlobten einzugehen, also insbesondere das Wesen der Ehe zu begreifen und seine diesbezüglichen Wünsche zu artikulieren?
Ehegeschäftsfähigkeit
21Haftpflichtversicherung
Zivilrecht (Kfz-Haftpflicht)
L wurde als Beifahrerin bei einem Motorradunfall schwer verletzt und erlitt im Rahmen eines Polytraumas auch eine schwere Schädel-Hirn-Verletzung.
Welche Gesundheitsstörungen liegen vor?
Sind diese ausschließlich Folge des Unfalls? Welche unfallfremden Krankheiten haben mitgewirkt und wie wirken sie sich aus?
Wie hoch ist die bisherige, gegenwärtige und gegebenenfalls künftige Minderung der Erwerbsfähigkeit aufgrund des Unfalles einzuschätzen?
Wie wirken sich die Verletzungsfolgen auf die private Lebensführung aus?
Für den Bereich der privaten Lebensführung:
Beschreibung konkreter Einschränkungen; für den beruflichen Bereich: Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE), getrennt nach konkret und abstrakt
Behörde der Dienstunfallfürsorge
Verwaltungsrecht (Beamtenversorgungsgesetz, § 35)
M erlitt anlässlich eines Einsatzes als Polizeibeamter ein Distorsionstrauma der Halswirbelsäule und macht seitdem eine ausgeprägte Fatigue sowie Konzentrations- und Gedächtnisstörungen geltend.
Welche Gesundheitsstörungen liegen vor?
Sind diese ausschließlich oder wesentlich auf das Unfallgeschehen zurückzuführen?
Inwieweit ist Herr M wegen des Unfalls in seiner Erwerbsfähigkeit gemindert?
Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE in %)
22Versorgungswerk einer Rechtsanwaltskammer
Verwaltungsrecht
N leidet an einer Multiplen Sklerose. Gleichzeitig liegt eine Opiatabhängigkeit vor.
Sind die vom Mitglied beklagten kognitiven Einschränkungen ausschließlich Folge der Multiplen Sklerose oder können sie auch auf die jahrelange Opiateinnahme zurückgeführt werden?
Berufsunfähigkeit
Verwaltungsgericht
Verwaltungsrecht (Aufenthaltsrecht)
O klagt gegen eine Ausweisung aus der Bundesrepublik. Er macht geltend, aufgrund einer vorbestehenden geistigen Behinderung nicht in der Lage zu sein, die deutsche Sprache zu erlernen, und legt dazu das Attest einer Psychoanalytikerin vor.
Leidet der Kläger an einer Lern- und Leistungsschwäche mit Krankheitswert, die seine Fähigkeit, sich neues Wissen anzueignen, insbesondere Deutschkenntnisse zu erwerben und in einer Prüfungssituation nachzuweisen, dauerhaft ausschließt?
Kognitive Leistungsfähigkeit/Lernfähigkeit
23Landgericht
Strafrecht
P wird zur Last gelegt, im Rahmen der deutschen Wiedervereinigung erhebliche Geldsummen veruntreut zu haben; seit acht Jahren leidet er an einer Multiplen Sklerose, ohne nachgewiesene Progredienz oder Schübe in den letzten vier Jahren.
Liegen Hirnleistungsstörungen und eine abnorme Erschöpfbarkeit vor?
Welche qualitativen und quantitativen Auswirkungen haben diese auf die Fähigkeit zur Teilnahme am Strafprozess?
Weicht die Beurteilung von der der behandelnden Ärzte ab?
Verhandlungsfähigkeit
Landgericht
Strafrecht
Die an Epilepsie vorerkrankte Frau Q wurde Opfer einer Straftat, bei der sie möglicherweise ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt, was aber bisher nicht als gesichert gilt.
Hat die Zeugin bei dem Vorfall gesundheitliche Beeinträchtigungen erlitten, die geeignet sind, ihre Gedächtnisfähigkeit zu beeinträchtigen? Falls ja, inwieweit geben ihre Aussagen das tatsächliche Geschehen wieder?
Glaubhaftigkeit einer Zeugenaussage
243 Neutralität, Aufgaben und Qualifikation des Sachverständigen
3.1 Aufgaben des Sachverständigen und Gebot der Unparteilichkeit
Merke
Dem Sachverständigen kommt die Aufgabe einer unabhängigen, neutralen und sachbezogenen Beratung des Auftraggebers zu, um diesen zu befähigen, die jeweilige Rechtsfrage nach Möglichkeit korrekt zu beantworten, insoweit es die fachlichen Aspekte der jeweiligen Disziplin betrifft, und zwar in der Rolle eines „Gehilfen des Gerichts“, wie er häufig bezeichnet wird. Dabei ist im gesamten Prozess der Begutachtung sowie in der Formulierung des Gutachtens auf die jeweilige Fragestellung abzustellen, die jedoch umfassend zu beantworten ist. Zu beachten ist, dass nicht gestellte Fragen auch nicht beantworten werden sollen.