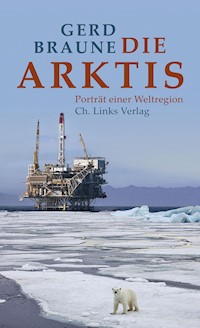9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Länderporträts
- Sprache: Deutsch
Farbenprächtige Wälder, tiefblaue Seen, die schneebedeckten Gipfel der Rocky Mountains oder angesagte Metropolen wie Vancouver, Toronto und Montréal: Kanada fasziniert durch seine vielfältige Natur und Kultur. Wegen seiner Vorreiterrolle in vielen Fragen der gesellschaftlichen Liberalisierung wird das Land überall auf der Welt geschätzt; Multikulturalismus genießt hier Verfassungsrang.
Gerd Braune lebt seit mehr als 20 Jahren in der Hauptstadt Ottawa. In seinem Buch gibt er einen Einblick in Geschichte und Politik Kanadas. Er schildert das Leben im zweitgrößten Land der Erde, aber auch die Bruchlinien der kanadischen Gesellschaft, zwischen Indigenen und Eingewanderten, Anglophonen und Frankophonen. Und wie die Kanadier stets auf die USA blicken und ihre Sympathien, aber auch ihre Hassliebe gegenüber dem großen Nachbarn im Süden pflegen.
»Ein Buch, das den Leser souverän durch die komplexe Geschichte Kanadas führt.«
Katja Ridderbusch, Deutschlandfunk, über »Indigene Völker in Kanada«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Gerd Braune
Kanada
Ein Länderporträt
Gerd Braune
Kanada
Ein Länderporträt
Ch. Links Verlag
Für Melanie und Kornelia,
Johannes, Christine, Julian und Sienna
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Ch. Links Verlag ist eine Marke der Aufbau Verlage GmbH & Co. KG
© Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 2021
entspricht der 1. Druckauflage von 2021
www.christoph-links-verlag.de
Prinzenstraße 85, 10969 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
Reihenentwurf: Stefanie Raubach, Berlin
Umschlagfoto und S. 3: Skyline von Vancouver © istock/RonTech2000
Karte: Christopher Volle, Freiburg i. Br.
Satz: Nadja Caspar, Ch. Links Verlag
ISBN 978-3-96289-135-0
eISBN 978-3-86284-509-5
Inhalt
»Canadian, eh?« – eine Vorbemerkung
Nichts ist so kanadisch wie hockey
Das Mutterland des Eishockey und Lord Stanleys Cup
Wie Fußball das multikulturelle Kanada begeistert
Von Meer zu Meer zu Meer
Blick auf die Geschichte – ein großes Land entsteht
Ein ganz junges Land?
Samuel de Champlains Gründungen
Waldläufer und die Hudson’s Bay Company
»Le Grand Dérangement« – die Vertreibung der Akadier
Die Schlacht auf den »Plaines d’Abraham«
Der Weg zur Staatsgründung
Rupert’s Land und der Widerstand am Red River
Die Eisenbahn als »nationaler Traum«
The True North Strong and Free
Atlantik, Pazifik und Arktischer Ozean
Das Land der indigenen Völker
Das Territorium der First Nations, Inuit und Métis
Vielfalt der Kulturen und Sprachen
Der Kampf um rechtliche Anerkennung
Die Tragödie der Residential Schools
Verschwundene Kinder, unmarkierte Gräber
Der Versuch der Reconciliation
Westminster in Ottawa
Die konstitutionelle Monarchie Kanadas
Die allgegenwärtige Krone
Koalitionen sind ein Unding
»Frauen sind Personen« – der Senat, die »rote Kammer«
Kanadas mächtige Premierminister
Von John A. Macdonald zu Justin Trudeau
Der transatlantische Partner
Die UN-Friedenstruppen – ein kanadischer Mythos
Die Mohnblumen von Flandern und Kanadas Opfer
Multilateralismus – Markenzeichen kanadischer Außenpolitik
Gegen das Übel der Landminen
Peacekeeping, aber nicht pazifistisch
Little Canada in Deutschland und die Berliner Mauer in Kanada
Brücke zwischen den Kontinenten
Kanada in der G7- und G20-Gruppe
Commonwealth und Frankophonie
Der Elefant im Bett
Das Leben neben dem mächtigen Nachbarn USA
Freundliche Anerkennung und vulgäre Ausbrüche
Asylsuchende Kriegsdienstgegner
9/11 – Hilfe in der Not
Das Nein zum Irak-Krieg
Getrennte Wege
Partner und Freunde
Abgrenzung von den USA – Teil der kanadischen Identität
Zerreißproben
Souveränitätsbewegung in Québec und »Entfremdung« im Westen
Von der »révolution tranquille« zur Oktoberkrise
1980 – Québecs Nein zur Trennung von Kanada
1995 – die Nacht, in der Kanada den Atem anhielt
Ende der Souveränitätsdebatten
Vom Ärger über Ottawa zur Drohung mit Wexit
Vielfalt und sozialer Wandel
Multikulturalismus und Immigration
Von Bilingualismus zu Multikulturalismus
Stärke oder Schwäche?
Vorbehalte in Québec
Punktesystem steuert Einwanderung
Pier 21 in Halifax – das Tor zu Kanada
Die Intoleranz der Vergangenheit
Africville, Underground Railroad und Viola Desmond
Der anhaltende Kampf gegen Rassismus
Sozialer Wandel
Gleiche Rechte für LGBTQ2
Countdown in die Cannabis-Ära
Eiswein, Poutine und das Wetter
Von Besonderheiten des Lebens in Kanada
GST, HST und »tip« – die netten Überraschungen
Ahornsirup – Kanadas flüssiges Gold
Die Liebe zum Bier
Eiswein oder Icewine
Liberalität und Bevormundung
Boxing Day und Thanksgiving
Tim Hortons und Poutine
Immer wieder das Wetter
Einsamkeit und coole Städte
Nationalparks, Natur und urbanes Leben
Naturschätze
Die Provinzen ziehen nach – Algonquin war der Anfang
Meeresschutzgebiete vom St.-Lorenz-Strom bis in die hohe Arktis
Die Urbanisierung Kanadas
Vancouvers Absage an die autogerechte Stadt
Torontos Geschenk an die Welt
Montréal – das frankophone Zentrum Nordamerikas
Ottawa – vom Holzfällerdorf zur Hauptstadt
Québec – »Klein Montmartre« in Nordamerika
Der Charme der Small Towns
Beliebte Drehorte der Filmindustrie
Mehr als ein Land der Rohstoffe
Der Kampf zwischen Ökonomie und Ökologie
Das Klischee von der »Nation der Holzfäller und Wasserträger«
Von Kali, Eisenerz und Diamanten
Ölsand und Klimapolitik
Forstwirtschaft und die alten Regenwälder
Gemeinsames Lernen
Kanadas Schulsystem – Verzicht auf frühe Trennung in Schultypen
Kulturhoheit der Provinzen
Universitäten und Colleges
Indigene Schulen in indigenen Territorien
Der Stolz auf das Gesundheitswesen
Health Care ist eine Ikone, trotz erheblicher Mängel
Spitzenversorgung und lange Wartezeiten
Covid offenbart Defizite
Ein Land der Kultur
Die unermessliche Vielfalt des kulturellen Lebens
Perlenkette der Museen
TIFF und die Erfolge kanadischer Filmkunst
Einzigartigkeit und Vielfalt – Kanadas Literatur
Von Rock, Pop und Jazz zur klassischen Musik
Canada Day
Kanada hat Grund zum Feiern, trotz mancher Probleme
Anhang
Geschichte in Kürze
Quellen- und Literaturverzeichnis
Basisdaten
Karte
Dank
Der Autor
»Canadian, eh?« – eine Vorbemerkung
»Worüber hast Du denn in den vergangenen Tagen geschrieben?« Wie oft höre ich diese Frage von Bekannten und von Kolleginnen und Kollegen. Manchmal in einer abgewandelten Form: »Was in-teressiert denn Deine Leser in Europa an Kanada?« Das klingt hin und wieder wie »Es gibt doch nichts Interessantes« oder »We are boring«. Wenn ich dann aufzähle, was ich geschrieben habe, ist das Staunen manchmal groß. Vor allem, wenn ich von Ottawa aus durch Recherchen irgendwelche abstrusen Geschichten in der fernen Provinz ausgrabe. Oder Politik in einer Weise erkläre, wie sie selbst den Kanadiern aus ihrer Innenperspektive nicht vertraut ist. Die Zweifel, dass Kanada Spannendes für die Außen-welt zu bieten hat, erinnert mich auch an ein Gespräch, das ich 1997 mit dem Chefredakteur einer meiner Zeitungen führte. Vor meinem Wechsel nach Kanada besuchte ich die Zeitungen, für die ich aus Kanada als freier Korrespondent berichten sollte. Ich traf jenen Chefredakteur und nannte ihm ein paar Ideen für Berichte und Reportagen – Multikulturalismus, die indigenen Völker, Rohstoffe, »bunte« Themen und ein bisschen Politik, denn es war erst ein paar Jahre her, dass Kanada fast auseinander gebrochen wäre, als Québec über seine Unabhängigkeit abstimmte. Zwei Jahre später begegnete ich diesem Chefredakteur wieder. Seine Zeitung hatte fast jede Woche mindestens einen Text von mir veröffentlicht. »Als Sie mir vor zwei Jahren Ihre Themen aufzählten, fragte ich mich: Und was will er berichten, wenn er die fünf Geschichten geschrieben hat?«, sagte er anerkennend.
So ist das mit Kanada – viel geliebt als Urlaubsland, ein Einwanderungsland, hoch geachtet, und doch so völlig unbekannt. Viel Landschaft, Seen, Wälder, Natur, Weite, einige große Städte. Und dann? Ich wusste, dass in Kanada Geschichten zuhauf zu finden sind. Sorgen, dass es mir an Themen mangeln werde, plagten mich nicht, auch wenn mir bewusst war, dass Geschichten aus Kanada meist keine »Muss-Geschichten« sind, die unbedingt ins Blatt kommen sollten. Ich kannte ja das Land, das in europäischen Medien oft ein großer weißer Fleck da oben im Norden ist. Ich wusste, dass ich nicht nach Norden reise, wenn ich von Deutschland nach Montréal, Toronto oder Ottawa fliege, denn diese drei Städte liegen südlicher als Deutschland, Toronto und die Niagara-Region sogar auf dem Breitengrad von Florenz. Ich wusste, dass man nicht einfach mal schnell von Ottawa nach Vancouver reist, so als würde man von Frankfurt nach Köln oder München fahren. Ich kannte das Land – so dachte ich jedenfalls. 1978 hatte ich Kanada mit der Eisenbahn durchquert. Es war meine erste große Kanada-Reise. Ich wollte das Land erfahren, in dem ich 1954 geboren wurde, in dem ich aber, abgesehen von meinen ersten Monaten, nie lebte. Aber dessen Staatsbürgerschaft ich hatte, weil ich halt in Toronto the Good geboren wurde. Diese Reise quer durch das Land faszinierte mich. Vier Jahre später folgte die zweite große Reise quer durch Kanada, diesmal mit einem Campingbus. Dann ein weiterer Urlaub an der Westküste, und schließlich 1997 der Umzug nach Kanada mit der ganzen Familie, zu der zwei Kinder im Teenageralter gehörten. Es war ein verrücktes Unternehmen, aber warum nicht. Es war ja nur für drei, maximal fünf Jahre geplant. Davon war ich überzeugt. Das war vor 24 Jahren.
Die Geschichten gingen mir nicht aus. Ich musste mir eingestehen, dass ich das Land eben doch nicht kannte, sondern es erst erleben musste – die riesigen Dimensionen, das Arbeiten in sechs Zeitzonen, die fremde Politik, die Geschichte und die Besonderheiten seiner Bevölkerung. Auch Ärger und Enttäuschungen musste ich verarbeiten. »Das Leben hier ist so wie das Land«, sagte mir nach ein paar Wochen einer, der seit vielen Jahrzehnten hier lebte. »Du siehst das schöne Land, die grünen Wälder und die Seen, alles nett und freundlich, aber direkt darunter liegt der Kanadische Schild, diese harte Gesteinsformation.« Durchweg positive Bilder, die ausgedehnte Reisen schaffen, entsprechen dann doch nicht der Realität des Alltags. Es war schwerer, Freunde zu finden, als wir es uns vorgestellt hatten. Es war doch so einfach gewesen, auf den Reisen Kontakte zu knüpfen. Wir vermissten Freundschaften, wie wir sie aus Deutschland kannten. Wir wollten mit Menschen zusammensitzen und quatschen, ganz spontan, nicht nur bei einem mehr oder weniger formal dinner, das längerfristig geplant und abgesprochen werden muss, mit einer Flasche Wein, und wenn die leer war, gab’s Tee oder Kaffee und dann war es Zeit zu gehen. Ein grauer Novemberabend oder der endlos lange Winter in Ottawa sind doch etwas anderes als ein Sommerabend auf einem Campingplatz in einem Nationalpark. Nach ein paar Wochen hätte ich zugegriffen, wäre mir ein Rückflugticket nach Deutschland angeboten worden. Meine Frau erfuhr, dass ihre beruflichen Qualifikationen hier nicht das Papier wert waren, auf dem sie geschrieben standen. Ich musste, nach 25 Jahren Fahrpraxis in Europa, den Führerschein noch einmal machen, weil der deutsche Führerschein in Ontario damals nicht anerkannt wurde, und ich fiel prompt durch die Fahrprüfung. Ich sei nicht erfahren genug, in Kanada Auto zu fahren, meinte Joe, der Prüfer. Mit Mühe hielt ich ein Schimpfwort zurück, das mit »f« beginnt und für das Pierre Trudeau einst die Umschreibung fuddle duddle kreiert hatte.
Aber das alles ist nun fast ein Vierteljahrhundert her! Es lebt sich gut hier, auch wenn ich Kanada nicht für »das beste Land der Welt« halte, als das es manchmal bezeichnet wird, denn das gibt es nicht. Daran ändern auch fragwürdige und selektive Statistiken, in denen Kanada ganz oben steht, oder Selbsteinschätzungen auf Glücks- oder sonstigen Barometern nichts. Kanada hat seine Geschichte und seine Vor- und Nachteile, über die Politik kann man vortrefflich meckern, vielleicht nicht ganz so nörglerisch wie in old Germany, und über manche Sitten und Gebräuche muss ich mich bis heute wundern. Zu den interessanten Erfahrungen eines langen Aufenthalts in einem anderen Land gehört, dass sich so manches verklärt, was man früher in seinem Herkunftsland erfahren und über das man sich geärgert hatte. Aber das wird meist wieder geradegerückt, wenn man eingehende Gespräche mit Eu-ropäern über ihre Probleme führt oder zu einem längeren Besuch zurückkehrt.
Kanada ist ein Land, das immer im Schatten der gewaltigen USA zu stehen scheint. Es kommt nicht polternd daher wie der große Nachbar im Süden. Es ist bescheiden und legt viel Wert auf Gemeinsinn. Das zeigt sich auch in der bemerkenswerten Wahl des Greatest Canadian. Als der kanadische Rundfunk CBC im Jahr 2004 in einer Sendereihe und Zuschauerbefragung den Greatest Canadian ermittelte, lag am Ende nicht einer der bekannten Premierminister, ein Militär oder Sportler vorne, sondern ein Mann, den außerhalb Kanadas wohl nur wenige kennen: Thomas »Tommy« Douglas, als Premier der Prärieprovinz Saskatchewan ab 1944 der erste sozialdemokratische Regierungschef nicht nur in Kanada, sondern in Nordamerika. Er ist der Vater von Medicare, des staatlichen Gesundheitswesens, das zunächst in Saskatchewan und dann schrittweise bis 1966 landesweit eingeführt wurde. An zweiter Stelle kam Terry Fox, ein junger Kanadier, der 1980 nach einer durch Krebs bedingten Beinamputation mit Beinprothese einen Marathon of Hope quer durch Kanada begann, um damit Geld für die Krebsforschung zu sammeln. Zwei Personen, die für das »soziale« Kanada stehen. Dazu passt auch, dass volunteer work, also ehrenamtliche Arbeit, in jede Vita und jeden Lebenslauf gehört. Ohne sie sind Bewerbungen auf Arbeitsplätze nahezu aussichtslos.
Kanada ist riesig, wenn man die geografische Größe betrachtet, aber ansonsten eigentlich in jeder Beziehung eine Mittelmacht. Die Nachbarschaft zum US-Riesen und die engen persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen bedingen, dass die Kanadierinnen und Kanadier sich und ihr Land immer wieder mit den USA vergleichen. Dieser Vergleich fällt oft zu ihren Gunsten aus, vor allem, wenn es um Gesellschaft und Soziales geht und nicht um reine wirtschaftliche oder militärische Macht. Das trägt maßgeblich dazu bei, dass man sich als Kanadier im allgemeinen wohlfühlt und manchmal sogar ein Gefühl der moralischen Überlegenheit entwickelt. Aber diesen Vergleich Kanada/USA stellen ja auch die Europäer an. Ich erinnere mich an den Ottawa-Besuch einer deutschen Ministerin, die ich persönlich seit vielen Jahren kannte. »Du lebst ja hier im besseren Teil Nordamerikas«, sagte sie mir. Das war in den Jahren, in denen die Distanz zwischen den liberalen europäischen Staaten und den von Präsident George W. Bush regierten USA besonders groß schien. Dass das im Vergleich zu den Verwerfungen, die sich später in der Trump-Ära auftun sollten, nur atmosphärische Störungen, gewissermaßen peanuts waren, konnte niemand ahnen. Auf jeden Fall scheint Kanada mit seinem staatlichen Gesundheitswesen und Sozialsystem, der strengeren Waffengesetzgebung und Abschaffung der Todesstrafe sowie der – noch bestehenden – weitgehenden Ablehnung evangelikalen Extremismus’ und absurder Verschwörungstheorien den Europäern näher zu sein als die USA. Verwunderlich ist, wie unbekannt Kanada der Außenwelt trotz seines guten Rufs ist. Welche kanadischen Politikerinnen und Politiker sind außerhalb des Landes bekannt? Welche Ereignisse seiner Geschichte? Wie bekannt sind bahnbrechende kanadische Erfindungen, die den Lauf der Welt beeinflussten? Werden kanadische Künstlerinnen und Künstler nicht erst dann wahrgenommen, wenn sie Erfolg in den USA haben und dann als US-amerikanische Künstler gelten? Dieses Land hat mehr zu bieten als Bären und Berge, Eishockey und Ahornsirup. Das soll dieses Buch zeigen.
Kanadier sind stolz auf ihr Land und zeigen diesen Stolz. Dafür steht die Flagge mit dem roten Ahornblatt. Für Besucher aus Ländern, die Probleme mit nationalen Symbolen haben, mag die permanente Präsenz der Flaggen befremdlich wirken. Kanadier sind immer höflich und nie zu direkt: »Excuse me«, selbst wenn man im Supermarkt an einem anderen vorbeigehen will. Selten wird in Diskussionen, sogar im privaten Bereich, eindeutig und klar widersprochen, auch wenn man ganz anderer Ansicht ist. Statt eines unverblümten »Nein« oder »Da stimme ich nicht zu« kommt eher ein ausweichendes »Das ist eine interessante Ansicht«, und man beginnt dann darzulegen, dass man eigent-lich anders denkt. Sich mit Vornamen anzusprechen, ist eher die Regel denn die Ausnahme, man verzichtet auf das formale »Herr« und »Frau«. Das trägt zum Image der Kanadier als ein »relaxtes« Volk bei und entspricht wohl weitgehend der Erfahrung, die viele Urlauber hier machen. Das britische Gen, das das geduldige Warten in einer langen Schlange vor Kinos, Theatern, Stadien und an der Kasse in Supermärkten ermöglicht, ist stark ausgeprägt, was sich in der Covid-Krise bewährt hat. »How are you?«, fragt der Kassierer oder die Kassiererin, worauf man nicht mit einem einfachen »Okay« antworten sollte, denn das hieße so viel wie »Na ja, es geht so«. Man antwortet mit »great« oder »a wonderful day« und hört dann wiederum von seinem Gesprächs-partner ein überschäumendes »phantastic«. Die weiter hinten in der Schlange Wartenden nehmen die Small Talk-bedingten Ver-zögerungen weitgehend gelassen hin. Konzentriert packt der Verkäufer die Waren in Plastiktüten oder in Taschen und Beutel, die der Kunde mitgebracht hat. Das ist Service. Auch das kostet Zeit, aber was soll’s? Wer ungeduldig drängelt, offenbart sich als Tourist, vermutlich aus Europa.
Geduld, nicht nur beim Schlangestehen, gehört zu den kanadischen Tugenden. Mit stoischer Ruhe, man kann auch sagen Lethargie, werden so manche Missstände und Unannehmlich-keiten hingenommen, seien es Mängel im Gesundheitswesen mit vielfach unerträglich langen Wartezeiten auf Operationen oder lebensgefährliche Schlaglöcher in Straßen. Dass Zehntausende Staatsbedienstete wegen des völligen Versagens der zentralisierten Gehaltsabrechnungen des Bundes über Monate und Jahre hinweg nicht korrekt bezahlt wurden und sich mit der Beteuerung der Regierung »Wir arbeiten daran!« zufrieden gaben, gehört in die gleiche Kategorie. »Bei uns wäre nach spätestens einem Monat ein Generalstreik ausgerufen worden«, kommentierte eine junge Frau, die kurz zuvor aus Frankreich nach Kanada eingewandert war, diese kanadische Lethargie. Vor einigen Jahren führte die Kompromisslosigkeit der Tarifparteien des öffentlichen Dienstes dazu, dass inmitten eines strengen kanadischen Winters in Ottawa Busfahrer über Wochen hinweg streikten und unzählige Bürger bei minus 40 Grad zu Fuß gehen mussten, ohne dass dies zu einer Revolution führte. Da wurde ein wenig geklagt, aber statt das Gebäude zu belagern und die Tarifparteien zum Verhandeln bis zum Ergebnis zu zwingen, wurde der Streik einfach hingenommen. Es war eine unserer frühen unvergesslichen und prägenden Erfahrungen.
Aber halt! In einem derart großen und diversen Land droht jedes Pauschalurteil, jede Pauschalbeschreibung ein Fehlurteil zu sein. Welchen Kanadier soll man als Prototyp nehmen und ihn fragen, wie er sich als Kanadier definiert? Die Regionalität und die Multikulturalität erschwert die Suche nach dem »wahren« Kanadier. Es ist klar, dass die Québécoises aufgrund der besonderen Geschichte und ihrer Sprache anders ticken als die Kanadier in »RoC«, dem »Rest of Canada«, denn sie sehen sich als Nation und ihr Provinzparlament als Assemblée Nationale, und wer durch Québec fährt und das Hinweisschild »Capitale Nationale« sieht, sollte sich bewusst sein, dass es dabei nicht um Ottawa, die Hauptstadt Kanadas, sondern Québec, die Hauptstadt der Provinz Québec geht. Ist es der British Columbian mit asiatischen Wurzeln oder der Farmer in der Prärie? Sind es die Großstädter in Toronto, Montréal, Vancouver? Die Menschen in den abgelegenen kleinen Gemeinden im Norden der Provinzen oder in den Territorien, die »vom Land leben« und mit den Städtern in ihrem Lebensstil und bei ihren Alltagssorgen wenig gemein haben? Oder sind es die indigenen Menschen Kanadas, die Inuit, die Métis und die Angehörigen der First Nations? First Nations nennen wir sie, nicht »Indianer«, denn sie sind die »Ersten Nationen« und als First Nations sind sie rechtlich anerkannt und so nennen sie sich selbst.
Wir empfehlen unseren kanadischen Freunden, wenn sie Europareisen planen, sich nicht zuviel auf die Schippe zu laden. Wer die Distanzen in Europa mit denen in Kanada vergleicht, ist versucht, in eine zwei- oder dreiwöchige Europareise mehrere Länder zu packen. Umgekehrt ist das ebenso richtig: Europäer unterschätzen Distanzen und die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf kanadischen Straßen. Der Trans Canada Highway, das Straßennetz von der Atlantik- zur Pazifikküste, ist bekannt, aber man braucht viel Zeit. Eine Autobahn – allein bei diesem aus dem Deutschen bekannten Begriff leuchten bei vielen Kanadiern die Augen – sind Kanadas Highways nicht. Besser, man kommt mehrmals nach Kanada und nimmt sich einzelne Regionen vor. Klar, der Westen ist mit seinen gewaltigen Bergen, den berühmten Nationalparks und der Pazifikküste besonders beliebt. Aber die Ostküste mit den atlantischen Provinzen hat einen besonderen Charme, Québec sowieso, und Ontario bietet mehr als die berühmten Niagara-Fälle und die Metropole Toronto. Oft vergessen wird die Prärie, die ich seit meiner ersten Kanada-Reise liebe – mit ihrer unendlichen Weite. Und hinter dem Horizont geht’s weiter. Die Arktis, die mir am Herzen liegt, zu erkunden, ist eine besondere Herausforderung, zeitlich und finanziell.
Das Buch soll Leserinnen und Leser auf ihrer Reise durch Kanada begleiten und in Geschichte, Politik und Gesellschaft und seine Besonderheiten einführen. Lernen Sie die Kanadier kennen, rund um die Feuerstelle auf Campingplätzen, beim Bummel durch die Städte und beim Small Talk in Geschäften. Wundern Sie sich nicht über das fragende »eh« am Ende einer Aussage oder einer Frage, ausgesprochen wie das »ay« in »day«. »Good day, eh?« Es ist vergleichbar mit dem in einigen deutschen Regionen üblichen »gell«. Es kann als Bestätigung des gerade Gesagten oder als Frage, als Entschuldigung oder einfach so eingesetzt werden. Es ist ein Markenzeichen der Kanadier: Canadian, eh?
Nichts ist so kanadisch wie hockey
Das Mutterland des Eishockey und Lord Stanleys Cup
»Eishockey« würde man in Deutschland sagen. In Kanada ist es schlicht hockey, denn wo sonst als auf Eis soll man Hockey spielen? Kanada ist ja das »Mutterland des Eishockey«. In kaum einem Bericht in europäischen Medien über Eishockey in Kanada darf diese Bezeichnung fehlen. Die ersten Spiele auf Eisfläche und auf Schlittschuhen, die als Hockey bezeichnet werden können, fanden vermutlich zwar vor ein paar Jahrhunderten in England statt, 2008 aber schrieb die International Ice Hockey Federation offiziell das »erste organisierte Eishockeyspiel« in einer Halle Kanada zu: Schauplatz war am 3. März 1875 der Victoria Skating Rink in Montréal. Dass auch das nicht unumstritten ist, schieben wir beiseite. Dem ersten »indoor«-Spiel folgten bald weitere und die Popularität des Spieles wuchs rasant. Kanada hatte daran maßgeblichen Anteil, sodass die Phrase vom »Mutterland« durchaus Berechtigung hat.
Die nordamerikanische Profiliga National Hockey League, die NHL, ist die populärste Sportliga, auch wenn Football und Basketball ihr immer stärkere Konkurrenz machen. Im Frühjahr 1997 – ich war nach Ottawa gekommen, um unseren bevorstehenden Umzug nach Kanada vorzubereiten – saß ich eines Abends in einer Sportsbar im Stadtzentrum. Die Kneipe war voll. Auf mindestens einem Dutzend Bildschirmen waren Hockey-spiele zu sehen. Die Ottawa Senators hatten sich erstmals für die Playoff-Spiele um den Stanley Cup qualifiziert. Entsprechend groß war die Begeisterung in der Hauptstadt. Da saß ich also und beobachtete die Fans. Es war »Hockey Night in Canada«, die populäre Sendung im kanadischen Rundfunk CBC. Nach den ersten 20 Minuten Spielzeit erschien in der Drittelpause auf dem Bildschirm ein Duo von Kommentatoren, einer davon ganz merkwürdig gekleidet in einem unsäglichen geblümten Jackett mit dazu völlig unpassender Fliege. Er sprach nicht, er bellte, und sah dabei wie ein Pit Bull Terrier in die Kamera. »Wer ist denn dieser merkwürdige Mensch?«, fragte ich den jungen Mann, der neben mir saß. Er blickte mich entgeistert an. »Das ist Don Cherry«, sagte er. Dass ich nicht in Schimpf und Schande aus der Kneipe gejagt wurde, als ich fragte, »Und wer ist Don Cherry?«, grenzt an ein Wunder. Ich war so ein Ignorant. Ich kannte Don Cherry nicht, eine Institution des nordamerikanischen Hockey, und wagte es, in einer Kneipe unter Hockeyfans zu sitzen. In den ersten Jahren folgte ich dem bellenden Don Cherry mit Amusement. Irgendwann aber war der Punkt erreicht, dass ich abschaltete, wenn »Coach’s Corner« anstand, der Teil von »Hockey Night in Canada«, der Cherry die Bühne für seine Tiraden bot, in denen er manchmal Europäer in den Teams beleidigte und Kommentare abgab, die nichts mit Hockey, aber viel mit Politik zu tun hatten. 2016 hatten selbst Kanadas Rundfunkanstalten genug von Don Cherry. Sie schickten ihn in den Ruhestand, trotz des Protests vieler eingefleischter Hockeyfans.
Eigentlich ist fast jeder Abend Hockey Night. So war es zumindest in der Vor-Covid-Zeit mit dem extrem langen Spielplan, der von Oktober bis März jedes Team zu mehr als 80 Spielen zwang, bevor es dann endlich wirklich zur Sache ging, zu den Playoffs, an deren Ende der Sieger den Stanley Cup in die Höhe halten konnte. Das war dann meist Anfang Juni und in den Städten im Süden der USA hatten die Clubs Probleme, bei den warmen Außentemperaturen die Eisfläche in der Halle zu kühlen. Covid zwang zum Zusammenstreichen des Programms und die Teams reisten in der Saison 2021 auch nicht mehr zwischen den USA und Kanada hin und her. Die Fans in Kanada wurden damit belohnt, dass eine rein kanadische Division aus den sieben hier beheimateten Teams geschaffen wurde, um grenzüberschreitendes Reisen zu vermeiden. Immer wieder trafen die Ottawa Senators, Montréal Canadiens, Toronto Maple Leafs, Winnipeg Jets, Calgary Flames, Edmonton Oilers und Vancouver Canucks aufeinander und garantierten hohe TV-Einschaltquoten.
Kanada ist stolz auf seine Eishockey-Geschichte. 1892 hatte Generalgouverneur Lord Stanley of Preston, der Vertreter der britischen Krone in Kanada, einen Pokal für das beste kanadische Hockeyteam gestiftet, den Dominion Hockey Challenge Cup, der später zum Stanley Cup wurde. Lord Stanley hatte einige Jahre zuvor sein erstes Hockeyspiel gesehen und war begeistert. In den ersten Jahren wurde der Stanley Cup dem besten kanadischen Amateurclub überreicht. 1926 wurde der Cup zur Trophäe der 1917 in Montréal gegründeten NHL. Dieser gehörten zunächst nur vier kanadische Teams aus Montréal, Ottawa und Toronto an. Erst ab 1924 wurden US-Clubs aufgenommen. Inzwischen haben sich die Kräfteverhältnisse umgekehrt: Von den 31 Teams, die heute in der NHL spielen, sind lediglich sieben aus Kanada. Die Liga wurde wie alle Profiligen Nordamerikas zu einem Wirtschaftsunternehmen. Nicht nur die Spieler sind Handelsware. Wenn Märkte und Einnahmen nicht stimmen, werden Teams verschoben und verkauft. 1995 wanderten die Québec Nordiques nach Denver, wurden zu Colorado Avalanche und gewannen sofort den Stanley Cup durch ein Tor ihres deutschen Spielers Uwe Krupp. Die Winnipeg Jets wurden 1996 nach Phoenix verkauft und zu den Phoenix Coyotes. 2011 wurden die Atlanta Thrashers von einem Unternehmen in Winnipeg gekauft und wieder in Winnipeg Jets umbenannt. Der letzte kanadische Stanley Cup-Gewinner sind die Montréal Canadiens, die die begehrte Trophäe 1993 gewannen. 2021 schien das Ende der Dürreperiode zu bringen. Die Canadiens schafften es tatsächlich in die Finalserie um den Stanley Cup, unterlagen dann aber Tampa Bay.
Hockey ist weiterhin der populärste Sport in Kanada. Nach offiziellen Angaben spielen 630 000 Kanadierinnen und Kanadier Hockey, davon 440 000 im Juniorenbereich. Im ganzen Land wird im Winter auf 5000 rinks, wie die Eislaufflächen heißen, in städtischen Parks Hockey gespielt, auf Teichen oder gefrorenen Flüssen und, abgesehen von ein paar Sommermonaten, ganzjährig indoor in 3300 Hallen und Arenen. In den Parks werden mit Einsetzen der kalten Jahreszeit Spielflächen angelegt. Was-ser wird versprüht, um schrittweise eine solide Eisschicht aufzubauen, Neuschnee wird weggeräumt und mit Schaufeln und Besen oder mit Zambonis, den gewaltigen Eismaschinen, die zum Maschinenpark fast jeder Stadt gehören, werden die skating rinks geschaffen. Dort kommen dann die Hockeyfreunde zusammen, jung und alt, um shinny hockey zu spielen, Hockey einfach nur als fun. Manchmal werden Teams gebildet, indem die Teilnehmer ihre Hockeyschläger auf einen Haufen werfen. Dann wird der Haufen zweigeteilt, die Spieler suchen sich ihren hockey stick und es geht los. Das Klicken der Pucks, der schwarzen Hartgummischeiben, ist dann zu hören, bis es zu dunkel zum Spielen ist oder die Kälte oder der Hunger dem Treiben ein Ende setzen.
Wer im Winter in den Stadtparks an den Eisflächen steht, kann die kleinen Kanadier beobachten, die, kaum dass sie laufen können, auf Schlittschuhen über das Eis rutschen, manchmal einen Hockeyschläger in der Hand und einen Puck vor sich. Und es gibt jenen ewigen Mythos: Den der Väter, die ihren Söhnen »die Liebe zum Spiel« – und damit ist natürlich Hockey gemeint – weitergeben. Nichts sei so kanadisch wie Hockey, und nichts sei so sehr Hockey wie die Beziehung zwischen den großen Eishockeyspielern und ihren Vätern, schreibt der Journalist und Schriftsteller Roy MacGregor in seinem Buch »The Home Team – Fathers, Sons and Hockey«. Als im März 2021 Walter Gretzky starb, der Vater von Wayne Gretzky, horchte die ganze Nation inmitten all der Nachrichten über Covid auf. Walter Gretzky war der »ultimative kanadische Hockey-Dad«. Ohne ihn wäre sein Sohn Wayne nicht das geworden, was er über Jahre in der NHL war, The Great One. Wayne war vier Jahre alt, als sein Vater im Garten im Winter eine Hockeyfläche schuf, auf der sein Sohn dem Puck nachjagen konnte, und der ihn danach auf jeder Etappe seiner Karriere förderte. »Er ist der Grund, weshalb ich mich in das Hockeyspiel verliebte«, sagte Wayne Gretzky, als er den Tod seines Vaters bekannt gab. Walter Gretzky war vermutlich der einzige Hockey-Dad Kanadas, der Autogrammwünsche junger Fans erfüllen musste, wenn er bei Spielen seines prominenten Sohns auf den Zuschauerrängen saß.
Lange Zeit galt nur derjenige, der den kanadischen Paß besaß, wirklich etwas in der NHL. Heute sind weniger als die Hälfte der etwa 800 NHL-Spieler Kanadier. Die kanadischen Teams dominierten über Jahrzehnte Weltmeisterschaften und Olympische Spiele. Mitte der 1950er Jahre aber betraten die sowjetischen Spieler die Eisfläche und beherrschten ab den frühen 1960er Jahren bis zum Untergang der Sowjetunion die Szene. Die Sowjetunion gewann die internationalen Eishockeyturniere. Kanada fühlte sich benachteiligt, weil es lange Zeit keine Profis, sondern nur Amateure zu den Wettbewerben schicken durfte, die gegen die »Staatsamateure« der Sowjetunion keine Chance hatten. Dies führte zu einem Ereignis, das sich tief in die Seele der Kanadier eingegraben hat und an das auch heute noch jeder zurückdenkt, der es damals im September 1972 vor den Bildschirmen und Radiogeräten verfolgte: die berühmte summit series. Die Gipfelserie mit vier Spielen in Kanada und dann mit vier in Moskau, zu der Kanada mit seinen Profis antreten durfte, sollte zeigen, wer das beste Hockey spielt. Für Kanada war klar, dass die Serie beweisen werde, dass nur in Kanada wirklich Spitzenhockey gespielt wird.
Ich hatte von diesem Hockeywettstreit gehört, war aber dann doch sehr überrascht, im Herbst 1997, als wir nach Kanada zogen, zu sehen, welche Bedeutung er immer noch hatte. 25 Jahre waren seit der summit series vergangen, und nun wurde mit Sonderbriefmarken und Sondermünzen dieser Spiele gedacht. Die Spiel-serie war mehr als ein Sportereignis. »Es war ›wir‹ gegen ›sie‹, die freie Welt gegen den Kommunismus, das Gute gegen das Böse«, beschreibt die Zeitung Globe and Mail die damalige Stimmung in Kanada. Einen Spaziergang erwarteten die Kanadier. Aber am 2. September begann die Serie mit einer schockierenden 3:7-Niederlage in Montréal. Die sowjetischen Spieler wie Waleri Charla-mov, Alexander Maltsev und Wladislaw Tretjak im Tor demonstrierten Eishockey in Perfektion und ließen die Kanadier, Tony und Phil Esposito, Bobby Clarke und Ken Dryden und die anderen, zunächst alt aussehen. Nach dem fünften Spiel, dem ersten in Moskau, standen drei Siegen der Sowjetunion nur ein Erfolg Kanadas und ein Unentschieden gegenüber. Aber die Kanadier fanden die Kraft sich aufzubäumen, gewannen die Spiele 6 und 7 und schließlich in Anwesenheit von KP-Chef Leonid Breschnew den Thriller am 28. September mit 6:5. Ein Tor von Paul Henderson 34 Sekunden vor Spielende entschied das Kräftemessen zugunsten der NHL-Profis.
Der Schrei des Fernsehkommentators »Henderson has scored for Canada« – Henderson trifft für Kanada – hat sich in das kollektive Gedächtnis des Landes eingegraben. Es ist vergleichbar mit Herbert Zimmermanns »Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen – Rahn schießt – Tor, Tor, Tor« und »Aus, Aus, Aus, Aus. Das Spiel ist aus« beim Finale der Fußball-WM 1954 zwischen Deutschland und Ungarn. Trotz kanadischer Goldmedaillen für die Männer- und Frauenteams bei den Olympischen Spielen seit 1998, als erstmals NHL-Profis zugelassen wurden, gilt der Erfolg von 1972 weiterhin als ein prägendes Ereignis der Hockeygeschichte Kanadas.
Die NHL hat zwar den Slogan »Hockey is for Everyone« – Hockey ist für jeden – herausgegeben, aber das ist nicht die Realität. Hockey, vor allem im professionellen, aber auch im Amateurbereich, ist immer noch ein »weißer« Sport. Es ist kein Spiegelbild der multikulturellen Gesellschaft Kanadas. Dass Fußball, auf den später noch eingegangen wird, von so vielen jungen Menschen gespielt wird und sein Aufschwung in Kanada zeitlich mit Veränderungen in der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung zusammenfällt, hat auch etwas mit den Kosten zu tun. Die Ausrüstung für Eishockey – Schlittschuhe, Helm, Hockeyschläger und Schutzbekleidung – ist teuer. Newcomers, die Immigranten-familien, die sich eine neue Existenz in Kanada aufbauen, sehen diese Kosten. Sie entscheiden sich dann doch lieber für Basketball oder Fußball. Zudem gibt es auch in Kanada Rassismus auf dem Spielfeld und am Rande des Spielfelds. Historisch mussten Kanadier, die nicht weißer Hautfarbe waren, um den Zugang zu NHL und organisiertem Hockey kämpfen. In den Atlantikprovinzen etablierten afrokanadische Gemeinden 1895 für sich die Coloured Hockey League. Der erste schwarze NHL-Spieler war am 18. Januar 1958 der Kanadier Willie O’Ree, der rassistische Ausfälle von Fans und gegnerischen Spielern ertragen musste. Fred Sasakamoose von der Ahtahkakoop First Nation war in den 1950er Jahren einer der ersten indigenen NHL-Spieler. Im Oktober 2003 spielte mit Jordin Tootoo erstmals ein Inuk in der NHL. Zur gleichen Zeit nominierten die Calgary Flames als erster NHL-Club einen schwarzen Spieler als Kapitän: Jarome Iginla. Tootoo wurde zum Vorbild für junge Inuit erklärt, und über Iginla schrieben nordamerikanische Medien, dies zeige jungen Menschen, dass es in der Liga keine Grenzen gebe, die von der Hautfarbe bestimmt werden. Nein, es müssen noch viele Grenzen eingerissen werden. Nur etwa 40 NHL-Spieler identifizieren sich als BIPOP, was für »Black, Indigenous, People of Colour« steht.
Wie Fußball das multikulturelle Kanada begeistert
Seine Monopolstellung hat Hockey in Kanada mittlerweile verloren. Nicht nur die NHL ist eine US-amerikanisch-kanadische Liga. Das gilt auch für die Baseball- und Basketball-Ligen, in denen neben den US-Teams auch Mannschaften spielen, die in Kanada beheimatet sind. Als die Toronto Raptors im Juni 2019 in der National Basketball League NBA die Finalserie gegen die Golden State Warriors aus Oakland in Kalifornien spielten und am Ende gewannen, stand das ganze Land hinter den Toronto Raptors und die NBA überschattete völlig die NHL, in der zur gleichen Zeit die Playoffs um den Stanley Cup gespielt wurden. Eine kleine Randbemerkung: Basketball wurde zwar nicht in Kanada, aber von einem Kanadier »erfunden«. In dem Städtchen Almonte, 50 Kilometer westlich von Ottawa, wurde 1861 James Naismith geboren. Er studierte Sport und arbeitete als Sportlehrer in verschiedenen Städten. Als Lehrer in Springfield in Massachusetts hatte er 1891 die zündende Idee: Er nagelte Obstkörbe an die Geländer der Zuschauerbühne und ließ seine Studenten Bälle in die Körbe werfen, um sie im Winter in der Halle zu beschäftigen. Er entwickelte Regeln, die körperliche Attacken auf den Gegner untersagten und eine Alternative zu Football sein sollten. Sehr populär ist auch die US-amerikanische Football-Liga NFL, aber Kanada verfügt mit der CFL, Canadian Football League, über eine eigene Liga, und spielt den Sport nach etwas anderen Regeln. All diese Sportarten haben in Kanada begeisterte Fans, ebenso Lacrosse, das neben Hockey der Nationalsport ist und seine Ursprünge im Ballspiel der indianischen Völker hat.
Und dann gibt es den Sport, der noch vor wenigen Jahrzehnten in Nordamerika – in den USA und Kanada – ein Schattendasein fristete: Fußball. Kanadas Gesellschaft hat sich verändert. Im multikulturellen Land Kanada leben viele Millionen Menschen, die aus Ländern kommen, in denen Fußball der Nationalsport ist, und sie haben die Liebe zu Fußball, der hier Soccer heißt, um ihn klar vom Football abzugrenzen, mitgebracht. Angesichts der Liebe der Kanadier zu Eishockey wird gerne übersehen, dass Fußball die meisten registrierten Spieler hat. Exakte Zahlen sind schwer zu ermitteln, aber der kanadische Fußballverband Canada Soccer vermeldet, dass Fußball nicht nur der am schnells-ten wachsende Sport in Kanada, sondern auch der Sport mit den meisten Teilnehmern ist. Nahezu eine Million Kanadierinnen und Kanadier rennen in den Fußballvereinen dem Ball hinter-her. Als Erwachsenensport ist Fußball zahlenmäßig den anderen populären Sportarten unterlegen und als Profisport ist er immer noch unterentwickelt. In diesem weiten Land ist fast unmöglich, eine funktionierende und finanziell einigermaßen solide Profiliga aufzubauen. Aber im Amateur- und Juniorenbereich ist Fußball ganz groß. Besonders an den Schulen wird Fußball mit Begeisterung gespielt. Von den Hockey Dads haben wir oben schon gehört. In Kanada und den USA sind es jedoch die Soccer Moms, die ihre Kinder zu den Fußballspielen am Nachmittag und an den Wochenenden fahren und dann stundenlang am Spielfeldrand ausharren.
Anders als in Deutschland ist Fußball in Kanada schon lange eine Sportart, die keine Männer- bzw. Jungendomäne ist: Es rennen fast genauso viele Mädchen und Frauen dem Ball hinterher wie Jungen und Männer. Die Frauen sind international auch viel erfolgreicher als die Männer. Die kanadische Männer-Nationalelf hat sich bislang nur einmal für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren können. 1986 waren die Kanadier dabei, verloren aber in der Vorrunde ihre drei Spiele und fuhren ohne ein einziges erzieltes Tor nach Hause. Auf der FIFA-Rangliste stehen Kanadas Fußballfrauen unter den Spitzenteams, während die Männer in niedrigeren Regionen dümpeln. Seit 1995 qualifizierten sich Kanadas Fußballerinnen für jede Weltmeisterschaft und 2015 war Kanada selbst Gastgeber der Frauen-WM. Wer sich für Frauenfußball interessiert, dem sagt der Name Christine Sinclair etwas: Mit 186 Toren in 296 internationalen Spielen steht die Kanadierin an der Spitze der FIFA-Torschützenliste.
Im multiethnischen Kanada finden die internationalen Fußballturniere, der FIFA Weltcup und die Euro, und die Spiele der europäischen Champions League viel Anklang. Die meisten WM- und Euro-Spiele werden live im Fernsehen übertragen und für die ethnischen Gemeinden sind Spieltage große Feste. In den Metropolen Kanadas sind Stadtgebiete, die als »Little Italy« oder »Greek Town« bekannt sind, mit Flaggen geschmückt. Die Spanier feiern Fußball ebenso wie viele afrikanische, süd- und mit-telamerikanische Gemeinden. Als in Kanada die Junioren-Männer-WM und die Frauen-WM stattfanden, war die Stimmung auf den Rängen der restlos ausverkauften Stadien überwältigend. Für die Teams schienen es Heimspiele vor enthusiastischen Zuschauermengen zu sein. Es wurde gesungen und getrommelt und nach den Spielen mit Autokorsos das Ereignis gefeiert. Das multikulturelle Kanada zeigt sich bei solchen Gelegenheiten von seiner schönsten Seite. Und Kanada demonstriert seine Liebe zum Sport, nicht nur für Eishockey.
Von Meer zu Meer zu Meer
Blick auf die Geschichte – ein großes Land entsteht
Der Leuchtturm von Bonavista liegt einige hundert Meter außerhalb des gleichnamigen kleinen Städtchens auf einer Anhöhe hoch über der Atlantikküste Neufundlands. In der Ferne ziehen Eisberge vorbei, mit etwas Glück zeigen sich auch einige Grauoder Buckelwale. Der Blick auf den Ozean ist überwältigend – falls die Küste nicht in dicken Nebel gehüllt ist, wie ich es vor einigen Jahren erlebte. Einem gewissen Giovanni Caboto jedenfalls ging es ganz anders. Er war offenbar begeistert, als er an dieser Stelle stand und »Buona Vista« ausrief, welch eine herrliche Aussicht, was dem Ort später seinen Namen geben sollte.
Es war der 24. Juni 1497. Giovanni Caboto, in Kanada besser unter seinem anglisierten Namen John Cabot bekannt, wollte eigentlich einen Seeweg nach Asien finden. Nun war er nach den Wikingern des beginnenden 11. Jahrhunderts der erste Europäer, der seinen Fuß auf diesen Teil des nordamerikanischen Kontinents setzte.
So ganz gesichert ist die Geschichte nicht, denn die Aufzeichnungen und Logbücher Cabotos, eines Seefahrers venezianischer Herkunft im Dienst der englischen Krone, verschwanden. Viele Spuren, die heute noch nachvollzogen werden können, hat er in Kanada nicht hinterlassen. Er gründete keine Siedlung und offenbar wagte sich die 19-köpfige Besatzung der »Matthew« auch nicht ins Landesinnere. Möglich ist auch, dass Caboto nach einer mehrwöchigen Reise, die Anfang Mai 1497 in Bristol in England begonnen hatte, nicht die Bonavista-Gegend in Neufundland erreicht hatte, sondern eine Bucht an der Strait of Belle Isle zwischen Labrador und der Insel Neufundland, vielleicht auch die Küste der Cape Breton Island, die zur heutigen kanadischen Provinz Nova Scotia gehört. Oder er hatte gar an der Küste des heutigen US-Bundesstaats Maine angelegt.
Diese kleinen Ungewissheiten sollten 500 Jahre später kein Hindernis sein, die Reise Cabotos mit einer Replika der »Matthew« nachzuvollziehen. Als das in Bristol gebaute Schiff am 24. Juni 1997 im Hafen von Bonavista in Neufundland, Cabotos »New Found Land«, anlegte, wurde die Besatzung von Königin Elizabeth II. und Premierminister Jean Chrétien begrüßt. Nicht in Feierstimmung war eine Delegation der First Nations, die mit Trommeln und Gesang auf das Schicksal der indigenen Völker Neufundlands und vor allem der Beothuk aufmerksam machte. Für die First Nations ist Cabotos Reise von 1497 der Beginn der Kolonisierung und des Untergangs der Beothuk. Der vermutlich letzte Beothuk erlag 1829 der Tuberkulose.
Das Interesse Englands an dieser Küste hielt sich vor mehr als 500 Jahren aber trotz des Fischreichtums des Atlantiks zunächst in Grenzen. So konnten auch Franzosen, Spanier und Portugiesen die Fischgründe nutzen oder im St.-Lorenz-Golf Wale jagen. Als wertvolles Überseeterritorium sah die britische Krone das heutige Kanada erst, als sich der Pelzhandel zu einem lukrativen Geschäft entwickelte und zudem der französische König Niederlassungen entlang des St.-Lorenz-Stroms gründete.
Ein ganz junges Land?
Kanadier sind begeistert, wenn sie historische Stätten in Europa sehen. Das ist für viele »Geschichte«. Aber Kanada ist kein »geschichtsloses« Land. Sicher: Der Staat, wie wir ihn jetzt kennen, ist ein junges Land, auch unter Einschluss der Besiedlung durch die Europäer, die vor 500 Jahren einsetzte. Die Dimensionen verschieben sich erst, wenn wir die Geschichte der indigenen Völker einbeziehen, deren Lebensraum dieses Land seit Jahrtausenden ist und denen ein späteres Kapitel gewidmet ist. Auf meiner ersten Reise fielen mir die Hinweisschilder »Place of Historic Interest« auf. Immer wieder hielt ich an, auch wenn außer des Hinweisschilds mit erklärenden Informationen nichts zu sehen war. Aber ich machte mir Notizen: über Siedler, die an dieser Stelle eine Gemeinde gegründet hatten, über einen Fluss, auf dem Trapper, coureurs du bois und voyageurs mit ihren Kanus paddelten, über indigene Völker, die hier zum Handel zusammenkamen, oder über Schlachten – zwischen Engländern und Franzosen, zwischen Briten und Amerikanern oder zwischen First Nations. Diese Schilder »Place of Historic Interest« ziehen sich wie eine Kette durch das Land. Kanada hat eine interessante, atemberaubende Geschichte, wenn man genau hinblickt. Sie ist über Jahrhunderte oft ein Spiegelbild europäischer Geschichte.
Kehren wir zurück in die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts. Weitaus mehr als von Cabotos Ausflügen wissen wir von den Reisen Jacques Cartiers. Cartier, der 1491 in Saint-Malo in der Bretagne geboren wurde, überquerte zwischen 1534 und 1542 dreimal den Atlantischen Ozean und erkundete den St.-Lorenz-Golf. Er kam bis in die Gegend der heutigen Städte Québec und Montréal. Er schuf die Voraussetzungen für die französische Landnahme in Nordamerika, und manche Historiker sehen ihn daher als Gründer Kanadas. Auf seiner ersten Reise 1534 segelte Cartier von Neufundland durch die Strait of Belle Isle in den St.-Lorenz-Golf und dann in die Gaspé-Region. Dort traf er Angehörige der Irokesen-Völker, die zur Robbenjagd aus der Gegend der heutigen Stadt Québec an die Küste gekommen waren. Als Cartier nach Frankreich zurückkehrte, hatte er zwei Söhne des Irokesen-Chiefs Donnacona an Bord. Das geschah zwar angeblich mit Zustimmung Donnaconas, ging aber offenbar nicht ganz ohne Zwang und Täuschung vonstatten und kann daher auch als Entführung der Söhne bezeichnet werden. Die Franzosen brauchten Dolmetscher und die jungen Männer lernten in den acht Monaten, die sie bis zur zweiten Cartier-Reise in Frankreich verbrachten, genug Französisch, um den Forscher und seine Crew in ein Gebiet zu führen, das sie als »kebec« bezeichneten, »wo sich der Fluss verengt«. Hier wird aus dem kilometerbreiten St.-Lorenz-Golf, der einem Meer gleicht, ein Fluss. Cartiers Begleiter beschrieben den Weg in ihre Siedlung als »route de kanata«, denn »kanata« bedeutet in ihrer Sprache Dorf oder Siedlung. In seinen Aufzeichnungen hielt Cartier dies als »route de Canada« fest und nannte das Herrschaftsgebiet von Häuptling Donnacona »Royaume du Canada« und dann »Province du Canada«. Der große Fluss, der jetzt St.-Lorenz-Strom heißt, war der »Grande Rivière de Canada«. Es gilt – trotz einiger anderer Theorien – als weitgehend gesichert, dass das Wort »kanata« Ursprung des Landesnamen Kanada/Canada ist.