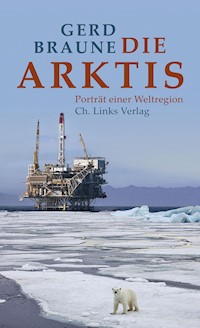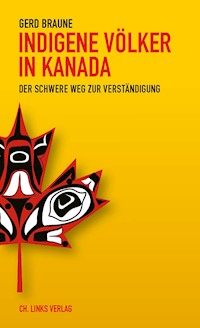
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In Europa gilt Kanada im Vergleich zu den USA als »der bessere Teil Nordamerikas«. Doch der Umgang mit der indigenen Bevölkerung ist auch hier ein Sündenfall: Noch bis vor wenigen Jahrzehnten wurde mit teils brutalen Maßnahmen versucht, die kulturelle Identität dieser Menschen auszulöschen und sie zu assimilieren. Wie erfolgversprechend ist da der vor Kurzem eingeleitete Versöhnungsprozess?
Gerd Braune hat indigene Gemeinden im ganzen Land besucht und mit Vertretern der drei indigenen Völker, First Nations, Inuit und Métis, gesprochen. Er erzählt ihre Geschichte vor und nach Ankunft der Europäer und seit der kanadischen Staatsgründung. Vor allem aber berichtet er, wie die indigenen Völker heute leben und um ihre Rechte kämpfen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Gerd Braune
Indigene Völkerin Kanada
Der schwere Weg zurVerständigung
Ch. Links Verlag
Für Ute
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
1. Auflage, September 2020entspricht der 1. Druckauflage vom September 2020© Christoph Links Verlag GmbHPrinzenstraße 85 D, 10969 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0www.christoph-links-verlag.de; [email protected]: Burkhardt Neie, xix, unter Verwendungeiner Grafik von Shutterstock (378511348)Lektorat: Dennis Grabowsky, BerlinSatz: Nadja Caspar, Ch. Links Verlag
ISBN 978-3-96289-097-1
eISBN 978-3-86284-483-8
Inhalt
Versöhnung am Scheideweg. Eine Zerreißprobe für die Politik des Ausgleichs
Reconciliation – Heilen und respektvolles Miteinander · »German Indianthusiasm« oder »Die deutsche Indianertümelei« · Die Anerkennung von First Nations, Inuit und Métis als indigene Völker · Die Entkolonialisierung von Sprache
Die Schildkröte im Weltenmeer. Nordamerika, ein indigenes Territorium seit Urzeiten
Wider die »Doktrin der Entdeckung« · Fußspuren am Lagerfeuer · Frühe Migration mit Booten · Áísínai’pi – in Stein geschrieben · Die Wanderung in die Arktis · Die Kulturräume · Als Kolumbus kam
Verbündete und Gegner. Die indianischen Völker vor der Staatsgründung Kanadas 1867
»Vorsichtige Kooperation« · Die ersten Verträge · Konföderationen und Koalitionen · Widerstand gegen die europäischen Eindringlinge · Eine »indianische Magna Charta« · Tecumseh und der Krieg von 1812 · Von Partnerschaft zu Unterwerfung
Eine Nation am Nass River. »Modern Treaties« und das Ringen um Landrechte
Der Weg der Nisga’a aus der Bevormundung · 1000 Kilometer mit dem Kanu · Von Meer zu Meer zu Meer
Missverständnisse und Täuschung. »Numbered treaties«, die Besiedlung des Westens und kolonialistische Gesetze
Verträge als Instrument zur Assimilierung · Sprachbarrieren und Irreführung · Gefangene auf dem eigenen Land · Der »Indian Act« – Ärger und Leid
Dunkle Seiten Kanadas. Residential Schools und die Entschuldigungen kanadischer Regierungen
Die Geschichte der Residential Schools · Der Beginn der Aufarbeitung · »Die Regierung von Kanada bittet um Vergebung« · Ein Überlebender spricht: Interview mit Phil Fontaine · Die Wahrheits- und Versöhnungskommission · Trudeaus Entschuldigung in Neufundland und Labrador · Fast vergessen – die Indian Day Schools · Der »Sixties Scoop« · Fragwürdige Jugendfürsorge bis in die Gegenwart · Die Tragödie der ermordeten indigenen Frauen
Das lange vergessene Volk. Die Métis, eine Kultur zwischen First Nations und europäischen Einwanderern
Die Métis-Nation, im Kampf geboren · Louis Riel, der Gründer Manitobas · Landbetrug durch »Scrip« · Wiedererwachen des politischen Bewusstseins · Beziehung von Regierung zu Regierung · Flaggen zu Ehren der Métis und Riels
Drei Millionen Quadratkilometer in der Arktis. Inuit Nunangat, die Heimat der Inuit
Akitsiraq – der Ort, an dem Recht gesprochen wird · Die modernen Verträge der Arktis · Zwangsumsiedlung und der Bruch im Lebensstil · Mumilaaq Qaqqaqs Einsatz für mentale Gesundheit · Einheit und Stärke im hohen Norden
Soziale Ungleichheiten. Das fragile Gesundheitswesen in den abgelegenen indigenen Gemeinden
Die Spanische Grippe – We All Expected to Die · Das Trauma der Tuberkulose-Sanatorien · »Dritte Welt« im reichen Kanada · Transformation des Gesundheitssystems
Der Wein der Osoyoos Indian Band. Unternehmergeist und anhaltende wirtschaftliche Probleme
Eine »Indian Band« als Arbeitgeber · Ökonomische Versöhnung · Weniger Arbeitsplätze, höhere Arbeitslosigkeit · Öko-Tourismus und Ölwirtschaft · Der weite Weg zu gleichem Wohlstand
Eine besondere Universität in Regina. Selbstbestimmung im Bildungswesen
Schulen am Polarkreis · Schrittweise Erfolge · Shannens Traum · Gefährdete indigene Sprachen · »Wir werden uns nie mehr schämen, unsere Sprachen zu sprechen« · Muttersprache und Zweitsprache · Spätes Lernen, hoffentlich nicht zu spät
Die Rückkehr der Zeremonien. Powwow, Künstlergemeinden und die indigene Kultur der Gegenwart
Der Adler über dem Festplatz · Ein Nationales Indigenes Theater · Unikkaaqtuat – die alten Erzählungen · Die Renaissance des Kehlgesangs · Die Inuit-Kulturhauptstadt Kanadas · Kulturelle Aneignung · Ein völlig anderer Weg
Der schwere Weg zur Reconciliation. Rückschläge und Hürden auf dem Pfad zu respektvollem Miteinander
Rassismus und Diskriminierung · Doppelte Staatsangehörigkeit · »Wir können nicht aufgeben«
Anhang
Anmerkungen · Abbildungsnachweis · Karte · Dank · Der Autor
Versöhnung am Scheideweg
Eine Zerreißprobe für die Politik des Ausgleichs
Brennende Autoreifen, Holzpaletten, die in Flammen aufgehen, blockierte Eisenbahnlinien und Straßen: Im Februar 2020 beobachten die Kanadier mit Verwunderung, Überraschung, Entsetzen und Enttäuschung, dass die von Premierminister Justin Trudeau und seiner liberalen Regierung seit 2015 geförderte Versöhnung zwischen Kanadas nichtindigener und indigener Bevölkerung noch lange nicht erreicht ist. Der Konflikt um den Bau einer Erdgaspipeline auf dem Territorium des Volks der Wet’suwet’en in der westlichen Provinz British Columbia und die dadurch ausgelösten landesweiten Protestaktionen setzen eine Politik, die auf Ausgleich, Verständigung und respektvollen Umgang miteinander baut, einer Zerreißprobe aus. Als zwischen Toronto und Kingston die Polizei auf dem Territorium Tyendinaga der Mohawk die Blockade einer der wichtigsten Eisenbahnlinien des Landes räumt und einige Demonstranten vorübergehend festnimmt, sind Plakate zu sehen, die postulieren: »Reconciliation is dead!« – Die Versöhnung ist tot. In Kanadas Hauptstadt Ottawa ziehen Demonstranten mit Mohawk-Flaggen, Trommeln und Gesang vor das Parlament. Sie fordern, dass sich die Polizei aus dem Territorium der First Nations zurückziehen müsse.
Den Bemühungen, Vertrauen zwischen dem kanadischen Staat und den indigenen Völkern aufzubauen, droht in den ersten Monaten des Jahres 2020 ein erheblicher Rückschlag, trotz der ebenfalls zu hörenden Parolen »Reconciliation is alive« – Die Versöhnung lebt weiter. Nach Jahren des feierlich beschworenen Wegs zur Aussöhnung und vielen kleinen und größeren Erfolgen auf diesem Pfad – der langsamen Verbesserung der Lebensverhältnisse in Reservationen und abgelegenen Gemeinden der indigenen Völker und der Anerkennung ihrer Rechte – muss die kanadische Mehrheitsgesellschaft erleben, dass eine gleichberechtigte und respektvolle Koexistenz mit den indianischen Völkern, den First Nations, und den Inuit und Métis offenbar noch in weiter Ferne liegt. Wird es gelingen, die Politik der Versöhnung fortzusetzen? Das Wort der »Truth and Reconciliation Commission« vom Herbst 2015, die Versöhnung stehe am Scheideweg – »Reconciliation at the crossroads«1 –, gewinnt unerwartete Aktualität.
Über mehrere Wochen zieht sich die Krise hin. Die Trudeau-Regierung widersetzt sich unverantwortlichen Forderungen unter anderem des konservativen Parteivorsitzenden Andrew Scheer, hart durchzugreifen. Trudeau will den Dialog: »Dies ist ein kritischer Moment für unser Land und unsere Zukunft. Es gibt keine Beziehung, die für mich und Kanada wichtiger ist als die Beziehungen zu den indigenen Völkern.« Perry Bellegarde, der National Chief und Vorsitzende des Dachverbands »Assembly of First Nations« (AFN), konstatiert: »Wir werden Versöhnung niemals durch Gewalt erreichen.«2
Ende Februar setzen sich die Hereditary Chiefs der Wet’suwet’en und die Bundes- und Provinzregierung schließlich an einen Tisch und handeln eine Vereinbarung aus, die den Weg für eine Beendigung der Blockaden und eine friedliche Beilegung des Konflikts freimachen soll. Sie verständigen sich auf zügige Gespräche über die Rechte der Wet’suwet’en auf ihrem traditionellen Territorium, finden aber zunächst keine Lösung im Konflikt um die Pipeline, die offensichtlich von der Mehrheit der Wet’suwet’en abgelehnt wird, aber auch Unterstützer hat, selbst unter den Chiefs. Ein für Mitte März geplantes Treffen aller Chiefs der Wet’suwet’en zur Beilegung der Krise muss dann aber wegen einer anderen Krise, der Coronaviruspandemie, verschoben werden.
Als das Konzept für dieses Buch ausgearbeitet wurde, war die dramatische Entwicklung vom Januar und Februar 2020 nicht zu erwarten, aber sie rückte die fragilen Beziehungen zwischen beiden Seiten wieder in das Augenmerk nicht nur der Kanadier, sondern fand auch international Aufmerksamkeit. Das Buch soll einen Überblick über die indigenen Völker Kanadas geben, die First Nations, die Inuit und die Métis, ihre Geschichte und ihre Rolle und Position im heutigen Kanada. Vor allem geht es in diesem Buch um »Reconciliation«, um Versöhnung und Verständigung, die Auseinandersetzung mit dunklen Seiten kanadischer Geschichte und den Versuch, respektvolle Beziehungen aufzubauen. Ich möchte die Leser zu einigen Schauplätzen führen, anhand derer ich die »Geschichte« erzählen will. Viele dieser Schauplätze habe ich bei zwei Kanada-Reisen 1978 und 1982 und im Zuge meiner Korrespondententätigkeit in Kanada seit 1997 besucht und dabei viele interessante indigene und nichtindigene Gesprächspartner getroffen. Ich stütze mich auf aktuelle Recherchen und Quellen, aber auch auf nachrichtliche Texte, Features und Reportagen, die ich in den vergangenen 23 Jahren geschrieben habe. Ich werde meine Gesprächspartner ausführlich zu Wort kommen lassen, nicht nur in Fußnoten.
Reconciliation – Heilen und respektvolles Miteinander
»Reconciliation«, Versöhnung oder Aussöhnung, ist ein zentraler Begriff in der kanadischen Politik, wenn es um die Beziehungen zwischen der nichtindigenen und der indigenen Bevölkerung geht. Er fehlt in keiner Rede, in keinem Dokument, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Diese Bedeutung hat »Reconciliation« aber erst in den vergangenen Jahren erlangt. Nach der Oka-Krise von 19903 war eine Untersuchungskommission, die »Royal Commission on Aboriginal Peoples«, eingesetzt worden. Als sie 1996 ihren mehrbändigen, 3500 Seiten langen Bericht über die kritische Lage der indigenen Völker Kanadas vorlegte – damals hieß es »aboriginal peoples« –, tauchte der Begriff »Reconciliation« noch nicht auf, weder im Vorwort des zusammenfassenden Bandes noch im Schlusswort, das eine Beschreibung des Wegs in den kommenden 20 Jahren enthielt. Festgehalten wurden aber die Bedingungen für eine »faire und auf gegenseitiger Achtung beruhende Beziehung« zwischen indigener und nichtindigener Bevölkerung, die Beendigung kolonialistischer Politik und die Notwendigkeit, dass Kanada akzeptiert, dass die indigenen Völker »Nationen« sind: dass sie politische und kulturelle Gruppen mit Werten und Lebensstil sind, die sich von denen der anderen Kanadier unterscheiden. Dabei wird »Nation« nicht im Sinne eines Nationalstaates gesehen, der Unabhängigkeit von Kanada sucht, sondern als Einheit mit eigener Geschichte und dem Recht zur Selbstregierung in Partnerschaft mit Kanada.4
Zwei Jahre später, am 7. Januar 1998, legte die kanadische Regierung das Dokument »Gathering Strength – Canada’s Aboriginal Action Plan« mit einem »Statement of Reconciliation« vor.5 Zentraler Punkt der Versöhnungserklärung war das Eingeständnis, dass Kinder der indigenen Völker in den vom Staat errichteten Residential Schools, Internaten fernab der Reservationen, körperlicher Gewalt bis hin zum sexuellen Missbrauch ausgesetzt waren. Die Residential Schools gehören zu den dunkelsten Kapiteln kanadischer Geschichte.
Spätestens seit Veröffentlichung der Versöhnungserklärung ist »Reconciliation« ein Begriff des politischen Diskurses und des politischen Handelns. 2008 sprach der konservative Premierminister Stephen Harper im Parlament für die Regierung und das kanadische Volk eine formelle Entschuldigung aus.6 2009 nahm die »Truth and Reconciliation Commission« unter Vorsitz von Richter Murray Sinclair aus dem Volk der Ojibwe ihre Arbeit auf. Sie hatte das Mandat, »die Kanadier durch die schwierige Entdeckung der Fakten hinter dem System der Residential Schools zu leiten« und zudem die Grundlage für eine dauerhafte Versöhnung in ganz Kanada zu schaffen.7 Die Wahrheits- und Versöhnungskommission hörte die Überlebenden, die »survivors«, des Residential-School-Systems an und veröffentlichte 2015 ihren Bericht, in dem sie das System und die staatliche Politik gegenüber den indigenen Völkern als »kulturellen Genozid« bezeichnet.
»Die Wahrheit aufzudecken, war schwer. Zur Versöhnung zu kommen, wird schwerer«, stellt die Kommission fest.8 Reconciliation – ich möchte so oft wie möglich diesen englischsprachigen Begriff verwenden und schreibe ihn deshalb ab sofort ohne Anführungszeichen – bedeutet, die Ereignisse der Vergangenheit zu begreifen, sich dieser Vergangenheit bewusst zu werden und eine Beziehung zu schaffen, die von Respekt gekennzeichnet ist. Nach dem Bericht der »Royal Commission on Aboriginal Peoples« von 1996 hat Kanada nach Ansicht der »Truth and Reconciliation Commission« nun eine zweite Chance zur Reconciliation.
Dies bedeutet zunächst, dass den indigenen Gemeinden, den Familien und Einzelpersonen im Heilungsprozess geholfen wird, das Trauma der Residential Schools und der destruktiven Folgen kolonialer Politik zu überwinden. Die kanadische Gesellschaft muss sich verändern, damit beide Seiten in Würde und gegenseitiger Achtung zusammenleben können. Sie müssen ihre jeweilige Geschichte kennen und an den Schulen lehren. Die Beziehungen zwischen den Regierungen des Bundes und der Provinzen zu den indigenen Völkern müssen sich ändern: Der paternalistische, bevormundende Ansatz des kanadischen Staates, der meint, für die Betroffenen handeln zu müssen statt mit ihnen, muss der Vergangenheit angehören. Selbstverwaltung, Selbstregierung und Selbstbestimmung der indigenen Völker müssen gestärkt werden. Dazu gehören Gesetze, die gemeinsam ausgearbeitet werden, wie etwa die im Sommer 2019 beschlossenen Gesetze über den Schutz und die Stärkung der indigenen Sprachen oder die Übernahme der Jugendfürsorge durch indigene Gemeinden und Organisationen. Und dazu gehören Verträge, die die First Nations, die Inuit und Métis mit den Regierungen schließen und die frühere Verträge aktualisieren, ergänzen oder komplett ersetzen und die Selbstbestimmung stärken. Das von Gerichten vielfach anerkannte Recht der indigenen Völker auf Mitbestimmung bei der Nutzung und Ausbeutung ihres traditionellen Siedlungsgebiets, die Anerkennung, dass es das Land der indigenen Völker ist, wenn es nicht durch faire, bindende Verträge übertragen wurde, muss gängige Praxis werden. Der Konflikt um die Erdgaspipeline auf dem Gebiet der Wet’suwet’en im Februar 2020 zeigt, dass es hier noch Defizite gibt.
Vor allem bedeutet Reconciliation, dass das Vertrauen, das über mehr als 150 Jahre hinweg völlig zerstört wurde, wiederhergestellt wird. Vertrauensvolle, respektvolle Beziehungen bedeuten darüber hinaus, dass indigenes Recht und indigene rechtliche Traditionen etwa bei der Entscheidungsfindung und im Justizsystem anerkannt werden. Dies ist ein schweres Unterfangen angesichts der Unterschiede in Entscheidungsprozessen und im Verständnis von Konsultation und Zustimmung. Kompetenzen müssen neu abgesteckt werden. Für den Staat und die Bürokratie ist dies eine Herausforderung. Ultimaten und Drohungen, das zeigte der Wet’suwet’en-Konflikt, helfen nicht.
»Reconciliation bietet einen neuen Weg des Zusammenlebens«, stellt die Wahrheits- und Versöhnungskommission fest. Steven Point, der frühere Grand Chief des »Stó:lō Tribal Council«, eines Stammestribunals, und Lieutenant-Governor9 von British Columbia, sagte in einer Anhörung: »Ich werde weiter über Versöhnung sprechen. Aber es ist ebenso wichtig, den Heilungsprozess in unserem Volk zu fördern, sodass unsere Kinder diese Schmerzen nicht mehr erleiden, dass wir diese Zerstörung vermeiden und am Ende unseren berechtigten Platz in diesem ›unserem Kanada‹ einnehmen.«10 Reconciliation, Versöhnung und Verständigung brauchen Zeit.
»German Indianthusiasm« oder »Die deutsche Indianertümelei«
Warum sind Europäer und vor allem die Deutschen so fasziniert von den indigenen Völkern Nordamerikas? Diese Frage hörte ich mehrfach von Kolleginnen und Kollegen und Bekannten, mit denen ich über dieses Buchprojekt sprach. Manchmal sprachen sie von Besessenheit: »Why are you so obsessed?« Einige wussten etwas über die Wurzeln dieser Begeisterung: Gab es nicht einen deutschen Schriftsteller, der über »Indianer« schrieb?
Gemeint war damit natürlich Karl May mitsamt seiner imaginären Figuren Winnetou und Old Shatterhand. Ich erzählte dann über die Bedeutung der Bücher von Karl May und insbesondere der Filme, die in den 1960er Jahren gedreht wurden. Ich erzählte, dass es in Deutschland Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg und Elspe gibt und ich Winnetou, sprich Pierre Brice, in Winnetou III in Bad Segeberg sterben sah. Ich erwähnte auch James Fenimore Cooper und seine Lederstrumpf-Romane, Chingachgook und Uncas, die »letzten Mohikaner«, und die Faszination, die bis zum heutigen Tag die Romane von Jack London ausüben, welche jährlich viele Deutsche in das Yukon-Gebiet führen, wo sie die Atmosphäre der Goldrausch-Zeit und First-Nation-Kultur erleben wollen.
Hartmut Lutz, emeritierter Professor für Nordamerika-Studien und indigene Literatur an der Universität Greifswald, hat diese Faszination vieler Deutscher wissenschaftlich erforscht. Mittlerweile wird sie auch mit »Indianthusiasmus/Indianthusiasm« beschrieben. Der 1945 geborene Forscher stellt sich immer wieder die Frage, wie es möglich sein kann, dass ein Volk, in dem der Rassismus so tief verwurzelt ist, dass es den Holocaust ermöglichte, andererseits eine fremde Ethnie so glorifiziert und romantisiert.
Zusammen mit anderen Autoren hat Lutz den Band Indianthusiasm – Indigenous Responses herausgegeben.11 Die Aufsätze setzen sich kritisch mit den europäischen Fantasien über die indigenen Völker Nordamerikas, den »indianischen« Themenparks und den deutschen Hobby-Indianern auseinander, die sich in Camps zusammenfinden, Powwow12 veranstalten und vorgeblich indianischen Lebensstil imitieren. Die Wurzeln dieser Faszination und der romantisierenden Darstellung der Vergangenheit sehen einige der Autoren im deutschen Kolonialismus des 19. Jahrhunderts.
»Indianerspielen ist Teil der deutschen Kultur«, sagt Lutz in einem Gespräch mit mir. Denn Karl May hat mit seinen Büchern, so unrealistisch sie auch sein mögen, über viele Jahrzehnte das »Indianerbild« in Deutschland geprägt. Er beurteilt das »Indianerspielen« erwachsener Menschen und ihren Indianerhobbyismus kritisch. »Manches ist rassistisch, zumindest infantil. Die Realität wird nicht wahrgenommen, es ist eskapistisch, also eine Flucht in eine Scheinwelt.« Die »Indianertümelei« hat nach seiner Ansicht dazu geführt, den Blick auf »die Indianer« zu verstellen. Sie spiegelt aber auch Hochmut wider: »Ich eigne mir eine andere Kultur an und betreibe sie als Hobby.« Andererseits kann »Indianthusiasmus« auch dazu führen, sich ernsthaft mit der Gegenwart und der Lage der indigenen Völker auseinanderzusetzen und damit Solidarität mit indigenen Völkern schaffen, meint Lutz.
In Kanada wird der deutsche »Indianthusiasm« teils amüsiert, teils äußerst kritisch gesehen. Anders als an Fastnacht und Karneval in Deutschland sieht man an Halloween in Kanada keine Kinder in »Indianerkostüm« herumlaufen. Dies würde als rassistisch und »politically incorrect« verurteilt. Für den kanadischen Rundfunk CBC reiste 2018 der Ojibway-Autor Drew Haydn Taylor für die Dokumentation Searching for Winnetou nach Deutschland, besuchte »Indianercamps« und sprach mit Hobbyindianern, um zu erkunden, was hinter dieser »Besessenheit« steckt. Nach Ausstrahlung der Dokumentation wurde ich sehr oft auf diese deutsche Faszination angesprochen. Sie wird nicht nur als »funny« gesehen. Kanada diskutiert sehr intensiv über »kulturelle Appropriation«, die kulturelle Aneignung, wie das unbefugte und nicht authentische Zueignen anderer Kulturen bezeichnet wird. Wo ist die Grenze zwischen kultureller »Aneignung/Appropriation« und kultureller »Wertschätzung/Appreciation«? In einem Blog zu der CBC-Dokumentation kommt Red Haircrow, ein Schriftsteller und Filmemacher mit Chiricahua-Apache-, Cherokee- und afroamerikanischen Wurzeln, zu dem Urteil, dass »native hobbyism« eine moderne Form des Kolonialismus sei.13
Die Anerkennung von First Nations, Inuit und Métis als indigene Völker
In diesem Buch geht es nicht um Winnetou und Indianerromantik. Es geht um die indigenen Völker im heutigen Kanada, die in der Verfassung von 1982 anerkannt sind, die First Nations, Inuit und Métis. Es geht um ihre Geschichte, die Probleme und die Fortschritte und Erfolge bei der Gestaltung der Beziehungen zwischen ihnen, den ursprünglichen »Eigentümern« des Landes, und den Neuankömmlingen: Briten, Franzosen und den späteren Immigranten. Der »British North America Act« von 1867, die Gründungsverfassung Kanadas, unterwirft »Indianer und Land, das Indianern vorbehalten ist«, der Autorität der Bundesregierung, »als seien sie Bergwerke und Straßen«, wie die »Royal Commission on Aboriginal Peoples« 1996 sarkastisch anmerkt. Die Verfassung von 1867 spricht nicht von Rechten dieser Bevölkerungsgruppen. Dagegen gelang es den indigenen, damals als »aboriginal peoples« bezeichneten Völkern und ihren Unterstützern in der »Aboriginal Rights Coalition«, Garantien ihrer Rechte in der 1982 unter Premierminister Pierre Trudeau verabschiedeten Verfassung zu verankern, obwohl dies zu Beginn der Verfassungsberatungen nicht geplant war. In Abschnitt 35 des Verfassungsgesetzes heißt es nun: »Die bestehenden indigenen Rechte und die Vertragsrechte der indigenen Völker Kanadas werden hiermit anerkannt und bekräftigt.« Das Gesetz stellt zugleich fest, dass »aboriginal peoples« die indianischen, Inuit- und Métis-Völker Kanadas umfasst.14 Auch die kanadische »Charta der Rechte und Freiheiten«, die Bestandteil des Verfassungsgesetzes von 1982 ist, erkennt in Abschnitt 25 die Rechte der indigenen Völker an, zu denen auch ihre Rechte aus früheren Verträgen mit der Regierung gehören.15
Die drei indigenen Bevölkerungsgruppen zeichnen sich durch unterschiedliche Geschichte, Sprache, Kultur und Spiritualität aus. In der Volkszählung von 2016 bezeichneten sich mehr als 1,67 Millionen Bewohner Kanadas als »aboriginal«, also als Angehörige eines der drei indigenen Völker.16 Damit stellen sie etwa fünf Prozent der kanadischen Bevölkerung. Gegenüber der Volkszählung von 2006 stieg die Zahl derer, die sich als indigen/aboriginal definieren, um 42 Prozent an. Dieser bemerkenswerte Zuwachs beruht auf zwei Trends: Zum einen steigt auch bei den indigenen Völkern die Lebenserwartung, und die sehr junge indigene Bevölkerung – 44 Prozent sind jünger als fünf Jahre – hat eine Geburtenrate, die deutlich über dem kanadischen Durchschnitt liegt. Zum anderen aber identifizieren sich mehr Menschen denn je zuvor als indigen. Das deutet darauf hin, dass Selbstvertrauen und Stolz wachsen, Angehöriger eines Ureinwohnervolks zu sein.
Die First Nations, die »indianischen« Völker, sind mit rund einer Million Menschen die größte Gruppe der indigenen Völker. Nach den Ergebnissen der Volkszählung von 2016, die nach »indigener Identität« fragte, sind die Cree mit 356 000, die Mi’kmaq mit etwa 168 000 und die Ojibwe mit etwa 125 000 Angehörigen die größten Völker. Etwa 630 First Nations, die früher oft als »Indian Bands«, indianische Gruppen, bezeichnet wurden, leben in diesem Land.17 Noch existieren rund 60 verschiedene First-Nations-Sprachen, die mehreren großen Sprachfamilien angehören. Viele aber sind vom Aussterben bedroht. Von den eine Million Angehörigen der First Nations sind etwas mehr als drei Viertel, annähernd 750 000, »Status Indians«. Das heißt, sie sind entweder unter dem »Indian Act« als »Indianer« registriert oder bezeichnen sich aufgrund der Verträge der First Nations mit der Regierung als »Status Indians«. Die verbleibenden 230 000 sind »Non-Status Indians«, von denen viele aufgrund des umstrittenen »Indian Act« ihren Status verloren haben, obwohl sie natürlich weiterhin »Indianer« sind.18
Die Mehrheit der First-Nations-Bevölkerung lebt nicht in Reservationen, sondern »off reserve« außerhalb von Reservationen und vor allem in Städten. Weniger als die Hälfte, rund 44 Prozent, ist »on reserve« und somit in Reservationen zu Hause. In Metropolen wie Toronto, Vancouver, Edmonton und Winnipeg leben jeweils Zehntausende Angehörige von First Nations. Auch wenn sie »off reserve« leben, unterhalten die meisten von ihnen enge Beziehungen zu ihren Reservationen.
Tag der indigenen Völker Kanadas, 21. Juni 2017. Von links nach rechts: Clément Chartier, Präsident des »Métis National Council«, Natan Obed, Präsident von »Inuit Tapiriit Kanatami«, Premierminister Justin Trudeau, Perry Bellegarde, »Assembly of First Nations National Chief«.
Die wichtigste Organisation der First Nations ist die »Assembly of First Nations« (AFN) als Dachverband der First Nations, die derzeit von Perry Bellegarde als National Chief geleitet wird.19 Daneben existiert der »Congress of Aboriginal Peoples« unter Chief Robert Bertrand, der sich als Stimme der Non-Status-Angehörigen der indianischen Völker versteht.20
Die Inuit sind das Ureinwohnervolk der Arktis.21 Die 65 000 Inuit Kanadas nennen ihre Heimat Inuit Nunangat. Sie erstreckt sich über die gesamte kanadische Arktis. Die Sprache der Inuit ist Inuktut mit den Regionalsprachen Inuktitut, das am häufigsten gesprochen wird, Inuinnaqtun, Inuttut und Inuvialuktun. Die Bezeichnung Inuktut als Oberbegriff wird erst seit wenigen Jahren verwendet. Sprachrohr der Inuit ist die von Natan Obed geleitete »Inuit Tapiriit Kanatami«, was »Inuit sind vereint in Kanada« bedeutet.22
Die Métis-Nation ist mit etwa 600 000 Angehörigen die zweitgrößte indigene Bevölkerungsgruppe. Die Métis sind die Nachfahren von europäischen, überwiegend französischsprachigen Siedlern und Trappern und Frauen aus indianischen Völkern, die eine gemeinsame soziale Identität schufen. Auch eine eigene Sprache entwickelten sie – Michif, eine Kombination aus Französisch und Cree oder Ojibwe.23 Wichtigste Métis-Organisation ist der »Métis National Council«, der von Clément Chartier geführt wird.
Die Entkolonialisierung von Sprache
In den 1990er Jahren arbeitete ich als Redakteur in der Nachrichtenredaktion der Frankfurter Rundschau. Zu meinen thematischen Zuständigkeitsbereichen gehörten die indigenen Völker. Ich legte Wert darauf, dass in der Zeitung durchgehend einige Regeln für den Sprachgebrauch eingehalten werden. Es sollte keine Stämme mehr geben, sondern nur noch Völker, indigene Gemeinden oder Nationen. Ich wollte auch keine Reservate mehr sehen, die der Duden in erster Linie als »Freigehege für gefährdete Tierarten« definiert, sondern allenfalls Reservationen, laut Duden ein »den Indianern vorbehaltenes Gebiet in Nordamerika«. Dass das nicht ganz durchzuhalten ist, lernte ich erst in Kanada, als mir bewusst wurde, dass hier bis heute von »reserve« die Rede ist, in den USA überwiegend von »reservation«. Und ich bat darum, auf Stereotype und Klischees wie Friedenspfeife und Kriegsbeil zu verzichten. Aber wie steht es um die Bezeichnungen für die indigenen Völker? »Begriffe sind ein Minenfeld. Man kann sehr schnell verletzen, wenn man unsensibel mit der Sprache umgeht«, unterstreicht Professor Hartmut Lutz.
Im Herbst 2019 traf ich in der Kleinstadt Osoyoos im Okanagan-Tal von British Columbia Clarence Louie, den Chief der »Osoyoos Indian Band«. Wir trafen uns auf der Terrasse von Nk’mip, des ersten Weinguts in Nordamerika, das im Besitz einer First Nation ist. Chief Louie trug eine schwarze Lederjacke mit mehreren Logos von »Indian Motorcycle« und an seiner linken Hand einen Ring mit dem Schriftzug »Indian«. Ich sprach ihn darauf an und fragte ihn, ob ich ihn »Indian«, also »Indianer« nennen darf. Seine Antwort war klar: »I am an Indian.« Und dann fügte er hinzu: »Ich wurde unter dem Indian Act geboren und lebe unter dem Indian Act. Ich mag die Begriffe indigen oder aboriginal nicht.«
Das für die Ureinwohnervölker zuständige Ministerium hieß bis vor wenigen Jahren »Department of Indian Affairs and Northern Development«, wurde dann zu »Aboriginal Affairs and Northern Development«, bevor es unter Justin Trudeau in »Indigenous and Northern Affairs« umbenannt wurde. Inzwischen wurde das Ministerium geteilt: in das Ministerium »Indigenous Services«, das die Leistungen des Staates für die indigenen Völker und speziell die Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse zum Mandat hat, und das Ministerium »Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs«, das die Beziehungen zwischen dem kanadischen Staat und den indigenen Völkern als Schwerpunkt seiner Arbeit sieht.
Die Änderung der Nomenklatur zeigt, wie sich Sprachgebrauch verändert. Die »Assembly of First Nations« hieß in den 1980er Jahren noch »National Indian Brotherhood«. Ein Grundsatzpapier zur Bildungspolitik aus dem Jahr 1972 hatte den Titel »Indian Control of Indian Education«. Mittlerweile wird der Begriff »Indian« nur noch in Ausnahmefällen verwendet. Gängig ist in Kanada First Nations. Allerdings gibt es weiter Organisationen wie die »Saskatchewan Indian Gaming Authority«, die sich aber meist unter dem Kürzel SIAG präsentiert und auf ihrer Website von First Nations spricht. In den USA führen aber die großen Verbände »National Congress of American Indians« (NCAI) und »American Indian Movement« (AIM) weiterhin »Indian« in ihren Namen.
Dass Chief Clarence Louie kein Problem mit dem Begriff »Indian« hat, ist ein interessanter Aspekt, der mich aber nicht dazu veranlassen kann, ihn durchgehend zu verwenden. Denn ich weiß, dass es viele gibt, die nicht als »Indians« bezeichnet werden wollen. Für den deutschen Sprachgebrauch ist das nicht einfach, da First Nations als Begriff dort nicht verankert und nicht allgemein bekannt ist, während mit »Indianer« jeder etwas anfangen kann. Ihren Ursprung hat die Bezeichnung »Indianer« in der Reise von Christoph Kolumbus, der einen Seeweg nach Indien finden wollte und glaubte, ihn gefunden zu haben. Ich spreche in diesem Buch überwiegend von den First Nations. Schwierig wird es, wenn über einzelne Personen oder Gruppen gesprochen wird: First Nations people, wie es im Englischen oft heißt, lässt sich wohl schwer als First-Nations-Leute oder First-Nations-Menschen übersetzen und in einem Text verwenden. Ein Hilfskonstrukt, wenn auch unbefriedigend, ist die Verwendung »indianische Völker« und »indianische Führungspersonen«. »Ureinwohner« halte ich für akzeptabel, »Eingeborene« aber überhaupt nicht. Die Begriffe »indigene Völker«, »first peoples« oder »erste Völker« umfassen First Nations, Métis und Inuit. Und ich möchte bei »Reservation« oder »reserve« bleiben und auf »Reservat« verzichten.
Gregory Younging von der Opsakwayak-Cree-Nation in Ontario, Schriftsteller und Lehrbeauftragter der University of British Columbia, spricht in seinem Buch Elements of Indigenous Style von der Notwendigkeit der Entkolonialisierung der Sprache.24 Er empfiehlt, den Vorschlägen der indigenen Völker zu folgen und Lesern in einem Vorwort oder in Fußnoten zu erklären, warum man sich für diesen oder jenen Begriff entschieden hat. So sieht er den Begriff »band« für eine First Nation als problematisch an, weil dieses Wort nicht die Strukturen, Geschichte, territorialen Ansprüche und Identität widerspiegele, wie sie der Begriff Nation enthalte. Dennoch sei es manchmal unumgänglich, diesen Begriff zu verwenden, weil er Teil des kolonialistischen »Indian Act« Kanadas sei.
Die Métis sind Métis, nicht »Mestizen« oder »Halbblut«, auch wenn sie ihre Wurzeln in zwei verschiedenen Ethnien haben. Eindeutig ist es auch beim Begriff »Eskimo«. Er ist in Kanada völlig verpönt. Die Menschen der Arktis sind die Inuit. Mit Inuit, was in ihrer Sprache Inuktut Menschen oder Volk heißt, drücken sie ihre Identität und Geschichte aus. Der »Inuit Circumpolar Council«, die Interessenvertretung der rund 160 000 Inuit Grönlands, Kanadas, der USA und der Tschuktschen-Region im äußersten Nordosten Russlands, verabschiedete 2010 eine Resolution, in der Wissenschaft, Forschung und Politik aufgefordert werden, in Publikationen durchgehend den Begriff Inuit zu verwenden, weil »Eskimo« kein Begriff aus der Inuit-Sprache sei.25
Gregory Younging bringt in seinem Werk weitere Beispiele. Er empfiehlt, im Zusammenhang mit Landrechten indigener Völker nicht von »land claim«, also Landanspruch zu sprechen, den man reklamieren muss, sondern von »land title«, einem Landtitel im Sinne eines bestehenden und unumstößlichen Rechtsanspruchs. Auch die AFN spricht durchgängig von »title and rights«, nicht von »claims«. Ich bezeichne die Führungspersonen der First Nations als Chief, nicht als Häuptling, und den Vorsitzenden der AFN als National Chief, denn dies ist sein Titel. Ich nenne die angesehenen, erfahrenen, älteren Gemeindemitglieder »Elders«, die Älteren. Es ist ein Ehrentitel, den ihre Gemeinden ihnen verliehen haben.
Über den Buchtitel haben der Verlag und ich lange nachgedacht. Die erste Idee war Kanada und seine indigenen Völker oder Die indigenen Völker Kanadas. Aber dies klingt besitzergreifend, als »gehörten« diese Völker Kanada. Die First Nations definieren ihr Verhältnis zum kanadischen Staat aber als Beziehung von Nation zu Nation. So entschieden wir uns für Indigene Völker in Kanada. Wir blicken auf die indigenen Völker, die im heutigen Kanada leben, die First Nations, die Métis und die Inuit, auf ihre reiche Geschichte und ihren Beitrag zu Kanada. Ich versuche in diesem Buch dem Anspruch gerecht zu werden, eine korrekte, nicht kolonialistische Sprache zu verwenden. Ich hoffe, das ist mir gelungen.
Die Schildkröte im Weltenmeer
Nordamerika, ein indigenes Territorium seit Urzeiten
Sky Woman lebte im Himmel, in der Welt der übernatürlichen Wesen. Sky Woman war schwanger. Eines Tages passte sie nicht auf. Durch ein Loch unter der Wurzel eines Baums stürzte sie nach unten zur Erde. Vögel fingen sie auf und setzten sie vorsichtig auf den Rücken einer Schildkröte, die im Ozean schwamm. Sie dankte den Tieren, die ihr geholfen hatten. Und sie halfen ihr noch mehr. Sie brachten Schlamm vom Meeresboden und setzten ihn an den Panzer der Schildkröte. Dieser wuchs und wurde zu einem neuen Land, auf dem Sky Woman und ihre Nachkommen leben konnten – Turtle Island, die Schildkröteninsel.1
In verschiedenen Märchen der Haudenosaunee, der Six-Nations- oder Irokesenkonföderation, beginnt die Geschichte der Erde auf diese Weise. Es gibt dazu Varianten. In den Legenden der Anishnabe, die auch unter dem Namen Algonquin bekannt sind, und Ojibwe fängt die Geschichte von Turtle Island mit der überfluteten Erde an. Der Schöpfer Kichi Manito hatte die Erde von streitsüchtigen Lebewesen gereinigt und einen Neuanfang gewagt. Es gab nur noch Nanabozo, das übernatürliche Lebewesen – bei den Anishnabe ist es Wisakedják, den Kichi Manito als seinen Sohn ansah –, und einige Tiere, die in einem Kanu die Flut überlebt hatten: Eistaucher, Bisam und Schildkröte. Nanabozo bat die Tiere, ihm bei der Schaffung der neuen Welt zu helfen. Nur dem Bisam gelang es, aus der Tiefe des Ozeans Schlamm zu holen. Nanabozo nahm den Schlamm und klebte ihn an den Panzer der Schildkröte. Die Erde wuchs. Interessante Parallelen zur biblischen Schöpfungsgeschichte und der Erzählung von Noah und seiner Arche sind erkennbar.2
Turtle Island – so nennen zahlreiche indigene Völker Nordamerikas, vor allem indianische Völker, ihren Kontinent. Sie sehen ihn als eine Einheit, die der Schöpfer ihnen gegeben hat. »Wir haben keine Grenzen geschaffen, keine Grenze zwischen den USA und Kanada, keine Grenze zwischen den Provinzen. Für uns ist es Turtle Island«, sagt Perry Bellegarde, National Chief der AFN. Die heutigen Grenzen Amerikas, zwischen Kanada und den USA oder zwischen den Provinzen Kanadas passen nicht zu den traditionellen Siedlungsgebieten der indigenen Völker. Die Grenzziehung zwischen den USA und Kanada entlang des 49. Breitengrads teilt das Gebiet der Blackfoot Confederacy, das sich über die kanadische Provinz Alberta und den US-Staat Montana erstreckt, und beeinträchtigt die »spirituellen, ökonomischen, sozialen und politischen Beziehungen« innerhalb der Konföderation.3 Das Territorium der Mohawk von Akwesasne liegt in den zu Kanada gehörenden östlichen Provinzen Ontario und Québec und im US-Staat New York, das Siedlungsgebiet der Okanagan Nation in British Columbia und im US-Staat Washington.
Als ich 1978 erstmals Nordamerika bereiste und mit indianischen Völkern in Kontakt kam, hörte ich von ihnen die Geschichten von der Schildkröte, und einer meiner Gesprächspartner erzählte mir: »Die Erde ist der Rücken der Schildkröte. Und die Schildkröte trägt die Erde durch das Weltenmeer.« Ich lernte, dass für die indianischen Völker Nordamerikas dieser Kontinent Turtle Island heißt.
Wider die »Doktrin der Entdeckung«
Tatsächlich kann die Landkarte von Nordamerika – mit einigen künstlerischen Freiheiten – leicht als Schildkröte gezeichnet werden. Auf Turtle Island leben die indigenen Völker »since time immemorial«, seit Urzeiten, wie die indianischen Völker Kanadas und der USA, aber auch die Inuit erklären.4 Für die im ausgehenden 15. Jahrhundert und im 16. Jahrhundert in Amerika ankommenden Europäer aber war es ein leeres Land, das in Besitz genommen werden konnte. Die europäischen Monarchien hatten die »Doctrine of Discovery« als ein Rechtsinstrument entwickelt, das die Kolonialisierung von »nicht christlichem« Land außerhalb Europas rechtfertigte. Die Doktrin wurde 1493 etabliert und bedeutete, dass Land, das als »leer« und nicht bewohnt galt, nun als »entdeckt« bezeichnet und dem Herrschaftsbereich des jeweiligen Monarchen zugeschlagen werden konnte. Es war die Vorstellung einer »terra nullius«, und indigene Völker galten, weil sie nicht christlich waren, nicht als menschliche Bewohner des Gebiets. Doktrinen des Beherrschens und Eroberns bildeten die Grundlage für Landraub und Missachtung indigener Rechte und Kulturen.
Bewusst wurde mir die aus Sicht der Ureinwohnervölker verheerende Wirkung dieser Discovery- und Terra-nullius-Doktrin in einer Diskussion auf der »Special Chiefs Assembly« der AFN im Dezember 2019 in Ottawa. Dort wurde über die »United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples« (UNDRIP) und das bahnbrechende Gesetz der kanadischen Provinz British Columbia diskutiert, mit dem diese Provinz die UN-Deklaration in ihr Recht überführte und dadurch sicherstellen will, dass bei allen Gesetzgebungsvorhaben diese UN-Deklaration berücksichtigt wird. Die UN-Deklaration und das Gesetz von British Columbia erklären Doktrinen und Politiken, die auf einer vermeintlichen Überlegenheit einer Rasse oder Religion basieren, für »rassistisch, wissenschaftlich falsch, rechtlich ungültig, moralisch verwerflich und sozial ungerecht«.5
Angesichts dieser Doktrinen ist es nicht verwunderlich, dass die europäisch geprägte Geschichtsschreibung Nordamerikas meist mit der sogenannten Entdeckung durch Christoph Kolumbus beginnt, manchmal auch mit der Besiedlung Grönlands und Neufundlands durch die Wikinger im 10. Jahrhundert. Die Geschichte der indigenen Völker Nordamerikas in der Zeit vor den Kontakten mit den Europäern – die »pre-contact era« oder präkolumbische Ära – blieb weitgehend unbeachtet. Nordamerika schien aus dieser Perspektive ein geschichtsloser Kontinent zu sein.6 Es existieren aus der vorkolumbischen Zeit aus den Gebieten der heutigen Staaten Kanada und USA keine traditionellen schriftlichen Zeugnisse, aber Felsmalereien und Felsgravierungen. Die Anerkennung mündlicher Überlieferungen als historisch wertvolle und sichere Zeugnisse vollzog sich erst in der jüngsten Vergangenheit.
So konnte es zu absurden Spekulationen über die Herkunft der indigenen Völker kommen. 1978 stieß ich auf der »Regina Fair«, einer Messe in Saskatchewans Hauptstadt Regina, an einem Bücherstand auf ein Buch, das auf dem Deckblatt einen Indianer in Federschmuck zeigte. Ich kam mit den Verkäufern ins Gespräch, und diese erklärten mir, dass »die Indianer« von einem der verlorenen Stämme Israels abstammten. Das genügte mir, höflich dankte ich für das Gespräch und zog weiter. In manchen Narrativen waren die ersten Bewohner Nordamerikas Flüchtlinge aus der untergegangenen Stadt Atlantis. Diese »abwegigen und offenkundig rassistischen« Ansichten wurden oft benutzt, um die Zerstörung oder Vertreibung der indigenen Amerikaner zu begründen, heißt es in der Encyclopedia Britannica.7 Auf die Idee, dass »die Indianer« ihren Ursprung vielleicht gar nicht in Europa oder Asien haben, sondern sich wie in anderen Regionen der Welt in Amerika ein Homo sapiens entwickelt haben könnte, dass sie vielleicht nicht aus der »Alten Welt« kommen, sondern umgekehrt Europa besiedelt hatten, stand außerhalb jeder Überlegung. Oder wie der deutsche Schriftsteller C. W. Ceram offenbar sarkastisch anmerkt: »Um solch hanebüchenen Gedanken zu fassen, war jedoch die Arroganz der Europäer viel zu groß.«8 Bis heute lehnen viele Indigene die Beringstraßentheorie als letztlich eurozentrisch ab, da auch sie davon ausgeht, Menschen seien in die Amerikas eingewandert – wie später die europäischen Siedler. Der Lakota Protestsänger Floyd Westerman sagte schon 1978 bei Auftritten in Deutschland: »Die Archäologen sagen, wir sind über die Beringstraße nach Amerika eingewandert, und sie finden unsere Fußspuren in Alaska, und ihre Funde werden älter und älter. Eines Tages werden sie zugeben müssen, dass wir über die Beringstraße rückwärts gegangen sind!« Der Historiker Robert Marks hat die eurozentrische Geschichtsschreibung so zusammengefasst: »Die eurozentrische Weltsicht betrachtet Europa als den einzig aktiven Gestalter der Weltgeschichte, gewissermaßen als ihren ›Urquell‹. Europa handelt, während der Rest der Welt gehorcht. Europa hat gestaltende Kraft, der Rest der Welt ist passiv. Europa macht Geschichte, der Rest der Welt besitzt keine, bis er mit Europa in Kontakt tritt.«9
Heute bilden Kenntnisse über den Ablauf von Eiszeiten, archäologische Funde, Gravierungen in Felsen, sogenannte Petroglyphen, Felsmalereien sowie DNA-Analysen die Grundlage unseres Wissens über die Besiedlung des Nordens des amerikanischen Doppelkontinents. Dieser war die letzte große Landmasse, die von Menschen besiedelt wurde. Über die Landbrücke Beringia, das Gebiet der heutigen Beringstraße zwischen Asien und Amerika, wanderten Menschen aus Eurasien kommend nach Amerika ein.10 Dies geschah vor 16 000 bis 12 000 Jahren. Immer wieder werden wir gezwungen, unsere Geschichtsschreibung zu ändern, wenn neue Entdeckungen neues Licht auf diese vergangenen Zeiten werfen – wie etwa Funde auf Calvert Island in British Columbia.
Fußspuren am Lagerfeuer
Die Pazifikküste der kanadischen Provinz British Columbia ist für ihre landschaftliche Schönheit weltberühmt. Ob die unbekannte Familie, die auf der Calvert-Insel an dieser Küste ihr Camp aufgeschlagen hatte, einen Blick für die landschaftlichen Reize ihrer Umgebung hatte, darf bezweifelt werden. Vielleicht ging es ihr eher um den täglichen Überlebenskampf, als sie am Feuer stand und ihr Essen bereitete, Fische, Muscheln oder Meeressäugetiere. Die Lagerfeuerszene spielte sich vor etwa 13 000 Jahren ab. Kanadische Wissenschaftler fanden hier in einer Tonschicht in der Gezeitenzone menschliche Fußabdrücke. Es handelt sich vermutlich um die ältesten bekannten menschlichen Fußspuren in Nordamerika.
»Wir konnten kaum glauben, was wir sahen«, berichtete mir Duncan McLaren, Archäologie-Professor an der Universität von Victoria und Forscher am Hakai-Institut von British Columbia, als ich mit ihm im Sommer 2015 über den Fund auf Calvert Island sprach. Mit seinem Kollegen Daryl Fedje hatte er im Mai in einer Tonschicht in etwa 80 Zentimeter Tiefe unter einer Schicht von Sand, Kieselsteinen, Muscheln und angeschwemmtem Strandgut Fußabdrücke freigelegt. Nicht einen oder zwei, sondern insgesamt 29, alle nahe einer von Steinen umgebenen Feuerstelle. McLaren und Fedje gehen davon aus, dass es mindestens drei Menschen mit unterschiedlichen Fußgrößen waren, wahrscheinlich ein Mann, eine Frau und ein Kind. »Vielleicht eine Kernfamilie«, erzählte mir McLaren.
Im Frühjahr 2014 hatten die Wissenschaftler erstmals am Strand von Calvert Island, die nördlich der Vancouver-Insel liegt, gegraben und waren in den tiefer liegenden Tonschichten auf einen Fußabdruck gestoßen. Sie entnahmen Sedimentproben, in denen sie Holzkohle entdeckten, und schickten diese zur Altersbestimmung in ein Labor. Wenige Monate später erfuhren sie das unerwartete Ergebnis. Die Radiokarbonmethode – auch als C14-Datierung bezeichnet – datierte die Holzkohle und damit möglicherweise auch den Fußabdruck auf eine Zeit vor 13 200 Jahren.
Frühere Funde – Knochen und Werkzeuge – hatten darauf hingewiesen, dass vor mindestens 2000 Jahren auf der Insel Menschen lebten. Die Calvert-Insel ist das traditionelle Gebiet der Heiltsuk und Wuikinuxv. Im April 2015 und im Sommer 2016 kehrten die Forscher auf die Insel zurück und entnahmen Sedimentproben mit Samen und Nadeln von Nadelbäumen, um das Alter zu verifizieren. Wenn die Ergebnisse von 2014 bestätigt würden, wären es die ältesten bekannten menschlichen Fußabdrücke in Nordamerika, sagte McLaren mir damals. Sie wären nur rund 1300 Jahre jünger als die ältesten Fußabdrücke, die in der »Neuen Welt«, am Monte Verde in Chile, gefunden wurden.
Daryl Fedje (links) und Duncan McLaren (Mitte) bei den Ausgrabungsarbeiten auf Calvert Island, 2016.
Im März 2018 veröffentlichten McLaren und Fedje mit weiteren Kolleginnen und Kollegen ihre Erkenntnisse auf der Wissenschaftsplattform PLOS ONE.11 Die Altersbestimmung durch die Radiokarbonmethode ergab Daten, die auf einen Zeitraum vor etwa 13 300 bis 12 600 Jahren hinweisen.12 Das würde bedeuten, dass wenige Tausend Jahre nach dem Ende der letzten Eiszeit Menschen an die Küste des heutigen Kanadas kamen. Vor etwa 17 000 Jahren habe das Abschmelzen der Eisschilde der nördlichen Hemisphäre begonnen, erläutert McLaren. Dies führte in den meisten Teilen der Welt zu einem starken Anstieg des Wasserspiegels. An der Westküste Kanadas aber hob sich die von der Eislast befreite Erdkruste, sodass der Meeresspiegel über mehrere Jahrtausende nur um drei oder vier Meter stieg. Dies ermöglichte die Anwesenheit von Menschen in Landstrichen, die heute in der Gezeitenzone zwischen Ebbe und Flut liegen.
Frühe Migration mit Booten
Die Entdeckung von Calvert Island warf erneut die Frage auf, auf welchen Routen die Völker wanderten, die nach der Eiszeit von Sibirien aus nach Nordamerika kamen. Jahrtausendelang hatten Menschen der paläoarktischen Kultur Sibiriens in einem Gebiet gelebt, das als Beringia bezeichnet wird, das Gebiet der heutigen Beringstraße zwischen Alaska und Sibirien. Vermutlich hatte vor 40 000 bis 35 000 Jahren der Prozess begonnen, der zur Bildung von Beringia führte. Der Meeresspiegel sank, Land trat hervor, und zwischen 28 000 und 10 000 vor unserer Zeitrechnung existierte wahrscheinlich eine komplette Landverbindung zwischen Asien und Nordamerika. Es gibt, wie mir ein Wissenschaftler am Naturkundemuseum in Ottawa erklärte, »solide archäologische Beweise, die auf den Zeitraum vor 14 000 Jahren«, also etwa 12 000 v. Chr., für die Besiedlung der Küste Alaskas hindeuten.
Wie die Wanderungen nach Süden erfolgten, ist Gegenstand spannender Forschungen. Vermutlich versperrten bis 13 000 vor unserer Zeitrechnung Gletscher den Weg nach Süden. Erst als diese sich zurückzogen, konnten Menschen zu Fuß über eine Route östlich der Rocky Mountains durch einen eisfreien Korridor entlang der Flüsse Mackenzie und Yukon nach Süden ziehen. Vielleicht aber fuhren Menschen sehr früh mit Booten entlang der Küste nach Süden. Nicht nur die Entdeckungen auf Calvert Island deuten auf diese alternative Route hin. Archäologische Funde in Cooper’s Ferry im US-Bundesstaat Idaho wurden auf ein Alter von rund 16 000 Jahren datiert.13