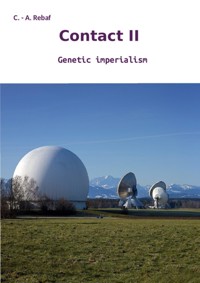Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Erotik
- Serie: Gerstenmayr ermittelt
- Sprache: Deutsch
"Die Frage: 'Was wäre eigentlich, wenn…?', öffnet mir das Tor in eine imaginäre Welt, die ich dem Leser nicht vorenthalten will." (C.-A. Rebaf). Eine solche Frage ist: "Kann Mahler Monroe lieben?" Beide haben doch nicht zur gleichen Zeit gelebt, oder? Aber im Roman wird gezeigt wie es gehen könnte... Andererseits ist der Thriller auch ein Lokalkrimi für den Pfaffenwinkel, Wien, Leipzig und Jena
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
C.-A. Rebaf
Kann Mahler Monroe lieben?
Gerstenmayers erster Fall
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Ein Ofen gegen Kartoffeln
Der rote Paco-Paco
Wien, St. Marx
Eine Lovestory danach
Über die Donau
Grinder spielt Orgel
Ein Brief von Marietta
Schauspielern müsste man können!
Mariahilf
Opus 1
Kuhmist und Mozartkugeln
Im gelben Sandstein
Wieder über die Donau
Wo ist der Prof.?
d-Moll und F-Dur im Fieberwahn
Marietta im Bunker
Composer
Donau-Paco-Paco-Schifffahrt
B’suffa!
Grinder ist plötzlich Vater
,Mulde 1'
Marlene
An der Schweizer Grenze
Zwei Genies
Baum taucht wieder auf
Grinder und Blondie
Eine schwangere Leiche
Spielchen
Gerstenmayer als ,Der Alte'
Die Klon-Story
Trauer um Blondie
Marietta und Hannes in Wien
Alarm!
Das SM-Paar zieht los
Wanted: Marlene
Verdacht
Wandel einer Beziehung
Gerstenmayer kombiniert messerscharf
Der Tod und das Mädchen
Marlenes wenige Reste
Musikexperten unter sich
High Noon in Wien
Italienische Konzertreise
Zerstrittene Genies
Gerstenmayer löst den Fall
Impressum neobooks
Ein Ofen gegen Kartoffeln
Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden Personen in diesem Thriller sind rein zufällig. Alle namentlich genannten Personen sind frei erfunden.
Enthält deutliche Beschreibungen sexueller Handlungen und ist nur für Erwachsene geschrieben.
Text und Buchumschlag: Alle Rechte bei C.-A. Rebaf 2017
Druckversionen:
Originalausgabe: 1. Auflage ,Leipziger (Gen-)Allerlei' mit Lektorat Christiane Lober, Halle
ISBN: 978-3-9818629-4-2
2. Auflage 2017 mit geändertem Titel
3. Auflage Mai 2018
Verlag: [email protected]
Ebook Versionen:
Originalausgabe: 1. Auflage ,Leipziger (Gen-)Allerlei' mit Lektorat Christiane Lober, Halle
ISBN: 978-3-7427-9328-7 Neobooks
Für Sabeth in sehr tiefer Liebe.
Erster Teil
An einem warmen Spätsommertag wollte ich mich gerade zur nahe gelegenen Stadt begeben. Der Weg, der früher einmal eine asphaltierte Landstraße gewesen war, stellte heute nur noch eine Ansammlung von Schlaglöchern dar. Ich verließ soeben mein Dorf, passierte die letzte Hausruine an der Straße. Dann kamen die Felder, von denen nur einige bestellt waren. Dazwischen wuchs auffallend hohes Gebüsch, aus dem einige Baumriesen hervorragten. Der radioaktive Fall-out nach der Katastrophe soll ein solches Wachstum verursacht haben. Als diese Baumriesen zum ersten Male aufgetreten waren, hatte man sich noch gewundert. Heute gehören sie bereits zur normalen Landschaft: Bäume wie tropische Urwaldriesen hier in Oberbayern. In Hiroshima sollen auch überdimensional große Blumen nach dem Bombenabwurf geblüht haben. Aber das war ja lange, lange vor der Katastrophe gewesen, die nur wenige Menschen überlebt hatten. Die meisten waren allerdings an ihren Folgen, nicht an ihr selbst gestorben. Heute in der Zeit danach litten wir immer noch sehr unter den Auswirkungen, sagten einige. Aber die meisten haben sich wie ich arrangiert. Meine Eltern hatten die Katastrophe überlebt. Sie gehörten zu denen, die eine natürliche Toleranz gegenüber radioaktiver Strahlung aufwiesen. Nur solche Menschen überlebten. Aber auch meine Eltern sind inzwischen an den Spätfolgen gestorben. Ich war hingegen noch sehr klein gewesen, als es geschehen war, und habe ihre Resistenz-Gene wohl geerbt.
Da blitzte mir etwas Golden-Metallisches neben meinem Weg auf dem Feld in der Mittagssonne entgegen. Ein scharfer Lichtstrahl, eine Reflexion traf mein Auge. Ich hielt inne und ging auf das Feld: Das obere Ende eines Zylinders ragte aus der Erde. Offensichtlich war der Gegenstand durch das letzte Umpflügen an die Oberfläche geworfen, aber nicht beachtet worden. Eilig begann ich mit bloßen Händen zu graben und hielt kurz darauf einen knapp ein Meter langen Zylinder in der Hand. Er war aus Bronze oder Kupfer, und Grünspan bedeckte fast die gesamte Oberfläche. Warum blieb eine kleine Fläche des Metalls an der Oberseite frei, sodass ich die Lichterscheinung sehen konnte? Der Zylinder war in zwei Hälften geteilt; die Mitte so gearbeitet, dass man sie aufschrauben können sollte. Ich versuchte es, aber es gelang mir nicht. Kurzerhand steckte ich das Ding in den Rucksack und ging meines Weges. Was mochte sich darin wohl befinden? Gold? Diamanten? Papiere?
Von Ferne ragte ein ausgebrannter Kirchturm aus einer Ansammlung von Mauerresten. Das war sie, die nahe Kleinstadt oder – besser – war sie früher einmal gewesen. Nur wenige Häuser waren bewohnt. Wir brauchten die anderen Ruinen nicht mehr. Es lebte heute, nach der Katastrophe, vielleicht noch ein Prozent der Menschen, vielleicht auch weniger. Niemand wusste das so genau. Wir befanden uns wieder im Mittelalter, wohnen in kleinen Gruppen, ohne Vernetzung. Meine Eltern hatten mir einmal etwas von Reisen erzählt. Dieses Wort kannten wir eigentlich nicht mehr, denn man konnte nicht mehr reisen. Es gab keine Transportmittel und keine Straßen mehr. Früher sollte es möglich gewesen sein, sich wie ein Vogel auch durch die Lüfte fortzubewegen. Das vermochte ich mir überhaupt nicht mehr vorzustellen. Wir pflegten nur noch zu Fuß zu gehen und legten auf diese Weise Entfernungen zurück, die wir in ein, maximal zwei Stunden schafften. Länger sollte man sich auch nicht an einem Stück draußen aufhalten.
Es war ruhig hier auf meinem Fußmarsch, und ich konnte mich ganz meinen Gedanken hingeben. Nur die Vögel zwitscherten. Ganz von ferne hinter mir hörte ich einen meiner Nachbarn mit seinem Paco-Paco ein Feld abernten. Ich kannte das Motorengeräusch. Nach der Katastrophe hat ein überlebender Südamerikaner diese Art Vehikel aus alten Schrottautos gebaut und ihm den Namen seiner Heimatsprache gegeben. „Paco-Paco“ gab lautmalerisch so wunderbar das Geräusch des Diesels wieder. Diese Ungetüme bestanden aus einem alten Motor, der von einem Holzvergaser angetrieben wurde. Holz wuchs nach der Katastrophe in Hülle und Fülle hier. Wir brauchten es zum Heizen und für das wenige Licht am Abend. Normalerweise standen wir mit der Sonne auf, und wenn sie unterging, erlosch das Leben und wir gingen schlafen. In meinem Rucksack spürte ich etwas Hartes an meine Rippen drücken. „Ach ja, da ist ja noch der verwunschene Metallzylinder!“, fiel es mir wieder ein.
Nur unser Nachbar im Dorf besaß einen Paco bei uns hier. Früher soll einmal jede Familie ein eigenes Auto besessen haben. Sie hatten Treibstoff dafür an Tankstellen verkauft. Das kann ich mir nicht vorstellen. Woher kam gleich nochmal dieses Teufelszeug, das die Autos antrieb?
Ich trug Kartoffeln auf dem Rücken, die ich in der Stadt eintauschen wollte. Dort gab es Händler, die in der Gegend umherstreiften und aus früheren Zeiten Nützliches aufspürten: einen Kochtopf, ein Ofenrohr, einen Ofen. Dieses Zeug lag in verlassenen Häuserruinen. Die Krämer sammelten alles ein und boten es auf dem Markt zum Tausch an.
Herr Mayr, der Händler in der Nachbarstadt, zu dem ich jetzt gerade gehen wollte, hatte sich kürzlich auch einen Paco gekauft. Seine Geschäfte schienen gut zu laufen – sogar bis nach München reichte sein Einfluss. Aber das war auch gefährlich, weil es dort noch außerordentlich hoch verstrahlt war. Doch diesen Umstand musste er in Kauf nehmen – Berufsrisiko. Außerdem war es sehr beschwerlich, auf diesen Straßen mit einem Paco vorwärtszukommen. Mehr als Schritttempo war da sowieso nicht drin.
Ich trödelte gedankenverloren so vor mich hin und kam gerade an der ersten Hausruine der Stadt vorbei. Die meisten Häuser waren bis auf die Grundmauern abgebrannt. Früher hatte hier das sogenannte „italienische Viertel“ von Weilheim gestanden. Heute sah es aus wie das ausgegrabene Pompeji. Nur die Steinwände ragten mit den hohlen Fensterlöchern wie übergroße Skelette in die Landschaft. Riesen große Holunderbüsche mit schweren Fruchtdolden hatten die geschwärzten Wände begrünt. Da fiel mir wieder der Metallzylinder ein. Was sich wohl darin befinden mochte? Doch ich musste mich noch gedulden.
Ich hatte Kartoffeln, die in meinem Garten gewachsen waren, und wollte sie bei Herrn Mayr gegen einen Ofen eintauschen. Nur ein paar Kilo als Qualitätsprobe trug ich zu ihm. Mayr sollte dann mit seinem Paco kommen, den Ofen bringen und die drei Säcke mitnehmen. Ich besaß ein großes Kartoffelfeld und brauchte für mich und meinen kleinen Jungen nur wenige Kartoffeln den Winter über, sodass wir einen Überschuss hatten. Ein zweiter Ofen für unser Schlafzimmer wäre allerdings für die kalte Jahreszeit eine große Erleichterung gewesen.
Ich träumte in der himmlischen Ruhe vor mich hin, als mich plötzlich ein ungewohntes Knattern aufschreckte: Ein mir unbekannter roter Paco-Paco mit einer Karosserie aus Sperrholz um den Fahrgastraum bahnte sich mühsam den Weg aus der Stadt in Richtung meines Dorfes und kam mir entgegen. Als er gerade an mir vorüberfuhr, sah ich einen Fahrer im Fonds und einen unbekannten Mann auf dem Rücksitz.
Sofort schoss mir der Gedanke durch den Kopf, dass ich dieses Gesicht schon einmal gesehen hätte. Aber wo nur? Der Fremde nickte mir ebenfalls gedankenverloren zum Gruß zu, und schon war das Gefährt an mir vorbei mit dem vorne offenen Zweizylinderdieselmotor, auf dem die Buchstaben M.A.N. noch deutlich zu sehen waren. Hinten auf einer Art Ladefläche befanden sich Holzscheite sowie das Ungetüm von Kessel, unter dem das Feuer brannte, eben der typische Holzvergaser. Gab es etwa einen Reisenden hier? Hier im Pfaffenwinkel? Was wollte hier jemand?
Viele Fragen! Ich wanderte meines Weges und überlegte angestrengt, woher mir dieses Gesicht mit einer runden Nickelbrille und einer hohen Stirn so bekannt vorkam – doch ohne Ergebnis.
Herrn Mayr – ein freundlicher Oberbayer, den man im bairischen Dialekt als „g’wampert“ bezeichnet hätte; in den nordöstlichen Landesteilen um die Hauptstadt hätte sein Leib eher „Mollenfriedhof“ geheißen – hatte ich noch nie unfreundlich erlebt. Sein sonniges Gemüt wurde durch seine tägliche halbe bis ganze Maß stets erhellt. Aber trotz allen Optimismus und aller Lebenslust war er nicht leicht zu übervorteilen. Er war eben auch einer von der Sorte „Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps“! Er begutachtete meine mitgebrachten Kartoffeln im Rucksack gründlich und wartete ab, was ich ihm anbieten würde.
„Davon habe ich noch drei Zentner eingelagert, die ich gerne gegen einen stabilen Ofen eintauschen würde.“
„A was!“, war seine knappe Antwort, mir weiterhin immer listig die Rede überlassend. Ich wollte schließlich etwas von ihm, also überließ er mir die Gesprächsführung. „Haben Sie denn schon Vorräte eingekellert?“, versuchte ich, ihn aus der Reserve zu locken.
„Wie maanenS’?“, kam es aus ihm heraus, und er tat plötzlich sehr geistesabwesend.
Aber auch ich verspürte kaum Lust, weiter in ihn zu dringen, da mir plötzlich der Fremde und der Metallzylinder wieder einfielen. Der Unbekannte, der mir mit seinem Fahrer in dem roten Paco entgegengekommen war: Was wollte der? Ein Reisender auf dem Weg nach Polling? Ich starrte vor mich hin ins Leere, und das Gespräch stockte ganz plötzlich. Mayr wurde es auf einmal sichtbar ungemütlich, da ich mich weigerte, weiterzureden.
„Scheesanns’, Ihre Kartoffeln.“ Ich war sehr überrascht, seine Stimme so klar und deutlich zu hören. Sie riss mich geradezu aus meiner Grübelei.
„Gelt?“, strahlte ich ihn an und versuchte, ihn mit meinem verführerischsten Schlafzimmerblick von der Seite anzuschauen! Hatte ich ihn jetzt?
„Ja, an was für’n Offa hätt’n S’ dann gedacht, gnäd’ge Frau?“ Aha, mein Blick zeigte Wirkung! Es funktionierte doch immer wieder, das schöne Spiel zwischen den Geschlechtern!
„Na, einen aus Eisen für unser Schlafzimmer. Da ist es im Winter immer so kalt. Holz zum Heizen haben wir ja genug.“
„Ich hätt’ da schon was füa Eana. Aber drei Zentna sann nedfuil! Und der Offa is’ no’ an oiled Qualidäd!“
War doch nicht tief genug, mein Blick, und mir war klar, nachzulegen nützte jetzt wenig; jetzt musste ich mich bewegen.
„Ich hab leider nicht mehr an Kartoffeln. Die restlichen brauchen wir selbst.“
„Na, Gnäd’ge, mehr Klöß’ ess i über d’ Winder au ned. Aber s´nächst Joahr wär’n Reiberdatschi a ned bläd! Und ’s Joard ruff au ned.“
„Nächstes Jahr!“, stieß ich überrascht hervor und schluckte. „Weiß ich, wie die Ernte dann ausfällt? Das kann ich Ihnen doch guten Gewissens nicht zusagen.“ Jetzt war ein weiteres verführerisches Lächeln angesagt, und ich schenkte es ihm. Dankbar nahm er es auf.
„Also guad. Sechs Zentna in de nächst’ Joahr! Da kimm i Eana weid entgegn!“ Aha, jetzt begann das Feilschen!
„Aber, Herr Mayr“, ich himmelte ihn geradezu an, „Sie wollen mich doch nicht übers Ohr hauen, oder?“ Und ich erhob schelmisch meinen Zeigefinger. In Mayrs Gesicht erkannte ich, dass es ihm doch jetzt peinlich wurde. Gut, ich hatte wieder einen Punkt für mich gewonnen. „Ich schlage vor, Sie zeigen mir erst einmal den Ofen, und dann reden wir weiter“, versuchte ich, den Handel auf eine sachliche Ebene zu heben, was Mayr sehr dankend annahm, traten denn auch schon kleine Schweißperlen auf seine Stirn.
„Gnäd’ge Frau, das is’ a goada Vorschlag.“ Schon ging er voraus in sein Lager, das auf der gegenüberliegenden Seite des Hofes gelegen war. Er holte sein riesiges blau-weißes Karo-Sacktuch aus der Krachledernen, tupfte aufgeregt die Stirn ab und wischte sich über den Stiernacken.
Das Anwesen war wohl ein sehr alter Bauernhof mit Wohnhaus, Stall und Scheune, die um den quadratischen Hof angeordnet und mit einer hohen Mauer eingezäunt waren. Durch die Katastrophe war es völlig ausgebrannt und mit Zeltplanen, Blechen, Strommasten als Stahlträgern und allerlei weiterem improvisierten Material wieder notdürftig aufgebaut. In der Scheune befand sich sein Lager, im Stall standen wieder Tiere, es roch nach Schwein, Schafen und Ziegen. Sein riesiger Paco-Paco, ein Dreiachser mit einem Dreizylinder-Dieselmotor und großer Ladefläche, stand im Hof. Der Holzvergaser nahm bei diesem Gefährt die Stelle des Beifahrersitzes ein und konnte vom Fahrer leicht beheizt werden.
Trotz seiner kurzen Beine war Mayr flink, sodass ich Mühe hatte, ihm zu folgen. Als wir an dem Fahrzeug vorbeikamen, ließ ich eher beifällig fallen: „Dürfte ich Sie bitten, auch den Transport des Ofens zu übernehmen? Bei der Rückfahrt könnten Sie ja gleich die Kartoffeln mitnehmen.“ Er tat, als ob er es überhört hätte, aber ich wusste, er hatte es sehr wohl aufgeschnappt.
Wir stöberten kreuz und quer durch das Lager. Mayer kam noch mehr ins Schwitzen, denn er fand den Ofen nicht auf Anhieb und musste ständig Dinge aus dem Weg räumen, da er dachte, er würde den Ofen dahinter finden. So wertvoll, wie er tat, schien das Monster nicht zu sein! Endlich hatte er ihn gefunden.
„Na, Gnäd’ge, hoab ich z‘vuil vasproacha?“
Der Ofen war ziemlich verrostet, aber mit alten gusseisernen Platten und Verzierungen versehen. Wenn wir den reinigen würden, wäre er schon richtig. Ich fuhr mit der Hand über die Außenfläche, und der Staub wirbelte auf. Übertrieben spielte ich die Rolle der Naserümpfenden und brachte sogar einen wahrhaftigen Niesanfall zustande. Verächtlich schaute ich das gute Stück an und wandte mich meinem Begleiter zu: „Nein, Herr Mayr, diese Dreckstück bieten Sie mir an?“
Mayr zuckte etwas zusammen.
„Und Sie trauen sich, dafür sechs Zentner Kartoffeln zu verlangen?“ Ich schaute mütterlich-tadelnd von oben auf ihn herab. Dieser Rollenwechsel von der Verführenden zur strengen Mutter war jetzt strategisch sehr wirkungsvoll.
Ich wollte mich gerade abwenden, als er mir in die Augen schaute und leise sagte: „Fünf Zentna.“ Jetzt hatte ich ihn soweit!
„Vier“, kam es scharf aus meinem Mund.
Er tat, als ob er einen Schlag erhalten hätte, und sagte seine Standardformel auf: „Gnäd’ge, Se ruiniere ma!“
Ich wusste, dass das sein Okay war, und setzte noch drauf:„Ich erhalte noch einen Topf hitzebeständige Eisenfarbe, dass wir das gute Stück nach der Bearbeitung auch ins Schlafzimmer stellen können.“
Er war einverstanden und fügte hinzu: „I bring Eana des Ding nächst’ Woch’.“
Wir verabschiedeten uns voneinander, und ich freute mich innerlich, doch einen guten Handel abgeschlossen zu haben.
Es war doch kein Fehler von meinem Vater als Heranwachsende einiges gelernt zu haben. Darunter war neben einem großen Wissen um die klassische Musik auch das Feilschen: Er brachte mir alle Tricks bei, die Männer so beim Aushandeln von Deals drauf haben und sich dabei gegenseitig über‘s Ohr hauen. Meine Mutter sagte zu ihm immer: „Mein Gott, sie ist doch ein Mädchen, Du erziehst sie wie einen Jungen!“
Es wurde schon langsam dunkel, und ich begab mich schnell auf den Rückweg in mein Dorf.
Zu Hause fand ich den Metallzylinder in meinem Rucksack wieder und behandelte den Schraubverschluss mit etwas Essig. Es zischte, und danach konnte ich ihn drehend öffnen. Darin befand sich ein Kinoplakat aus Zeiten vor der Katastrophe. Es war eine blonde Frau mit einem großen Busen in einem weißen Neckholder-Kleid zu sehen. Sie stand auf einem Gitterschacht, aus dem ein Wind nach oben wehte und ihren luftigen Rock in die Höhe hob. Das Gesicht der Frau zeigte, dass sie zwar erschrocken versuchte, aus Scham ihren Rock nach unten zu ziehen, die schelmische Komponente ihres Lächelns signalisierte dem Betrachter jedoch deutlich, dass sie dem Windhauch aus dem Schacht dankbar war, dass er die Entblößung ihrer wunderschönen Beine vorgenommen hatte, um ihre perfekten Konturen und Reize einem interessierten Mann zu zeigen. Auf diese Weise blieb sie einerseits eine schamhafte junge Frau, und nur der böse Wind war schuld an ihrer Verruchtheit! „Die Verführungskünste der Frauen bestehen darin, diesen Spagat zwischen Scham und Raffinesse perfekt zu beherrschen. Die Heilige und die Hure!“, fiel meinem männlichen Teil in mir dazu ein. Meine weibliche Seite hatte nur ein verachtendes Wort dafür: „Flittchen!“. Auf dem Plakat war neben der Frau eine schwungvolle Unterschrift zu lesen: Marilyn Monroe.
Ich fand eine leere Wand und hängte das Plakat auf. Nicht, dass ich es besonders schön gefunden hätte. Aber die kahle Wand mit dem Plakat gefiel mir besser als ohne.
Der rote Paco-Paco
Es war schon beinahe dunkel, und ich konnte fast nichts mehr erkennen, als ich leichtfüßig durch das ehemalige Klosterdorf schritt. In den Ruinen des Klosterhofes erkannte ich dennoch den roten Paco mit der erlöschenden Glut unter dem Holzvergaser. War der Fremde etwa hiergeblieben? Irgendwie hatte ich plötzlich Angst, und meine Freude über den guten Handel mit Herrn Mayr war fast vergessen.
Zu Hause angekommen, wartete Golie schon auf mich. Er hatte den Abendbrottisch gedeckt und freute sich, als er mich sah. Wir aßen zusammen, und ich brachte ihn anschließend ins Bett. Draußen war es bereits dunkel geworden, und ich legte in unserer Wohnküche noch einmal Holz in den Herd und schaute durch die Herdritzen in die Glut.
Ich hatte Gottlieb, wie er eigentlich hieß, als kleines Findelkind in München gefunden gehabt. Er hatte nur ein Schild um den Hals mit der Aufschrift getragen: „Ich heiße Gottlieb, erbarmt Euch meiner!“ So etwas war seit der Katastrophe an der Tagesordnung. Seine Eltern waren wohl an den Spätfolgen gestorben. Da ganze Familien ausgelöscht wurden, gab es immer wieder den Fall, dass eine Hilfe innerhalb der gewohnten Umgebung nicht mehr möglich war, und so wurden Kinder von ihren sterbenden Eltern einfach ausgesetzt. Was sollten sie auch unternehmen in einer Situation, in der jegliche medizinische Versorgung völlig zusammengebrochen war?
Er war ein putziges Baby mit hellbraunen Haaren und einem ewigen Lächeln auf den Lippen gewesen. Ich hatte ohnehin niemanden mehr gehabt und beschlossen, der Aufforderung auf dem Schild Folge zu leisten und mich seiner zu erbarmen. Es war Liebe auf den ersten Blick gewesen, und ich habe es nie bereut, ihn mit zu meiner kleinen Wohnung genommen zu haben, wo ich ihn versorgte. Anfangs war es für mich sehr ungewohnt, aber mit der Zeit wuchs ich schnell in meine Rolle als Mutter hinein, zumal ich mich mit meinem alten, dreirädrigen Kinderwagen nahtlos in das Stadtbild einfügte, den ich dank meiner guten Verhandlungskünste auf dem Markt hatte ergattern können.
Irgendwann beschloss ich dann, die Stadt zu verlassen und hinaus aufs Land zu ziehen. Eine gute Bekannte schwärmte mir von einem alten Roman vor und wollte mich begleiten. Bücher waren sehr, sehr rar, und nur solche, die die Brände der Katastrophe überstanden hatten, wurden auf den Märkten angeboten.
In ihrem zerfledderten Buch, der Autor war wohl ein gewisser Thomas Mann gewesen und der Titel nicht mehr entzifferbar, las sie von einem Ort mit Namen Pfeiffering südlich von München, der in den schönsten Farben geschildert wurde. Jemand hatte in der alten rororo-Taschenbuchausgabe meiner Freundin mit blauem Kugelschreiber an den Rand die Bemerkung:
geschrieben. Irgendwann beschlossen wir, der Sache auf den Grund zu gehen und uns diese Gegend einmal anzusehen, wo die Orte sowohl einen realen als auch einen literarischen Namen trugen. Wir marschierten in einer schönen Sommerwoche immer an den zerstörten Gleisen der alten Eisenbahnstrecke nach Garmisch entlang und gelangten tatsächlich dorthin. Es war gefährlich, aber wir waren jung, unvernünftig und setzten uns der Strahlung aus. Am Abend schliefen wir in Kellern. Der See, den wir in Starnberg erreichten, lockte uns zwar sehr zu einem Bade, aber dieses Strahlenrisiko wollten wir dann doch nicht auf uns nehmen, und so genossen wir die Aussicht auf das Wasser mit den Bergen der Alpen im Hintergrund und marschierten am Ufer weiter. Meine Freundin hatte alle Stellen, die für unseren Ausflug touristisch wichtig waren, unterstrichen und missbrauchte den Roman über einen avantgardistischen Komponisten als Reiseführer à la Baedecker.
Schließlich kamen wir in Weilheim an und sahen zu unserer Enttäuschung das, was wir von überall her kannten: Ruinen, verbrannte Kultur und wenige Menschen, die wie verscheuchte Ratten dort hausten und von einem Loch ins nächste huschten. Es war so trostlos, dass wir schnell an einem Flüsschen weiter nach Süden marschierten, dieses dann verließen und uns an einem kleinen Bach orientierten, um immer weiter in Richtung Berge zu gelangen. Bald darauf erreichten wir eine riesige Ruinenanlage, die wohl das alte Kloster gewesen sein musste. Ein herausragender, höherer Schutthaufen, den wir die ganze Zeit schon von Weitem gesehen hatten, musste wohl der alte Turm gewesen sein. Die alte Barockfassade mit dem runden Rosettenfenster, das natürlich zerbrochen war und wie das Auge Polyphems ins Weite starrte, war überraschenderweise noch erhalten. Zum ehemaligen Kirchenschiff hin wurde mit Balken ein Zeltdach gehalten.
Spielte da nicht jemand Orgel? Sollte diese etwa noch intakt sein? Wir standen gleichsam angewurzelt, und der kleine Golie, den ich über die weite Strecke auf meinem Rücken getragen hatte, vollführte dort einen merkwürdigen Tanz, als ob die Musik in ihm etwas ganz Besonderes entfachte. Ich konnte ihn nicht mehr halten und ließ ihn auf den Boden gleiten. Sofort robbte er auf dem Rücken dem schmalen, freigelegten Eingang zu, aus dem die Musik herausschallte. Laufen konnte er ja noch nicht. Meine Freundin und ich verstanden gar nichts mehr.
Im Inneren unter dem provisorischen Zeltdach blieb er erstarrt liegen, lauschte und war von uns nicht mehr von der Stelle zu bewegen, bis die Musik abbrach und der Organist, ein Mann um die vierzig mit wenigen blonden Haaren und einer Halbglatze, über eine Holzleiter vom Rest der Orgelempore kletterte. Hinter ihm folgte ein Junge, der gleich wie befreit davonrannte.
Der Blonde sprach uns freundlich an, schließlich verirrten sich selten Fremde hierher. Seine netten Worte taten uns zusammen mit der schönen Musik zuvor gut, munterten uns wieder auf und hoben unsere Stimmung. Ja, Golie flippte ganz und gar aus, fuchtelte mit den Babyarmen wie ein drolliger kleiner Tanzbär, sodass der Blonde mit uns in schallendes Gelächter verfiel. Golie war hier bester Laune. Ich hatte ihn so noch nie erlebt. Trotz seines zarten Alters zeigte er mir mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, dass es ihm hier gut ging und dass er gerne bleiben wollte.
Wir sahen uns dann im Dorf um, fanden wenige Menschen und viele zum Teil gut erhaltene und leere Wohnräume, die mir erheblich besser gefielen als meine Unterkunft in München. In mir reifte der Entschluss, hierzubleiben, was meine Freundin nicht verstand. Sie machte sich dann nach wenigen Tagen wieder auf den Rückweg. Ich hatte sowieso alles, was mir wirklich wertvoll war, dabei und quartierte mich im ehemaligen Klosterdorf ein. In den nächsten Tagen half mir der Organist, der mir durchaus nicht unsympathisch war, führte uns beide bei den wenigen Menschen im Dorf ein. Golies sonniges Wesen half dabei sehr. Sie alle waren sehr freundlich und empfahlen mir sogar eine besondere Ruine, die an ein großes Feld angrenzte, auf dem man gut Ackerbau betreiben könne, um das Leben zu fristen. Ich nahm den Rat an, und so waren wir hier im Gut Schweigestill bei Pfeiffering gelandet, wie es im Roman meiner Freundin genannt wurde. Das lag jetzt schon einige Zeit zurück.
Hatte ich das alles geträumt? War ich eingeschlafen? Meine Glieder waren ganz steif, und ich legte mich in das Zimmer nebenan zu Golie ins Bett unseres Schlafzimmers. Mehr als die beiden Räume hatten wir nicht. Meistens waren wir draußen, wenn das Wetter es einigermaßen zuließ. Es mochte zwar gefährlich sein, aber wir beide schienen ausreichenden Resistenzschutz gegenüber der Strahlung zu besitzen, da wir jetzt schon gut vier Jahre so lebten und uns glänzender Gesundheit erfreuten.
Am nächsten Morgen erwachte ich und war ganz benommen von einem Traum. Es war einer derjenigen, die so realistisch abzulaufen pflegten, dass ich nicht zwischen Traum und Wirklichkeit unterscheiden konnte, und benötigte daher einige Zeit, um meine Gedanken zu sortieren:
Mein Vater hatte die Hauptrolle in meinem nächtlichen Schauspiel gespielt. Er erzählte mir als kleinem Mädchen von einem Musiklehrer. Dieser sei von seinem Lieblingskomponisten so besessen gewesen, dass er sein Äußeres verändert habe, um diesem ganz ähnlich zu sein: Er habe eine Brille getragen, obwohl er eigentlich keine benötigt hätte, und sich sein Haar mit leichten Grausträhnen versehen lassen und streng nach hinten gekämmt, sodass seine hohe Stirn sein Gesicht betont habe und er somit einer der wenigen Fotografien seines Idols doch sehr nahe gekommen sei. Dann wurde die Geschichte dramatisch, denn der Lehrer und mein Vater als dessen junger Schüler hätten um die Gunst derselben Frau gebuhlt, einer Klassen-kameradin meines Vaters, in die sich beide Männer unsäglich verliebt hätten. Die Frau sei dann nach dem Abitur von beiden in eine weit entfernte Wüste geflohen, wo auch überall Schilder mit dem Radioaktivitätssymbol gestanden hätten. Mein Vater hatte mir enttäuscht und unter Tränen erzählt, dass er so die erste Liebe seines Lebens verloren habe…
An dieser Stelle riss der Traum ab. Sosehr ich mir auch Mühe gab, ich konnte mich nicht an den Namen des Musikers erinnern, weder an den des imitierenden Lehrers noch an den des Komponisten. Einzig eines war mir jetzt klar: Die Person, die mein Vater geschildert hatte, erinnerte mich an den fremden Reisenden im roten Paco gestern. Kannte ich ihn daher?
Golie schlug die Augen auf und rutschte unter meine Decke zu unserem morgendlichen Kuschelritual. Wir löffelten, und er fragte mich begeistert, ob er heute wieder zum Organisten gehen dürfe. Seit einiger Zeit verbrachte der Vierjährige viel Zeit mit dem freundlichen blonden Mann. Mit Steffen, so hieß er, hatten wir uns beide angefreundet. Ich setzte volles Vertrauen in ihn, da er mir ja auch nicht unsympathisch war. Allerdings hatte er alle meine schüchternen Annäherungs-versuche abgeblockt. Er schien mir nur mit der Musik oder besser mit seiner Orgel liiert zu sein, oder besser mit dem, was davon noch übrig war.
Da es seit der Katastrophe keine Elektrizitätsversorgung mehr gab, brauchte Steffen immer einen Helfer, der den riesigen Orgelbalg treten konnte. Er hatte mir auch voller Stolz berichtet, dass er in mühsamer Kleinarbeit alle elektrischen Mechanismen zur Steuerung der Register wieder in eine ursprüngliche Mechanik zurückgebaut habe. Nur deswegen funktionierte das königliche Instrument wieder.
Es vergingen Jahre, in denen ich lernte, immer schönere Kartoffeln anzubauen, die ich Herrn Mayr für Tausch-geschäfte anbieten konnte. Steffen hatte hingegen Golie beigebracht, den Balg zu treten, was dem kleinen Knirps anfänglich sichtlich schwergefallen war, aber jetzt schien es gut zu klappen, denn er pustete fast täglich stundenlang die Luft in die Pfeifen. Was hatte der Junge bloß für Gene, dass er so ausdauernd war? War es Steffen? Fehlte ihm ein Vater? War es die Musik?
Mir jedenfalls war es recht, denn Kindergärten gab es ohnehin nicht mehr, und ich hatte so genügend Zeit, mich um meine Land- und die kleine Hauswirtschaft zu kümmern. Diese Wirtschaft war am Anfang beschwerlich genug, als ich mir Rat und Tat sowie notwendiges Saatgut und Gerätschaften von den Nachbarn holen bzw. ausleihen musste. Aber dank Herrn Mayr und unser beider Verhandlungsgeschick hatte ich jetzt alles zur Hand, was ich benötigte; und der Mann mit dem Paco im Dorf, sozusagen der designierte Dorf-Chef, pflügte mir im Frühjahr sogar mein Feld, was mir das Leben sehr erleichterte. Wir waren inzwischen sogar soweit, dass wir für unsere Milchver-sorgung eine eigene Ziege, unsere Selma, hatten, die nachts im Stall und am Tage in den vielen Wäldern um unser Dorf herum graste.
Golie und ich standen auf, und ich bereitete unser Frühstück, das aus Müsli und Getreidekaffee aus eigenem Anbau mit Ziegenmilch und Quark bestand. Golie plapperte lustig auf mich los und zeigte mir plötzlich eine Notenzeile, auf die er eine Melodie gekritzelt hatte. Ich war ziemlich erstaunt, und er erläuterte mir dazu, dass Steffen dies gestern auf der Orgel gespielt habe. Ich konnte zwar die Noten lesen, das hatte mir mein Vater noch beigebracht, ich konnte aber nicht perfekt vom Blatt singen, sodass ich nur im Ansatz erkennen konnte, dass dies wohl eine d-Moll-Melodie war, er hatte genau ein ‚b‘ am Anfang notiert.
„Hast du das alles alleine geschrieben?“, fragte ich ungläubig. „Das glaube ich nicht! Der Steffen hat dir geholfen, oder er hat es dir aufgeschrieben.“
„Aber Mama, ich belüge dich doch nicht!“, gab er beleidigt zurück.
Ich überlegte. In der Tat musste ich in diesem Punkt Golie recht geben; er war immer sehr darauf bedacht, ehrlich und aufrichtig zu sein.
Mir fiel plötzlich ein, dass mir Steffen letztes Frühjahr eine Weidenflöte geschenkt hatte, die ich achtlos im Schrank aufbewahrte. Ich kramte sie hervor. Golie machte große Augen!
„Aber Mama, kannst du Flöte spielen?“ fragte er mich aufgeregt.
„Nur ein wenig“, antwortete ich. „Mein Papa hatte es mir einmal gezeigt, aber ich war damals noch sehr klein gewesen.“
„Wie alt warst du da?“, fragte er interessiert.
„Na, so vier etwa, ha, genauso alt wie du jetzt! So ein Zufall!“, erwiderte ich und war selbst überrascht. „Lass mal sehen, ob ich das noch hinbekomme.“
Ich versuchte es, aber schon am Anfang mit dem Pralltriller auf dem „a“ scheiterte ich, bei der folgenden schnell abfallenden d-Moll-Sequenz versagten meine Finger.
„Aber Mama, du kannst doch bei Steffen vielleicht fragen… Er kann Flöte spielen… und bringt es dir sicher bei“, rief er begeistert aus und schüttete beinahe seine Milch aus.
„Aber ich habe doch gar keine Zeit dafür! Wer soll denn das Feld bestellen?“, entgegnete ich ihm.
„Schade.“ Er war sehr enttäuscht!
„Aber weißt du was? Wenn du so schöne Noten schreiben kannst, warum willst du es nicht lernen? Ich schenke dir die Flöte! Steffen wird das schon verstehen!“
Golie blieb der Mund offen stehen vor freudigem Schreck.
„Du… Du schenkst mir deine Flöte? Im Ernst?“ Dann flitzte er vom Stuhl, sprang auf meinen Schoß und umarmte mich herzlich. Ich war völlig überrascht von seiner heftigen Reaktion. Er nahm die Flöte, und ich zeigte ihm, dass der tiefste Ton dann herauskam, wenn man mit den Fingern alle Löcher zuhielt. Er brachte es tatsächlich nach einigem Probieren zustande. Dann verzog er sich nach draußen, sein Frühstück war ihm jetzt gleich, und ich hörte ihn nur noch von Weitem zwitschernd flöten.
Ich räumte den Frühstückstisch ab und freute mich sehr, ihm eine so große Freude gemacht zu haben. Nach einer Weile, ich wollte gerade die Harke holen, um die letzten Kartoffeln zu ernten, tauchte Steffen mit dem Fremden von gestern auf.
„Hallo, Mary Lou!“, begrüßt er mich. „Wo ist Golie?“
Ich tat etwas befremdlich wegen seiner Unhöflichkeit, mir nicht den Fremden vorzustellen, was er tatsächlich auch dann sofort bemerkte. Steffen war manchmal etwas ungehobelt, aber glich es dann immer wieder mit spontaner Herzlichkeit aus.
„Ach ja, das ist Mr Grinder. Er kam gestern Abend mit seinem Fahrer in dem roten Paco. Er ist ein junger Musiker und hatte gehört, dass hier bei uns noch eine Orgel funktioniere. Wir wollten jetzt zusammen spielen und brauchen Golie, damit er uns den Blasebalg tritt. Wo ist er?“
Steffen war wieder viel zu schnell, aber auch Mr Grinder war ebenso wenig feinfühlig. Er machte mir einen nervösen Eindruck und reichte mir, ohne ein Wort zu sagen, zur Begrüßung die Hand.
„Ich habe ihm heute Morgen die Flöte überlassen, die du mir letztes Frühjahr geschenkt hattest, Steffen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Jetzt ist er damit allerdings auf und davon. Ich weiß nicht, wo er steckt.“ Und mit einem stolzen Hinweis auf das Papier mit der Notenzeile ergänzte ich: „Das hat er mir heute Morgen gezeigt und behauptet, er habe das geschrieben.“
Der Fremde warf einen flüchtigen Blick darauf und krächzte mit einer rauen Stimme: „Das ist von Bach, das Thema der d-Moll-Toccata.“
„…die hatte ich gestern auf der Orgel geübt“, räumte Steffen schnell ein. „Sollte der Bengel das Notensystem so schnell begriffen haben? Er hatte mir Löcher in den Bauch gefragt, die ganze Zeit schon, wegen der fünf Linien und der Punkte mit Fähnchen daran. Das wäre ja phänomenal!“
„Ein zweiter Mozart“, schnarrte Mr Grinder hinterher.
Warum Steffen mir den Fremden als „Mr Grinder“ vorstellte war mir unklar. Stammte der Fremde etwa aus England oder gar aus den USA? Ich traute mich auch nicht, danach zu fragen.
Wien, St. Marx
Herbert Gerstenmayer war sauer. Er war heute besonders früh aufgestanden, um zu der für 8.00 Uhr angesetzte Besprechung mit seinem Chef rechtzeitig im Laborbunker zu sein. Es war ein weiter Weg dorthin vom siebten Bezirk, wo er in der Myrthengasse in einer alten Hausruine wohnte. Da es nach der Katastrophe auch hier in der österreichischen Hauptstadt keinen Nahverkehr mehr gab, war es jeden Morgen mühsam, zu Fuß zum Ring zu laufen und sich dann in Richtung Rennweg durch die Ruinen aufzumachen. Aber er hatte es heute rechtzeitig geschafft, und nun war der Boss noch nicht da! Seine Assistentin Christiane war von diesen Besprechungen befreit, in denen alle vierzehn Tage die neuen Projektschritte festgelegt wurden. Herbert musste diese dann in konkrete Tagesarbeitseinheiten für sie umsetzen.
Es war gespenstisch in dem menschenleeren molekularbiologischen Labor tief unter der Erde, das noch kurz vor der Katastrophe in einen zehn Stockwerk tiefen, atomsicheren Bunker umgezogen war. Die überirdischen Neubauten des alten Biozentrums hatten nicht überlebt und waren völlig zusammengestürzt. Aber der Wissenschafts-betrieb unter der Erde, der noch kurz vorher durch enge Zusammenarbeit der Universität Wien mit einigen amerikanischen Großinvestoren große Fortschritte erzielt hatte, konnte aufrechterhalten werden, obwohl nicht alle Projekte überlebt hatten. Die Investoren sahen eine besonders strategische Lage der alten k. u. k. Hauptstadt als Tor zu Osteuropa und pumpten deswegen Milliarden von Dollars in ethisch nicht unumstrittene Klonierungsprojekte. Zum Schutz vor dem Widerstand von Gruppen wie Greenpeace, die immer aggressiver ganze Forschungs-einrichtungen lahmlegten, entschloss man sich deswegen, die Forschung nach unten in die Erde in einen Bunker zu verlegen und heimlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit weiterzuarbeiten, während in dem überirdischen Biozentrum zur Tarnung auf harmlose, ja sogar von allen Umweltschutzgruppen geförderte grüne Biotechnologie umgestellt wurde. Die Geheimhaltung funktionierte vorzüglich.