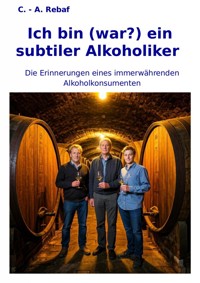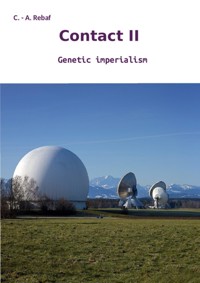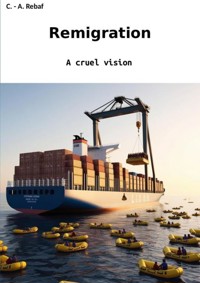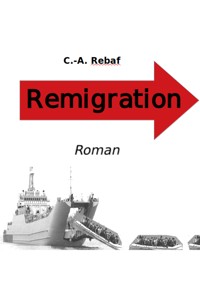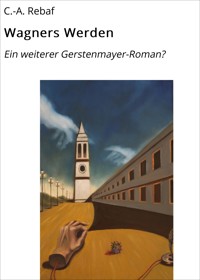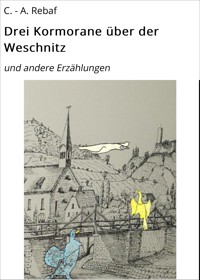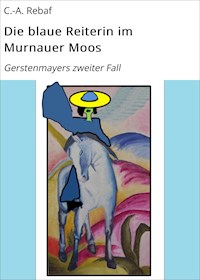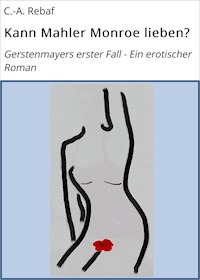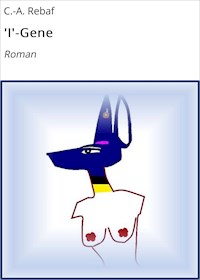6,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Geschichten aus der Kurpfalz
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte des Weinheimer Schlosses wird witzig und fantasievoll von den pfälzischen Erbfolgekriegen bis heute beschrieben. Dabei geht es nicht nur um Gebäude, sondern auch um die Parkanlage und die Bepflanzung mit exotischen Bäumen, die im milden Klima der Bergstrasse wachsen. Es geht auch um Potentiale, die die Kleinstadt mit dem schönen Schloss verpasst hatte, sowie die Entwicklung des Adels und der Industriellen im 19. Jahrhundert. Dabei tauchen plötzlich ganz neue Erkenntnisse auf, wie etwa die Frage, ob Mozart im Weinheimer Schloss war und am Piano gespielt hatte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
C. - A. Rebaf
Bergamotte über Zitrusbaum
Geschichten über das Weinheimer Schloss
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Impressum
Widmung
Einleitung
Ein schwieriger Beginn
Die Hochzeit des Jahres 1671
Ein heißer Juli
‚le chef‘ hat die Stadt freigegeben
Das Wettschiessen zweier Kanoniere
Die Franzosen ziehen weiter
Urs Maria der Schmied
Ein überraschendes Wiedersehen
Aufruhr im Stadtrat
Jan Willem träumt
Historische Ratssitzungen
Ihro Durchlaucht will sofort eine Unterredung
Der Ausritt über dem Müllheimer Tal
Jan Willem zieht weiter
Nachzucht eines Berckheimschen Citrusbaumes
Der Südflügel und die Neue Zeit
War Mozart im Weinheimer Schloss?
Ein holpriger Übergang ins 19. Jahrhundert
Hat Carl Theodor die Kurpfalz verraten und zerstört?
Napoleon enteignet die Kurfürsten von der Pfalz
Jane Digby eine singuläre Frau ? – ihrer Zeit weit voraus!
Besucher im Schlosspark und eine Romanze mit blutigem Ende
Das Schloss als Spital
Ein Stammsitz muss her
Endlich eine rauschende Hochzeit im Schloss
Der Schlossherr im Dienste seiner Durchlaucht dem Großherzog von Baden
Große Könige bauen große Schlösser und kleine?
Die Libanonzeder im ‚kleinen‘ Schlosspark
Der ‚Exoten‘wald
Die schönste Frau von Berlin
Aufzucht von Mammutbäumen
Der beginnende Niedergang eines Adelsgeschlechts
Das Leben muss weiter gehen
Wieder ein Weltkrieg
Das Rätsel wird gelüftet
Brutaler Darwinismus an den Berghängen
Die Adligen suchen sich neuartige Jobs: Rennfahrer für Porsche
Impressum neobooks
Impressum
Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig. Alle namentlich genannten Personen sind frei erfunden.
Text und Buchumschlag: Alle Rechte bei C.-A. Rebaf 2024
Widmung
Ingrid Noll gewidmet,
wir schreiben beide in der Nordstadt.
Einleitung
An einem herrlichen Oktober-Herbsttag bin ich auf dem Weg zum Altenheim durch den Schlosshof gegangen. Ich wollte meine alte Mutter besuchen. Plötzlich fiel mir der alte Zitronenbaum an der Schlosswand auf, den ich als gebürtiger Weinheimer natürlich von Kindesbeinen an kenne, auf den ich aber bewusst noch nie geachtet hatte. Mit meinem neuen Blick auf die Pflanzenwelt, den ich seit meiner Pensionierung plötzlich hatte, frage ich mich natürlich sofort, wie lange dieser Baum da wohl schon steht? Ich habe mich vergewissert, dass er nicht in einem Topf wächst, der im Winter in ein Gewächshaus verbracht werden kann, nein er steht wirklich fest verwurzelt in der Erde. Bei dem Bücken unter den Baum fielen mir einige gelbe Früchte auf, die auf den Boden gefallen waren. Ich sammelte einige auf und nahm sie mit nach Hause. Dabei ploppte sofort eine weitere Frage in meinem Hirn auf:
Sollte er etwa so alt sein wie der Exotenwald, den Christian von Berckheim anlegen liess? Das würde bedeuten, mehr als 150 Jahre? Konnte das sein, dass er all diese Winter überlebte, ohne zu erfrieren?
Klar, die Schlosswand schützte ihn gegen Norden und er kam in den Genuss der Morgensonne im Osten, was vor allem bei Frostnächten von Vorteil ist.
Zu Hause schnitt ich die Früchte mit einem scharfen Messer auf. Meine Absicht war, die Samenkerne zu entnehmen, um eine Nachzucht zu beginnen. Das ist mein derzeitiges Steckenpferd. Irgendwie muss meine Rentnerzeit ja gefüllt werden. Doch da plötzlich, welch ein Duft strömte in meine Nase! Vorsichtig probierte ich den Saft. Nein, das war nicht der saure Geschmack einer Zitrone, aber ja, es war auch nicht so süss, wie eine Orange. Für mich lag der Geschmack dazwischen. Aber da war noch eine Komponente, ganz zart, aber erkennbar:
Bergamotte.
Dieser Befund liess mich daran glauben, dass der Baum tatsächlich sehr alt war und eine Geschmacksnuance der Vergangenheit bewahrte. Sollten die Zitrusfrüchte im 19tem Jahrhundert so geschmeckt haben? Ich beschloss – um hier wissenschaftlich korrekt zu bleiben – nicht mehr von einem ‚Zitronen‘baum – wie es in Weinheim üblich ist – zu reden, sondern von einer Citrus-Frucht. ‚Citrus‘ ist der übergeordnete Begriff, der neben Zitronen auch Orangen und Pampelmusen beinhaltet.
Übrigens, die Früchte enthielten sehr, sehr viel Kerne. Da ich mich damit auskannte, schälte ich diese und versuchte sie in Blähton-Körnchen zum Keimen zu bringen, was auch innerhalb von drei Wochen im November gelang. Leider zog die Feuchtigkeit ein Drosophila-Pärchen an und als die Keimblätter gerade in die nächste Generation übergehen wollten, schlüpften deren Junge aus. Da Sabeth diese 'Mückli' hasst, wurde das Behältnis von der warmen Fensterbank über der Heizung verbannt, was zum Absterben von Mückli, aber bedauerlicherweise auch des ‚Citrusbäumli‘ führte. Na ja, nächsten Herbst gibt es wieder Citrusfrüchte. Der Geruch blieb jedoch in mir.
Dieser Geruch liess mich neugierig werden und in die Vergangenheit einsteigen.
Ein schwieriger Beginn
Weinheim und die Windeck als Schutzburg später, gehörten zum Machtbezirk des Klosters Lorsch, in dessen Büchern der Stadtname 755 n. Chr. zum ersten Male auftaucht.
So habe ich es von meinem unvergesslichen Lehrer Ferdinand Müller in der Heimatkunde gelernt. Hatte er es wiederum bei Albert Ludwig Grimm1 gelesen?
Jedenfalls hatten nicht meine Eltern, sondern Herr Müller die Liebe zu meiner Heimat in mein Herz gepflanzt, als ich bei ihm die dritte und vierte Klasse absolvieren durfte. Er scheint das auch gespürt zu haben, denn zum Abschluss hatten nur wir beide ein Projekt, das ich als sehr aussergewöhnlich empfand: Ich erzählte ihm von einem alten Butterstampfer, der ungenutzt und voller Spinnweben bei meiner Oma Eva in der Scheune stand. In ein solches Gerät füllte sie früher den Rahm der Milch und bewegte den Stempel im Innern so lange auf und ab, bis aus dem Rahm Butter und Buttermilch wurden. Herr Müller war total begeistert und forderte mich auf, ihm das Gerät in die Schule mitzubringen. Ich fragte bei Oma an, die freudig einverstanden war, diesen ‚Krempel‘ endlich loszuwerden. Als ich es jedoch hochhob, um es abzutransportieren, zerfiel es in die einzelne Dauben, die die äussere Wandung, wie bei einem Fass, bildeten. Bestürzt nahm ich alle Teile trotzdem mit. Er beruhigte mich und wir beiden leimten an einem Nachmittag im Werkraum alles wieder zusammen. Ich glaube mich zu erinnern, dass er eigentlich Werklehrer war und handwerklich sehr geschickt. Als unser Werk vollendet war, hat er es noch im Unterricht als Anschauungsgegenstand benutzt und die Funktion erklärt. Danach überzeugte er mich, dass der Butterstampfer unbedingt ins Weinheimer Heimatmuseum verbracht werden müsse, um für spätere Generationen erhalten zu bleiben. Jahrzehnte später sah ich den Butterstampfer meiner Oma Eva wieder in einem Raum des Museums, der die bäuerliche Umgebung in der guten alten Zeit dokumentierte.
Ich berichte so ausführlich über diese Episode, weil ich denke, dass der Leser auch ein Anrecht hat, zu erfahren, wer diesen Roman schreibt und aus welcher Motivation heraus.
So, aber jetzt schnell zurück zur Geschichte Weinheims:
Das Kloster Lorsch gehörte zum Erzbistum Mainz und somit auch Stadt und Burg an der Weschnitz.
Aber ausgerechnet an diesem verschlafenen Ort, trafen sich zwei Interessenbereiche, denn das Hoheitsgebiet der Pfalzgrafen schloss sich im Süden an und die Weschnitz war Grenzfluss. Es gab keine kriegerischen Auseinandersetzungen, aber selbst vor diversen Kaisern wurde der Fall ‚Weinheim an der Weschnitz‘ mehrmals verhandelt. Endlich sprach dann einer, Kaiser Ludwig VI. 1345, zwei Jahre vor seinem Tod, ein finales Machtwort Als Wittelsbacher schlug sein Herz natürlich für die Pfalz, sodass er die Stadt den Kurfürsten aus Heidelberg und nicht dem Erzbischof in Mainz zuschlug.
Allgemeines Aufatmen in dem kleinen Dörfchen damals, das vor allem von einem Adelsgeschlecht, dem der von Swende beherrscht wurde. Sie besassen weite Ländereien und Immobilien rund um das Obertor, von dem man aus in die Stadt gelangte.
Hundert Jahre später interessierte sich der regierende Pfalzgraf Ludwig III. plötzlich für das verschlafene Nest, einige Kilometer südlich seiner Hauptstadt Heidelberg und kaufte den von Swende peu a peu alles ab2.
Erst sein Urenkel Pfalzgraf Ludwig V. liess am Obertor Platz schaffen für ein neues kleines Schlösschen, das er 1537 in dem gerade vorherrschenden Architekturstil der Renaissance errichten lies. Es ist ihm und seinen Baumeistern wohl ein Kleinod gelungen, wie kundige Weinheimer später bestätigten.
Die Kurfürsten von der Pfalz hatten fortan eine kleine Dependance in Weinheim, die sie hin und wieder nutzen.
Besonders einer, Ottheinrich, weilte während einer Pestzeit fünf Jahre in dem Schloss. Man sagt ihm nach, das der Dilsberg und das Örtchen Lindenfels im Odenwald ihm zu steil gewesen wären, und er mit seinem übergewichtigen Körper nur in Weinheim leben könne. Seine Leibärzte hatten ihm diese Alternativen als Pest-sicher angeboten.
Aber er scheint das Örtchen dann während seines Aufenthalts in sein Herz geschlossen zu haben.
Hatte sein berühmter Ottheinrichsbau im Heidelberger Schloss Weinheim zum Vorbild? Er ordnete den Bau sofort nach seiner Weinheimer Zeit an. Vielleicht wollte er es doch noch besser machen! Vor allem aber grösser!
Die Hochzeit des Jahres 1671
Eigentlich sollte doch eine Hochzeit etwas Fröhliches sein. Aber diese spezielle stand unter keinem guten Stern. Der Brautvater hatte es sich schlau überlegt und wollte es den Österreichern nachmachen. Ganz nach deren Motto:
Bella gerant alii, tu felix Austria nube
Wenn ich meine weit zurückliegenden Lateinkenntnisse bemühe, wäre das frei übersetzt:
Andere führen Kriege, du glückliches Österreich heiratest.
In diesem Fall muss der Spruch allerdings etwas abgewandelt werden und Austria durch Palatinaersetzt werden, denn wir befinden uns nicht etwa in Wien an der Donau, sondern weit westlich davon in Heidelberg am Neckar. Die Braut fuhr mit ihrem Hofstaat, angeführt von der Ehevermittlerin an diesem nass grauen Novemberweiter gen Westen nach Metz. Zuerst musste sie jedochihre Konfession wechseln und in die katholische Kirche eintreten, dann erst morgen würdedie Trauung in der Kathedrale St. Etienne vollzogen werden können. Wie alle Bräute ist auch Elisabeth nervös und gespannt auf ihren Ehegatten, den sie bisher nur von Bildern kannte.
Ich stelle mir vor, das lief so, wie eine Internet-Match einer Datingplattform ohne ein nachfolgendes Date, sodass die Projektionsfalle weit offensteht.
Der nächste Tag war noch trostloser und der Nieselregen schlug in einen Schneeregen um, der am Morgen die Stadt leicht weiss puderte. Aber das Weissschlug schon schnell in ein schmutziges Grau um.
Welch ein idealer Tag zum Heiraten!
Die Kirche war pompös geschmückt, aber einer fehlte dann doch, der Bräutigam und Elisabeth muss ihre Enttäuschung hinter der starren Schminke ihres Gesichts verbergen, denn die Trauung wurde ‚per procurationem‘ mit einem alten Knacker als Stellvertreter ihres Traumprinzen vollzogen.
Hätte sie nicht sofort vom Traualtar flüchten oder besser noch die Frage des Bischofs mit ‚nein‘ beantworten sollen?
Aber sie wusste ja von ihrem Vater, wie wichtig ihre Heirat hier in Frankreich für den Frieden in Heidelberg sei. Sie dachte an die fleissigen, fröhlichen Menschen dort, die es auch in Zukunft gut haben sollten. Deshalb nahm sie alles auf sich und verzichtete auf ein persönliches Glück, opferte es bewusst der Staatsraison.
Dann schoss ihr der versöhnliche Gedanke durch den Kopf, dass sie immerhin gerade mit dem Bruder des Sonnenkönigs, dem Star Europas unter den gekrönten Häuptern, verheiratet worden war. Welche junge Frau konnte einen solchen Aufstieg schon vorweisen? Was war sie doch für ein Glückskind! Noch vor einem halben Jahr tollte sie mit den einfachen Kindern an der Heiliggeistkirche durch die Hauptstrasse und feierte am Sonntag Lätare den sogenannten ‚Sommertag‘, ein eigentlich heidnischer Brauch, dem sie auch in Zürich ähnlich huldigten, wenn sie den ‚Bögg‘ verbrennen.
Jetzt, heute, nur wenige Monate später stand sie im Fokus der europäischen Grossmachtspolitik, fühlte sich aber benutzt wie ein Waschlappen.
Diese hochnäsigen Franzosen akzeptierten das rotznäsige pummelige Gör mit seinen 19 Jahrennicht, dass ein grässliches Französisch sprach und ihre Briefelieber in ihrer hölzernen Deutschen Muttersprache verfasste. ‚Dégoûtant!‘
Endlich, vier Tage später sah sie ihren 12 Jahre älteren Ehegatten. Welch eine Enttäuschung! Ein kleines Kerlchen mit pechschwarzen Haaren, schlechte Zähne, einem schmalen Gesicht und einer riesigen Nase. Seine weibische Art widersprach ihrem Ideal eines gestandenen Mannes. Wo gab es denn so etwas: Er benötigte mehr Zeit für seine Toilette, als für seine Muskelstärkung. Aber er kannte dafür alle Tricks der weiblichen Umgangsformen am Hof.
Sie hatte von Anfang an den Verdacht, dass er homosexuell war, was sich dann auch immer mehr bestätigte. Meinte es das Schicksal gut und erlöste sie schon nach 30 Jahren von ihm? Oder hätte sie sich nicht lieber nur 30 Monate gewünscht? Aber da sie ihre grosse Lust zum Briefschreiben hatte, konnte sie ihre Lebenszeit sinnvoll nutzen.
Ihre Eltern, inzwischen geschieden, waren auch keine besseren Vorbilder für eine gute Ehe.
Der Vater zerbrach dann schier, weil sein Plan mit der Zweck-Heirat in keinster Weise aufging. Statt einer franco-palatinischen Verbrüderung auf Basis der Hochzeit seiner Tochter mit dem Bruder des Sonnenkönigs, hatte dieser ganz andere Pläne und zettelte einen Krieg mit den Niederlanden an. Der forsche General Turenne führte die französische Armee an und focht ständig gegen die kaiserlich-habsburgischen Truppen. Dabei kam er warum auch immer näher nach Süden und stand plötzlich zum Entsetzen von Elisabeth auch in der Kurpfalz.
War es nur, weil es da einiges an Fourage zu holen gab, oder weil die Wehrhaftigkeit der Kurpfalz sehr im Argen lag?
Schlacht bei Sinsheim, dann Schlacht bei Ladenburg und das alles bereits 3 Jahre nach der ‚Friedenshochzeit‘ von Elisabeth.
Welch eine Ironie der Geschichte!
Ein heißer Juli
Dunkle schwere Gewitterwolken, mit schwefelgelben Strukturen,wälzen sich tief von Südwesten durch die Rheinebene. Jeder in Weinheim weiss, wenn sich solche Gebilde aus dem ‚Ladenburger Eck‘ auf Weinheim zu bewegen, wird es ungemütlich.
Da, gerade noch rechtzeitig, bevor das Unwetter losbricht, erreicht ein Reiter das Obertor. Er ist blutverschmiert, seinen linken Arm hängtin einer Art Schlinge, die er aus einem Jutesack zusammen mit einigen Hanfseilstücken geknüpft hatte.
„Die Franzosen haben Ladenburg genommen!“, war seine Nachricht, die er mit letzter Kraftan die Schildwachen übermittelte. Dann rutschte er aus dem Sattel und fiel auf den Boden. Der eine Uniformierte, versuchte ihn wieder auf die Beine zu stellen, während der andere schreiend durch das Tor in die Stadt stürmte, um die Bevölkerung laut zu warnen:
„Die Franzose sinn in Laadeburg!“, war seine schlichte Botschaft.
Sein Ruf hallte wie ein höllischer Dämon auf dem Marktplatz zurück. Schon übernahmen Dutzende von kleinen Jungen seine Worteund liefen sternförmig in alle Richtungen bis in die entlegensten Winkel der Stadt. Die Angst kroch aus den Kellern und bemächtigte sich der Häuser, die noch dichter gedrängt aufeinander zu rücken zu scheinen, um ihr zu entgehen.
Inzwischen war der Schildwächter beim Schultheiss im alten Rathaus angelangt und es wurde eilig eine Bürgerversammlung einberufen. Der Ausrufer stand schon mit seiner Trommel parat und platzierte sich an die prominenten Stellen der Stadt, um das Unheil offiziell unter dem dumpfen erschreckenden Trommelwirbel zu verkünden.
Jeder wusste jetzt: Wir sind den Franzosen gnadenlos ausgeliefert. Die kaiserlichen Truppen stehen viel zu weit weg, als dass sie rechtzeitig zu unseremSchutz hier sein könnten.
Es war lediglich ein Wettlauf des herannahenden Gewitters mit der Vorhut der französischen Armee. Wer würde zuerst über das arme, bemitleidenswerte Städtchen hereinbrechen?
Der Pfarrer liess die Kirchenglocken läuten und einige Gläubige versammelten sich im Kirchenschiff um ihn.
Er versuchte durch eine improvisierte Ansprache seine Schäfchen zu beruhigen:
„Die Franzosen sind christliche Mitbrüder! Sie werden uns sicher nichts antun, wenn wir uns ruhig verhalten!“
„Aber sie sind katholisch und wir reformiert!“, kamen wütende Zwischenrufe. „Die 'Katholen' hassen uns!“
Dagegen hatte er keine Worte mehr. Um so schlimmer, als eine rothaarige Frau, das Kräuterweiblein vom Saukopf, eine als Hexe stadtbekannte Frau das Wort ergriff:
„Bringt eure Töchter in Sicherheit! Die Franzosen sind die schlimmsten Vergewaltiger!“
Jetzt hatte er endlich eine willkommene Gelegenheit, das Wort wiederzuergreifen:
„Vertraut auf Gott und nicht auf diese Hexe!“
Ein aufgeregtes Murmeln ging durch die Menge, die immer mehr anschwoll.
Schon meldete sich die Hexe wieder zu Wort und rief laut.
„