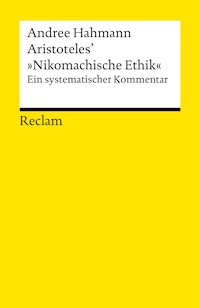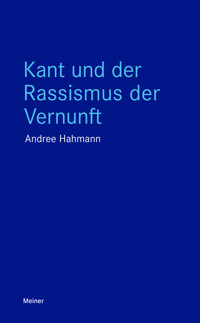
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Felix Meiner Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Blaue Reihe
- Sprache: Deutsch
War Kant ein Rassist? Ist seine Philosophie selbst von rassistischen Vorannahmen durchzogen? Diese kontroverse Frage spaltet den philosophischen Diskurs und hat inzwischen auch eine breitere Öffentlichkeit erreicht. Andree Hahmanns Buch bietet eine differenzierte Analyse der komplexen Debatte. Es trennt klar zwischen Kants persönlichen Einstellungen und den systematischen Implikationen seiner Philosophie, betrachtet verschiedene Facetten des Rassismusbegriffs und untersucht die argumentativen und historischen Voraussetzungen der Kontroverse. Dabei werden wichtige Differenzierungen, die in der Kantforschung für das Verständnis der kantischen Schriften entscheidend sind, nicht aus den Augen verloren. Denn für die Beantwortung dieser Frage ist es nicht unerheblich, welche Teile der kantischen Philosophie genau gemeint sind. Handelt es sich um vorkritische Schriften oder um zentrale Aspekte der reifen kritischen Philosophie? Sind empirische oder apriorische Elemente betroffen? Welche systematische Bedeutung haben die umstrittenen Aussagen für Kants Gesamtwerk? Der Autor versucht, diese Fragen in einer Weise zu beantworten, die auch Nicht-Kant-Expert:innen einen guten Überblick über Kants Werk und diese Debatte ermöglicht. Dabei verfolgt er einen aufklärerischen Ansatz, der die historischen Kontexte berücksichtigt und zugleich für begriffliche Klarheit sorgt. Auf diese Weise plädiert er für einen rationalen Dialog, der auf nachvollziehbaren Argumenten beruht. Das Buch richtet sich damit an alle, die diese wichtige philosophische Debatte in ihrer ganzen Tiefe verstehen wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
1. Einleitung: Kants rassistische Gesinnung
1.1 Hat Kant eine rassistische Gesinnung? (K)eine Frage der Kantphilologie
1.2 Ein Gesinnungswandel?
1.3 Nicht Gesinnung, sondern Ideologie
2. Welcher Rassismus?
2.1 Der Rassismusbegriff
2.2 Historischer Ursprung des Rassismus
2.3 Die Anti-Rassismus-Konvention
2.4 Rassismus ohne Rassen
2.5 Rassismus ohne Akteure
3. Kants Moralischer Universalismus in der Kritik
3.1 Die Bedeutung der kantischen Philosophie für den Kampf gegen Rassismus
3.2 Universalismus und Rassismus
3.3 Kant über Person und Persönlichkeit
3.4 Kants moralischer Universalismus
3.5 Moral und Recht: Warum haben nicht alle Menschen dieselben Rechte?
3.6 Zur Idee des Weltbürgerrechts
3.7 Person, Staatsbürgerschaft und Untermenschen
4. Kant über Menschenrassen
4.1 Kants Rassentheorie im Kontext
4.2 Welches Ziel verfolgt Kant mit seiner Rassentheorie?
4.3 Kants Theorie der Menschenrassen
4.4 Noch einmal Kant und Forster
4.5 Wie ist Kants Rassentheorie zu beurteilen?
5. Die Bestimmung des Menschen: Vernunft und Geschichte
5.1 Von Schafen und Menschen
5.2 Das Ende der Geschichte und die Bestimmung des Menschen
5.3 Das System der Vernunft
5.4 Die Geschichtsphilosophie in Kants kritischer Systematik
5.5 Geschichte, aber anders: Herders Kritik am Universalismus
5.6 Warum ist Kants kritische Geschichtsphilosophie diskriminierend?
6 Schluss: Ist die Vernunft der Aufklärung an ihrem historischen Ende?
6.1 Die Kritik der ausschließenden Vernunft
6.2 Die Kritik der einschließenden Vernunft
6.3 Die Kritik der universalistischen Vernunft
Siglen
Literatur
Anmerkungen
Vorwort
Die Frage, ob Kant ein Rassist gewesen sei, geistert seit langem durch den philosophischen Diskurs und hat in den letzten Jahren auch die breitere Öffentlichkeit erreicht. Es ist mittlerweile fast üblich geworden, Berichte, die sich im weitesten Sinne mit Kant oder seiner Philosophie beschäftigen, mit dem Hinweis einzuleiten oder zu entschuldigen, dass Kant ein Rassist gewesen sei und in seiner Philosophie selbst noch nicht das aufgeklärte Bewusstsein erreicht habe, das sein eigener moralischer Universalismus vorschreibt.
Auch wenn diese Debatte in den letzten Jahren, wie viele philosophische Debatten, einen hohen Grad an Spezialisierung erreicht hat, ist es durchaus sinnvoll, noch einmal über ihre Grundlagen nachzudenken – vor allem aber über die Voraussetzungen dieser Fragestellung und der philosophischen Auseinandersetzung mit dieser Frage. Was den meisten, die sich auf diese Diskussion einlassen, vielleicht bewusst ist, aber meines Erachtens zu wenig beachtet wird, sind die zahlreichen argumentativen Vorannahmen, die die einzelnen Teilnehmer dieser Diskussion mitbringen und auf denen letztlich ihr Urteil über Kants Philosophie zu einem nicht unerheblichen Teil beruht. Dies führt dazu, dass Kritikerinnen und Verteidiger der kantischen Position nicht selten aneinander vorbeizureden scheinen.
Sehr schnell fällt auf, dass einige zentrale Punkte in der Debatte entweder nicht beachtet oder vermischt werden. Zunächst ist es wichtig, klar zwischen den beiden Fragen zu unterscheiden, ob Kant eine rassistische Gesinnung hat, die sich etwa in seinen Vorlesungen oder auch in Tischgesprächen mit seinen Gästen zeigt, oder ob Kants Philosophie rassistisch ist. Ersteres wäre zwar bedauerlich und nach heutigen Maßstäben sicherlich eine moralische Verfehlung des Philosophen, hätte aber natürlich ganz andere Konsequenzen, als wenn sich herausstellen sollte, dass Kants Philosophie rassistisch ist. Es liegt ohne Zweifel auf der Hand, dass es zwischen beiden Fragen enge Berührungspunkte gibt. So könnte man einwenden, dass eine zutiefst rassistische Einstellung auch die Auswahl und Behandlung philosophischer Themenstellungen beeinflussen kann und vermutlich auch beeinflusst hat. Ebenso kann man natürlich nicht erwarten, dass ein überzeugter Antirassist eine Philosophie entwickelt, die rassistischen Annahmen Vorschub leistet. Dennoch halte ich es für sinnvoll, die beiden Fragen klar voneinander zu trennen. Denn wenn es in erster Linie darum geht, Kants persönliche Einstellung zu beurteilen, dann müssen auch andere Zeugnisse für diese Einstellung in Betracht gezogen werden, und der Umgang mit den vorhandenen Texten muss ein anderer sein. So wird in der Forschung durchaus auch darauf hingewiesen, wie sich Kant gegenüber Gästen über gesellschaftliche Minderheiten geäußert hat, ob er z. B. abfällige oder harte Urteile gefällt hat. Vor allem aber gewinnen aus dieser Perspektive Texte an Gewicht, die in systematischer Hinsicht eine eher untergeordnete Rolle spielen, wie etwa die für diese Fragestellung äußerst wichtigen Vorlesungsmitschriften der Studenten Kants, die zu einem nicht unerheblichen Teil aus Material bestehen, das Kant aus der zeitgenössischen Literatur exzerpiert und kommentiert hat. Die Kommentare, aber auch die Auswahl selbst lassen möglicherweise Rückschlüsse auf Kants Haltung zu. Wenn man die Diskussion unter diesem Gesichtspunkt führt, stellen sich auch andere Fragen bzw. sind andere Ergebnisse der Debatte zu erwarten. Man wird beispielsweise fragen, ob Kants Gesinnung mit seiner Philosophie vereinbar ist oder ob Kant seinen eigenen moralischen Ansprüchen nicht gerecht wird. Schließlich kann danach gefragt werden, ob die Ausarbeitung der kritischen Philosophie Einfluss auf diese Gesinnung genommen hat und ob Kant in einem späteren Lebensabschnitt von diesen früheren rassistischen Annahmen Abstand genommen, sie vielleicht sogar revidiert hat.
Steht jedoch die Klärung der Frage im Vordergrund, ob die kantische Philosophie und die in dieser Philosophie relevanten philosophischen Annahmen und Konzeptionen rassistisch sind, ergibt sich ein ganz anderes Vorgehen. Denn dies hat nicht nur Einfluss auf die zu untersuchenden Texte, sondern auch auf die systematische Einordnung der Textzeugnisse. So stellt sich z. B. die Frage, welche Teile oder Aspekte der kantischen Philosophie genau und im Einzelnen als rassistisch einzustufen sind. Eine solche Untersuchung wird auch die in der Kantforschung etablierten Differenzierungen und systematisch relevanten Klassifikationen der Philosophie Kants berücksichtigen müssen. So ist es unter dieser Perspektive betrachtet nicht unerheblich, ob sich die vermeintlich rassistischen Aussagen in vorkritischen Schriften finden oder ob es sich um Elemente der reifen kritischen Philosophie handelt oder ob diese einen apriorischen oder empirischen Status haben. Wären etwa nur vorkritische Annahmen oder empirische Elemente betroffen, dann wäre das sicherlich bedauerlich, philosophisch aber belanglos, da andere empirische Voraussetzungen zu anderen Urteilen führen und diese Voraussetzungen selbst kontingent sind. Anders ausgedrückt, eine moderne Kantianerin könnte sich problemlos die Grundsätze der kantischen Philosophie aneignen und auch auf moderne Gegebenheiten anwenden, ohne Gefahr zu laufen, selbst zu rassistischen Urteilen zu kommen, weil die empirischen Ausgangsvoraussetzungen, also auch der aktuelle Stand der Forschung, eben ein anderer sind, der sich weit von dem entfernt hat, was Kant beispielsweise über die biologische Beschaffenheit des Menschen und die Regeln der Vererbung menschlicher Eigenschaften wissen konnte. So betrachtet spräche auch nichts dagegen, dass man sich auf Kant im Kampf gegen rassistische Vorstellungen bei Kant berufen und diesen Kampf letztlich sogar auf kantische Grundsätze gründen könnte.
Das sähe allerdings ganz anders aus, wenn sich herausstellen sollte, dass Kants reife kritische Philosophie selbst von rassistischen Annahmen durchdrungen ist. In diesem Fall wird zu fragen sein, welche Aspekte genau betroffen sind: Handelt es sich um Annahmen, die unkritisch von anderen übernommen, von außen in die Philosophie implementiert wurden, oder betreffen diese Punkte zentrale Aspekte der kritischen Philosophie? Handelt es sich letztlich vielleicht sogar um bestimmte Grundannahmen oder um Konsequenzen, die sich aus wesentlichen Prinzipien ergeben?
Die Verteidigung der kantischen Position, aber auch die Beantwortung der Frage, wie genau mit Kants Philosophie in Zukunft umgegangen werden soll oder muss, hängt von diesen Punkten ab. Wenn sich nämlich ergeben sollte, dass die kantische Philosophie als Ganzes von rassistischen Vorstellungen infiziert ist, muss die Reaktion anders ausfallen, als wenn sich herausstellt, dass sich diese Aussagen auf einige begrenzte, letztlich nicht einmal im engeren Sinne philosophische Aspekte der kritischen Philosophie beziehen. In diesem Fall können diese Aspekte identifiziert und unter Umständen in einer kritischen Reflexion der Voraussetzungen aus der kantischen Philosophie herausgelöst werden. Sollte sich jedoch abzeichnen, dass Kants Philosophie insgesamt auf rassistischen Vorannahmen beruht oder wesentlich zur ideologischen Produktion rassistischer Annahmen beiträgt, müsste der Umgang mit ihr aus nachvollziehbaren Gründen ein anderer sein.
Es versteht sich von selbst, dass Verteidiger und Kritiker Kants in dieser Frage zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Es gehört seit langem zu den Strategien der Kantverteidiger, die systematische Bedeutung der einzelnen Aussagen herunterzuspielen, während die Kritiker versuchen, sie als zentrale Aspekte der kritischen Philosophie hervorzuheben. Aber unabhängig davon, wie man zu diesen Ansätzen steht, glaube ich, dass die Frage nach dem Gewicht der rassistischen Aussagen und ihrer systematischen Bedeutung für die Philosophie Kants, das heißt eine genaue und detaillierte Aufdeckung all der systematischen Zusammenhänge, die von den rassistischen Annahmen betroffen sind oder unter Umständen diese Aussagen überhaupt erst hervorgebracht haben, äußerst wichtig ist, da nur so ein Ergebnis erzielt werden kann, das zumindest von allen Seiten akzeptiert werden kann.
Ein weiterer, vielleicht der bei weitem wichtigste Punkt in dieser Diskussion ist jedoch die Frage, was überhaupt als Rassismus anzusehen ist. Dieser Frage wird vor allem von den Verteidigern der kantischen Philosophie wenig Beachtung geschenkt. Dabei hängt von ihr viel, wenn nicht alles ab, ob Kant oder seine Philosophie als rassistisch angesehen werden kann. Der Begriff selbst stößt auf einhellige Ablehnung, und alles, was damit bezeichnet wird, erfährt die gleiche Ablehnung. Die grundlegende Ablehnung entbindet nicht von der Pflicht, genau zu untersuchen, welche Gedanken unter welchen Umständen als diskriminierend einzustufen sind und ob tatsächlich jede Form der Diskriminierung zwangsläufig als rassistisch zu bewerten ist. Vielmehr erhöht sie sogar die Dringlichkeit dieser Untersuchung. Es ist daher aufschlussreich, die Entwicklung der Verwendung und des Verständnisses des Begriffs etwas genauer zu betrachten. Wie wir sehen werden, gehen nicht zuletzt in diesem Punkt die Annahmen und Erwartungen der Kritiker und der Verteidiger weit auseinander. Auch wenn im Rahmen dieser Untersuchung weder ein verbindliches Verständnis des Rassismusbegriffs aufgezeigt noch eine umfassende Analyse des Phänomens geleistet werden kann, ist es für ein besseres Verständnis der Kontroverse doch sehr wichtig, zumindest auf die teils erheblich voneinander abweichenden Vorstellungen sowie die zugrunde liegenden argumentativen Voraussetzungen der Bedeutungsentwicklung des Rassismusbegriffs genauer hinzuweisen.
Mein Anliegen ist sowohl bei der Analyse der argumentativen Grundlagen der Kontroverse als auch bei der Klärung des begrifflichen Instrumentariums primär aufklärerischer Natur. Das Hauptziel dieser Arbeit besteht darin, die Diskussion um Kants Rassismus transparenter zu gestalten und die verschiedenen Aspekte und Fragestellungen der Debatte auch für fachfremde Leserinnen und Leser klar herauszuarbeiten und voneinander abzugrenzen. In diesem Sinne verstehe ich mein Vorhaben als ein im weitesten Sinne aufklärerisches Projekt.
Die Aufklärung selbst wird dabei zugleich als historisches Phänomen betrachtet. In meinen Analysen bemühe ich mich daher, neben der argumentativen Nachvollziehbarkeit und systematischen Einordnung der kantischen Positionen stets auch den historischen Kontext zu berücksichtigen, der diese Argumente erst vollständig verständlich macht. Die systematische aufklärerische Zielsetzung dieser Arbeit wird somit durch eine historische Dimension ergänzt: Ich werde auf historische Zusammenhänge und Fragestellungen hinweisen, die in der bisherigen Aufklärungsforschung in dieser spezifischen Konstellation meines Erachtens unzureichend beachtet wurden.
Abschließend sind einige Anmerkungen zu den unvermeidlichen Begrenzungen der vorliegenden Diskussion angebracht. Insbesondere Vertreter der Rassismuskritik betonen häufig, dass eine objektive oder rein theoretische Auseinandersetzung mit diesem Thema nicht möglich sei. Vielmehr hat sich die Tendenz etabliert, den Diskurs entlang der Trennlinie zwischen Rassismus und Antirassismus zu strukturieren. Wiederholt wird darauf hingewiesen, dass der Kampf gegen unterdrückerische rassistische Strukturen keine »Farbenblindheit« zulasse – ja dass bereits die Annahme einer möglichen farbenblinden Position selbst eine rassistische Vorstellung darstelle.
Diese Argumentation erscheint mir allerdings nicht vollständig überzeugend. Davon abgesehen verfolge ich kein politisches Programm, weshalb ich diesen Aspekt in meiner Betrachtung zurückstellen kann. Stattdessen bemühe ich mich – allen Einwänden zum Trotz –, einen theoretischen Standpunkt einzunehmen. Die vielfach kritisierte »Farbenblindheit der Vernunft« mag zwar keinen unmittelbaren Erfolg im Kampf gegen »rassistische Strukturen« versprechen, birgt jedoch das Potenzial, vernunftbegabte Menschen in einen rationalen Dialog einzubinden, der nicht die Unterschiede in der Hautfarbe in den Mittelpunkt stellt, sondern nachvollziehbare Argumente.
Möglicherweise setze ich mich mit diesem Vorgehen dem Vorwurf aus, meinen eigenen Ansatz nicht ausreichend kritisch zu reflektieren und letztlich zu optimistisch zu sein. Dieser Einwand mag insofern berechtigt sein, als ich tatsächlich eine bewusst optimistische Haltung einnehme – eine Position, die ich an dieser Stelle ausdrücklich bekräftigen möchte. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass der bescheidene Versuch, den ich in diesem Buch unternehme – Klarheit in die begrifflichen Zusammenhänge einer Debatte zu bringen, der viele das Potenzial zuschreiben, antiaufklärerischen und vernunftzersetzenden Tendenzen weiteren Auftrieb zu geben – durchaus zu einem Erkenntnisfortschritt führen kann und bei wohlwollenden Leserinnen und Lesern auch führen wird. Meine Arbeit richtet sich deshalb vor allem an jene, »die den Willen blicken lassen, daß die Wahrheit auszumitteln ihnen am Herzen liegt […] denn die, so nur ihr altes System vor Augen haben, und bei denen schon vorher beschlossen ist, was gebilligt oder mißbilligt werden soll, verlangen doch keine Erörterung, die ihrer Privatabsicht im Wege sein könnte« (KpV, 05: 9–10).
1. Einleitung: Kants rassistische Gesinnung
Wer sich in einer Universitätsbibliothek in den häufig etwas abgelegenen Bereich der Philosophie und hier zur Abteilung mit den historischen Klassikern verirrt, der wird vielleicht verwundert vor der massiv erscheinenden, in schwarzem Leder gebundenen Reihe der Schriften Kants stehen bleiben, vor allem dann, wenn er sich zuvor bereits mit diesem Denker beschäftigt und vielleicht sogar die eine oder andere Schrift gelesen hat. Offensichtlich nehmen die bekannten, veröffentlichten Schriften nur den kleinsten Teil der hier präsentierten Bände ein, und zwar ausschließlich die ersten neun Bände. Den weitaus größten Teil bilden die aus dem Nachlass Kants und aus zahlreichen Mitschriften seiner studentischen Zuhörer zusammengestellten Bände.
Neben den schon länger bekannten und umfangreichen Vorlesungen zur Metaphysik, in denen sich Kant vor allem mit den metaphysischen und kosmologischen Vorstellungen seiner Vorgänger beschäftigt hat und die Kant anhand des Lehrbuchs zur Metaphysik von Baumgarten gehalten hat, sowie seinen Vorlesungen zur Logik, die sich ebenfalls an Vorlagen aus der rationalistischen Schulphilosophie orientiert haben, hat Kant selbst auch zwei Vorlesungen entwickelt, die sich an ein weiteres Publikum richteten. Zunächst hat er ab dem Sommersemester 1756 über physische Geographie gelesen und ab dem Wintersemester 1772/73 über Anthropologie. Seitdem hielt er die beiden Vorlesungen abwechselnd in jedem Semester. Ein Grund für das Angebot der beiden Vorlesungen war auch, dass Kant dafür Hörergelder erhielt, denn als Privatdozent konnte er kein festes Einkommen beziehen. So trafen die in den Vorlesungen ausgebreiteten Themen den Nerv der Zeit und stießen bei Kants Zuhörern auf starkes Interesse. Man muss sagen: Die Vorlesungen erfreuten sich in Königsberg großer Beliebtheit. Kants Schüler Herder schwärmte von der Vorlesung über physische Geographie, und auch auf Herders philosophische Entwicklung dürfte diese einen nicht zu überschätzenden Einfluss gehabt haben. Kant selbst war sehr stolz auf diese Vorlesungen und hat sie in den folgenden Jahrzehnten immer wieder erweitert und modifiziert. In ihnen beschäftigte er sich mit der Natur des Menschen und seiner Stellung in der Welt, also Fragestellungen, die unmittelbar die sich entwickelnde intellektuelle Bewegung berührten, die sich später selbst als Aufklärung bezeichnen sollte.
In diesen Vorlesungen zeigt sich Kant von einer Seite, die zumindest auf den ersten Blick nicht den bekannten Vorurteilen über seine Philosophie zu entsprechen scheint. Wir entdecken einen Autor, der sich intensiv mit den aktuellen Fragestellungen seiner Zeit beschäftigt hat und darauf bedacht ist, einen möglichst umfassenden Gebrauch von empirischen Erkenntnissen zu machen. Dieser Autor richtet sich nicht an einen außerzeitlichen Gerichtshof der Vernunft oder sieht sich selbst in einer Reihe mit Platon, Locke, Hume und Leibniz, also Teil einer philosophischen Entwicklung, die zur Zeit der Abfassung der Kritik der reinen Vernunft in gewisser Hinsicht bereits als weit zurückliegende Vergangenheit erscheinen musste. Vielmehr sehen wir, dass sich Kant in den Vorlesungen für gegenwärtige Debatten begeisterte, an deren Entwicklung er lebhaft interessiert war und auch teilnehmen wollte. Kurzum, wir entdecken in ihnen eine ganz andere Seite an Kant, eine Seite, die mit den publizierten Schriften nicht immer leicht in Verbindung und noch weniger in Übereinstimmung gebracht werden kann.
Es ist auch aus diesen Gründen nicht verwunderlich, dass diese Schriften in der Forschung und auch in der öffentlichen Wahrnehmung bislang eine eher nebensächliche Rolle gespielt haben. Zwar sind noch zu Kants Lebzeiten zwei Bücher erschienen, die den Inhalt der Vorlesungen zusammenfassen, doch sind beide Schriften erst spät publiziert worden, und im Falle der Physischen Geographie sind die Umstände der Veröffentlichung verworren. Bei beiden Werken ist unklar, wie genau die Auswahl des Materials erfolgt ist.
Dass sich diese Schriften in den letzten Jahren immer mehr in die Öffentlichkeit gedrängt haben, hat mehrere Ursachen. Insgesamt hat das Interesse an dem historischen Umfeld, aus dem heraus die kantische Philosophie entstanden ist, zugenommen. Das hat aber auch den Fokus auf solche Themen verschoben, mit denen sich Kants Zeitgenossen beschäftigt haben. Vor allem die sich entwickelnde Anthropologie, also die Lehre vom Menschen, ist es, die speziell ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts an Bedeutung gewonnen hat. Einer der ersten, der auf die Relevanz der kantischen Anthropologie hingewiesen hat, war Michel Foucault. Er ist der Überzeugung, dass man in diesen Texten nicht nur einen anderen Kant entdecken kann, sondern dass sie möglicherweise als »geheimer Führer« (2008, 19) Kants späteres kritisches Projekt angeleitet haben und somit eine grundlegende Funktion in Kants Philosophie insgesamt einnehmen.
In letzter Zeit ist ein neuer Grund hinzugekommen, der das Interesse an diesen Schriften befeuert.1 Es sind vor allem Sätze wie die folgenden, die die Leserschaft in ihren Bann ziehen, erschrecken und große Aufregung verursachen:
»An den Negern in Afrika hingegen erblikt man, ob es gleich mit America fast unter einem Klima steht, eine große Empfindsamkeit oder läppisches Naturell, es fehlt ihnen an Standhaftigkeit und sie sind zu allem ungeschikt, was ihnen auferlegt wird. Kurz sie haben keinen eigentlichen Charakter.« (V-Anth / Collins, 25: 233)
»So zE. sind die Negers überhaupt sehr dumm, und in ganz Africa haben sie noch überdem ganz etwas Läppisches und Kindisches an sich. Sie sind zE. so plauderhaft, daß ob sie gleich den ganzen Tag gearbeitet, sie doch die ganze Nacht hindurch plaudern.
Und ob gleich manche von der Sclaverey los sind, und auch etwas besitzen, so hat man doch nie unter ihnen Männer wie unter andern Nationen gefunden, die sich irgend worin hervorgethan hätten. Die im äußern Norden scheinen den Negers in der Stupiditaet ziemlich gleich zu kommen, als zE. die Samoieden.« (V-PG / Hesse, 26/2: 116; 290)
»Der Schwarze ist zum Sclaven gemacht, und verdienet jederzeit einen Herren. Er befindet sich auch beßer, wenn der Weiße ihn regieret, als wenn er sich selbst regieret.« (V-PG / Hesse, 26/2: 122)
»Die Race der Neger, könnte man sagen, ist ganz das Gegentheil von den Amerikanern; sie sind voll Affect und Leidenschaft, sehr lebhaft, schwatzhaft und eitel. Sie nehmen Bildung an, aber nur eine Bildung der Knechte, d. h. sie lassen sich abrichten. Sie haben viele Triebfedern, sind auch empfindlich, fürchten sich vor Schlägen und thun auch viel aus Ehre.« (V-Anth / Mensch, 25: 1187)
»Dieser Albino hat dike Lippen und ist also kein Weißer, von der weißen Race. Sie dünsten auch sehr aus und stinken so sehr, als die Negers; dieser Gestank des Negers komt nicht von der Unreinigkeit her, denn sie laden sich offt aus, sondern weil sie in einem Lande wohnen, daß viele Ausdünstungen hat, weil es sehr waldig und Gewächßreich ist. Nun kann die Lunge des Negers die Menge der faulenden Parthien allein nicht herausbringen, daher dünsten sie auch durch ihre Haut aus.« (V-PG / Dönhoff, 26/2: 891)
Das ist nur eine kleine Auswahl solcher Aussagen, die bei heutigen Leserinnen und Lesern Kopfschütteln und moralische Empörung hervorrufen.
Als ob die angeführten Zitate nicht schon genug wären, kommt hinzu, dass sich Kant schon früh mit der Einteilung der Menschen in verschiedene Rassen befasst hat. Manch einer mag überrascht sein, dass Kant sich überhaupt mit dieser Thematik beschäftigt hat. So gehört die Rassentheorie nicht zu dem, was man gewöhnlich mit Kant verbindet. Umso erstaunlicher ist es zu erfahren, dass Kant mit seinen Vorstellungen über die menschlichen Rassen die erste wissenschaftliche Begründung für eine Rassenlehre geliefert zu haben scheint (Bernasconi 2001, 14–15). Wenn man nun davon ausgeht, dass die Einteilung in biologisch unterschiedliche Rassen den Grundstein für den modernen Rassismus und folglich auch für die aufgrund dieses Rassismus verübten Verbrechen gelegt hat, dann liegt es aus einer gewissen Perspektive nahe, Kant als eine Art Übervater des modernen Rassismus zu betrachten (Hund 2011, 71). Kants Ausführungen zur Einteilung der Menschen in verschiedene Rassen werden auch deshalb als problematisch angesehen, weil er nicht nur diese Rassen unterschieden hat, sondern ihnen, vor allem in den Vorlesungen, auch unterschiedliche intellektuelle Begabungen oder andere Stärken und Schwächen zugesprochen hat.
Angesichts dieser nach heutigen Maßstäben eindeutig diskriminierenden und nach unseren Moralvorstellungen zweifellos beleidigenden Äußerungen Kants stellt sich die Frage: Wie kann derselbe Kant, der hochgeschätzte Vertreter der Aufklärung, bekannt für seine universelle Moralkonzeption, der für den kategorischen Imperativ steht und bis heute für die unantastbare Würde des Menschen verehrt wird, auf den die Begründung der Menschenrechte zurückgeht, wie kann dieser Kant sich und seine Philosophie mit rassistischen Äußerungen beflecken? Liefern die obigen Textbeispiele nicht einen eindeutigen Beweis für eine zutiefst rassistische Gesinnung Kants (Mikkelsen 2013, 3)?
1.1 Hat Kant eine rassistische Gesinnung? (K)eine Frage der Kantphilologie
Auch wenn die zitierten Äußerungen Kants erst in jüngster Zeit die Gemüter erregt haben, sind sie doch in der Kantforschung seit langem bekannt. Dennoch hat sich gerade in der deutschen Kantforschung sehr lange kaum jemand dafür interessiert. Das liegt freilich nicht daran, dass Rassismus in Deutschland eine salonfähige Haltung wäre. Der Grund ist vielmehr woanders zu suchen, nämlich in der philologischen Bewertung dieser Aussagen. Was meine ich damit?
Grundsätzlich gilt, dass Kants angeblich rassistische Haltung aus zahlreichen, nur verstreut vorhandenen Aussagen rekonstruiert werden muss. Einer der ersten Interpreten in Deutschland, der sich mit dieser Frage beschäftigt hat, macht kein Geheimnis daraus, dass er »wie ein Lumpensammler weit verstreute und teilweise entlegene Äußerungen zusammentragen und chronologisch bündeln« musste (Sutter 1989, 242). Die Begründung dafür liefert Sutter gleich mit: Kant hat sich mit diesen Fragen, wenn überhaupt, nur am Rande beschäftigt. Sie stehen also nicht im Zentrum der kantischen Philosophie. Außerhalb der Vorlesungsmitschriften haben wir es oft nur mit beiläufigen Bemerkungen zu tun, die, wie im Falle der Schriften zur Rassentheorie, in Fußnoten oder als Anmerkungen zur Argumentation auftauchen und in denen sich Kant kritisch mit anderen Autoren auseinandersetzt oder deren Annahmen aufgreift. Es gibt also kein einheitliches systematisches Werk, nicht einmal eine zusammenhängende Darstellung, die die als rassistisch empfundenen Äußerungen in Kants philosophische Systematik einordnet. Letzteres wird somit zur Aufgabe der Interpreten der kantischen Philosophie. Es handelt sich dabei allerdings um keine leichte Aufgabe: Gefordert sind nicht nur umfassende historische Kenntnisse, sondern auch Kant-philologische Kompetenz und systematisch-philosophischer Scharfsinn. Gerade die philologischen und systematischen Anforderungen spielen in dieser Debatte eine wichtige Rolle. Problematisch ist nun, dass vor allem die frühen Kritiker der kantischen Position gerade keine Kant-Experten waren, wie sie auch freimütig zugegeben haben (Bernasconi 2003, 14). Dies hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Vorwürfe innerhalb der Kantforschung und unter den etablierten Kantforschern zunächst wenig Beachtung fanden und eher ungehört verhallten. Sehr schnell war die Replik zur Hand, dass philologisch unsauber vorgegangen und der systematische Ort der problematischen Aussagen nicht richtig verstanden worden sei.
Ich möchte dies anhand der oben zitierten Stellen erläutern. Wie gesagt, die meisten und auch die schockierendsten Belege für Kants Rassismus stammen aus den beiden Vorlesungsmitschriften zur physischen Geographie und zur Anthropologie. In der Kantforschung haben diese Vorlesungsmitschriften einen eher zweifelhaften Status. Denn es handelt sich hierbei um Schriften, die nicht von Kant selbst verfasst und von ihm auch nicht als Teil seines Werkes betrachtet wurden. Wir haben es also weitgehend mit Material zu tun, das Kant selbst nicht ausgearbeitet und auch nicht zur Publikation vorgesehen hatte. Als Kontrast sei hier an Heidegger erinnert, der ausdrücklich auch die Veröffentlichung von Vorlesungsnotizen oder unausgearbeiteten Gedankenbüchern in seinem Nachlass vorgesehen hat. Zwar gibt es auch bei Kant einige Notizen oder Überlegungen, die er auf durchschossenen Seiten in den zugrunde liegenden Lehrbüchern vermerkt hat. Viele Texte, vor allem die für unsere Fragestellung wichtigen, sind jedoch nur in den Mitschriften der Hörer überliefert. Einige dieser Mitschriften sind auf abenteuerliche Weise überliefert und entdeckt worden. Ihre Entdeckung ist zweifellos ein großer Gewinn für die Kantforschung, handelt es sich doch um eine wertvolle Quelle, um sich ein Bild von Kants Vorlesungstätigkeit zu machen. Allerdings, und das müssen auch Nicht-Experten der Kantphilologie einräumen, können diese Mitschriften nur mit Einschränkungen zur Dokumentation von Kants philosophischen Positionen oder dessen Gesinnung herangezogen werden.
Natürlich kann man davon ausgehen, dass Kant Gedanken, die ihn tatsächlich beschäftigten, in seine Vorlesungen einfließen ließ, sodass sich im Einzelfall auch in den Vorlesungsmitschriften wichtige Impulse für die argumentative Rekonstruktion der philosophischen Entwicklung Kants finden lassen. Aber, und das entspricht nun auch dem vorherrschenden Eindruck, den die meisten, wie ich oben angedeutet habe, von diesen Texten haben, man begegnet in diesen Vorlesungen oft auch einem ganz anderen Kant. Unter der Voraussetzung, dass die Mitschriften zuverlässig sind und den Wortlaut der Vorlesungen einigermaßen getreu wiedergeben, tritt uns hier ein Kant entgegen, der lebhaft und spritzig mit den Ansichten seiner philosophischen Vorgänger umgeht, sie in sachlich umfassende Gedankenzusammenhänge stellt und schließlich mit scharfsinnigen Argumenten zu widerlegen weiß. Implizit sind damit aber auch schon einige der Hauptschwierigkeiten benannt. Erstens ist davon auszugehen, dass nicht alle Transkriptionen von gleicher Qualität sind. Diese hängt natürlich stark von der Kompetenz der mitschreibenden Zuhörer ab. Argumente oder gedankliche Schlussfolgerungen Kants, die von den Zuhörern nicht vollständig verstanden wurden, sind auch nicht in nachvollziehbarer Form überliefert. Es ist nicht auszuschließen, dass aus dem überlieferten Material eine Auswahl getroffen wurde, die dem Interesse der Studenten entsprach. Einen guten Eindruck vermitteln in dieser Hinsicht die Mitschriften, die von verschiedenen Studenten zur gleichen Vorlesung angefertigt wurden. Auch wenn im Großen und Ganzen der gleiche Plan bzw. Aufbau wiedergegeben wird und oft auch die gleichen Formulierungen zu finden sind, weichen die Mitschriften im Detail doch erheblich voneinander ab.
Eine weitere allgemeine Besonderheit der Vorlesungen besteht, wie gesagt, darin, dass Kant sie häufig auf der Grundlage eines Lehrbuchs verfasst hat. Dies gilt insbesondere für die Vorlesungen zur Metaphysik, zur Logik und zur Rechtsphilosophie. Das bedeutet, dass Kant in den Vorlesungen nicht unbedingt eigene Gedanken präsentiert, sondern weitgehend die Position der im Lehrbuch vertretenen Ansichten wiedergegeben hat. Auch die kritischen Anmerkungen, mit denen Kant sich von den vorgestellten Positionen zu distanzieren scheint und die von den Hörern aufgezeichnet wurden, müssen nicht Kants eigene Ansichten wiedergeben. Die besondere Lehrsituation kann dazu geführt haben, dass Kant, etwa um die Studenten zum Nachdenken anzuregen, Positionen zugespitzt oder bewusst eine übertrieben skeptische Haltung eingenommen hat oder sogar etwas dargestellt hat, was er an anderer Stelle explizit abgelehnt hat. Besonders deutlich wird dies in den Fällen, in denen sich Kant mit solchen Positionen auseinandersetzt, die in den herangezogenen Lehrbüchern zitiert werden, die er aber auch in seinen publizierten Schriften behandelt hat und die in klarem Widerspruch zu diesen veröffentlichten Texten stehen.
Immer dann, wenn wir sowohl die Lehrbücher, die die Grundlage für Kants Vorlesungen bildeten, als auch Kants publizierte philosophische Position kennen, können wir die Kommentare, die die Studenten aufgezeichnet haben, sehr gut einschätzen und sie als kritische Einwände oder als Zustimmung zu den referierenden Autoren oder als kritische Korrekturen etc. einordnen. Genau das ist aber bei den erwähnten Vorlesungen über physische Geographie und Anthropologie nicht der Fall. Bei diesen beiden Vorlesungen handelt es sich um Neuerungen Kants. Die Vorlesung wird also nicht auf der Grundlage eines verbreiteten Lehrbuchs gehalten, wie dies für die Vorlesung über Metaphysik gilt, für die Kant das Metaphysik-Lehrbuch von Baumgarten verwendet hat. Das bedeutet aber auch, dass sich nur mit philologischem Scharfsinn die von Kant in die Vorlesung häufig unkommentiert übernommenen Berichte von Kants eigenen Kommentaren hierzu trennen lassen.
Das gilt auch für die beiden unter dem Titel der Vorlesungen veröffentlichten Bücher, die zu Kants Lebzeiten erschienen sind und eine Textauswahl aus den Vorlesungen liefern, und zwar einmal unter dem Titel der Physischen Geographie sowie der Anthropologie in pragmatischer Absicht. Die Anthropologie, die in Band sieben der Akademie-Ausgabe vorliegt, erschien 1797, ein Jahr nachdem Kant seine Lehrtätigkeit an der Universität Königsberg beendet hatte. Die Physische Geographie, Band neun, erschien vier Jahre später und wurde 1801 und noch einmal 1802 von zwei unterschiedlichen Verlegern, Vollmer und Rink, in zwei verschiedenen Auflagen herausgegeben. Inwieweit Kant selbst an der Vorbereitung und Auswahl des zu veröffentlichenden Materials beteiligt war, ist fraglich und wird in der Kantphilologie kontrovers diskutiert. Fest steht, dass sowohl die Anthropologie als auch die Physische Geographie auf dem Material beruhen, das Kant für seine gleichnamigen Vorlesungen verwendet hat. Wir haben es hier also in gewissem Sinne tatsächlich mit Kants eigenen Schriften zu tun und müssen uns also nicht auf die Erkenntniskraft und die Interessen studentischer Schreiber verlassen. Dennoch gibt es zahlreiche Unklarheiten, die im Umgang mit diesen Werken zu beachten sind. So muss man wissen, dass beide Schriften auch Material enthalten, das nicht von Kant selbst stammt, sondern das er über viele Jahre gesammelt und in seinen Vorlesungen verwendet hat. Aus diesem Grund wird die Originalquelle nicht immer sorgfältig angegeben. Das gilt insbesondere für die umstrittene Physische Geographie. Vielleicht hat Kant dies ursprünglich getan, und die Belege sind über die Jahre verloren gegangen, oder die Herausgeber haben sie übersehen oder nicht aufgenommen. Das lässt sich nicht mehr klären. Jedenfalls hat die Kantphilologie viel Mühe darauf verwendet, die Textzeugnisse zu rekonstruieren. Ein sehr schönes Beispiel für die besonderen Schwierigkeiten hat der Kantforscher Michael Wolff geliefert, der mit vorbildlicher philologischer Präzision nachgewiesen hat, dass eines der wichtigsten Zitate, mit dem immer wieder die Existenz der rassistischen Gesinnung belegt werden soll, eben nicht von Kant selbst stammt.2
Um die Fragwürdigkeit der in den Vorlesungen verwendeten Materialien zu belegen, bedarf es nicht einmal des Urteils der philologisch versierten Kantforschung. Wir können das Kant selbst überlassen. In einer Rezension zu Herders geschichtsphilosophischer Schrift, auf die wir später noch etwas ausführlicher zu sprechen kommen werden, merkt Kant über die Verlässlichkeit der Berichte an, die er selbst in seinen Vorlesungen verwendet:
»Eines hätte Recensent sowohl unserm Verf. als jedem andern philosophischen Unternehmer einer allgemeinen Naturgeschichte des Menschen gewünscht: nämlich daß ein historisch-kritischer Kopf ihnen insgesammt vorgearbeitet hätte, der aus der unermeßlichen Menge von Völkerbeschreibungen oder Reiseerzählungen und allen ihren muthmaßlich zur menschlichen Natur gehörigen Nachrichten vornehmlich diejenigen ausgehoben hätte, darin sie einander widersprechen, und sie (doch mit beigefügten Erinnerungen wegen der Glaubwürdigkeit jedes Erzählers) neben einander gestellt hätte; denn so würde niemand sich so dreist auf einseitige Nachrichten fußen, ohne vorher die Berichte anderer genau abgewogen zu haben. Jetzt aber kann man aus einer Menge von Länderbeschreibungen, wenn man will, beweisen, daß Amerikaner, Tibetaner und andere ächte mongolische Völker keinen Bart haben, aber auch, wem es besser gefällt, daß sie insgesammt von Natur bärtig sind und sich diesen nur ausrupfen; daß Amerikaner und Neger eine in Geistesanlagen unter die übrigen Glieder der Menschengattung gesunkene Race sind, andererseits aber nach eben so scheinbaren Nachrichten, daß sie hierin, was ihre Naturanlage betrifft, jedem andern Weltbewohner gleich zu schätzen sind, mithin dem Philosophen die Wahl bleibe, ob er Naturverschiedenheiten annehmen, oder alles nach dem Grundsatze tout comme chez nous beurtheilen will, dadurch denn alle seine über eine so wankende Grundlage errichtete Systeme den Anschein baufälliger Hypothesen bekommen müssen.« (RezHerder 08: 61–62)
Als Kant diese Zeilen schrieb, um seinem ehemaligen Schüler die Naivität seiner Quellenwahl vor Augen zu führen, war er sich sicher bewusst, dass derselbe Vorwurf auch gegen ihn selbst erhoben werden könnte, denn schließlich beruht ein großer Teil der Vorlesungsmitschriften auf eben diesem Material. Das erklärt auch, warum neben all den schockierenden Bemerkungen über die Bewohner anderer Kontinente die unglaublichsten Absurditäten in diesen Vorlesungsmitschriften zu finden sind. Diese werden freilich selten in diesem Zusammenhang zitiert, obwohl sie sich oft in unmittelbarer Nähe der Stellen finden, die als Beleg für Kants rassistische Gesinnung angeführt werden. In einer Vorlesungsmitschrift zur physischen Geographie (Ms Hesse 1770) erklärt Kant, nachdem er den Begriff der Menschenrasse eingeführt hat, warum die Deutschen in ihrer körperlichen Kraft anderen Nationen überlegen sind: »Die Deutschen macht das Bier so starck« (26.3/2.1): 109). Ein Gedanke, über den man noch schmunzeln kann und der seinen Charakter als vermeintliches Allgemeingut rasch offenbart. Sonderbarer erscheint jedoch die darauf folgende Erklärung Kants über die in Äthiopien (»Abyßinien«) geborenen Kinder: »Sie werden alle weiß, doch mit einem schwarzen Ringe um den Nabel geboren, der sich nach zwey Monathen über den ganzen Leib ausbreitet.« (26.3/2.1: 111) Werner Starck, der Herausgeber der Schrift, klärt in einer Anmerkung auf, dass Kant dies von Buffon übernommen hat. Einfach nur kurios ist hingegen, wenn Kant von den Frauen in Äthiopien berichtet, die mit einer »natürliche[n] Schürze, welche sie sich aber wegschneiden oder wegbrennen«, geboren werden (26.3/2.1: 115) oder dass in England ein menschliches Stachelschwein Kinder gezeugt habe, die ebenfalls mit Stacheln bedeckt waren.
Hinzu kommt, dass Kant sich in diesen Texten – genau wie er es in der Rezension gegen Herder anmerkt – immer wieder selbst widerspricht; so werden dieselben Akteure einmal als feige bezeichnet, nur um wenige Zeilen später oder im darauffolgenden Jahr als tapfer charakterisiert zu werden. Das macht deutlich, dass auch Kant seine Quellen nicht kritisch geprüft hat; allerdings, und das ist das Verdienst der modernen Editionen, haben die Herausgeber diese Bezüge oft nachgetragen, und wenn nicht, dann muss man davon ausgehen, dass Kant eine Quelle benutzt hat, die uns noch nicht bekannt ist. Dass sich Kant dennoch gegen Herder kritisch wendet und ihm vorwirft, Berichte dieser Art ungeprüft übernommen zu haben, ist insofern gerechtfertigt, als Kant diese Aufzeichnungen nicht zu seinem Hauptwerk ausgearbeitet, ja nicht einmal selbst veröffentlicht hat.
Neben dem zugegebenermaßen problematischen Umgang mit den Vorlesungsmitschriften gibt es eine weitere wichtige Kant-philologische Unterscheidung, die bei der Auseinandersetzung mit Kants Philosophie insgesamt unbedingt zu beachten ist. So wird die Entwicklung der kantischen Philosophie üblicherweise in zwei große historische Perioden eingeteilt: zum einen die sogenannten vorkritischen Schriften, das heißt alle Texte, die vor dem Erscheinen der Kritik der reinen Vernunft im Jahre 1781 entstanden sind, zum anderen das kritische Werk und damit die Schriften, die nach der ersten Kritik bis zu Kants Tod erschienen sind. Nach diesem Verständnis haben die in der vorkritischen Phase entstandenen Schriften nicht den gleichen systematischen Stellenwert wie die nach der eigentlichen kritischen Wende publizierten Texte. Dies ist vor allem im Hinblick auf eine Schrift von Bedeutung, die von zahlreichen Kritikern als Beleg für die rassistische Gesinnung herangezogen wird. Es handelt sich dabei um die in der Kantforschung eher als randständig betrachtete Schrift Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen von 1764. Dieser Text enthält einige der häufig als Beleg für Kants rassistische Gesinnung angeführten Bemerkungen über die Natur der Afrikaner: »Die Negers von Afrika haben von der Natur kein Gefühl, welches über das Läppische stiege« (GSE, 02: 253). Übernommen hat Kant, worauf er selbst hinweist, diese Einschätzung von David Hume:
»Herr Hume fordert jedermann auf, ein einziges Beispiel anzuführen, da ein Neger Talente gewiesen habe, und behauptet: daß unter den hunderttausenden von Schwarzen, die aus ihren Ländern anderwärts verführt werden, obgleich deren sehr viele auch in Freiheit gesetzt werden, dennoch nicht ein einziger jemals gefunden worden, der entweder in Kunst oder Wissenschaft, oder irgend einer andern rühmlichen Eigenschaft etwas Großes vorgestellt habe, obgleich unter den Weißen sich beständig welche aus dem niedrigsten Pöbel empor schwingen und durch vorzügliche Gaben in der Welt ein Ansehen erwerben.« (GSE, 02: 253)
Freilich kann man Kant den Vorwurf machen, dass er sich von dem Namen Humes und seiner Bedeutung für die Philosophie in der ersten Hälfte der 1760er Jahre wohl zu sehr hat einschüchtern lassen, um nicht schon hier eine kritische Auseinandersetzung mit Hume zu führen, wie er es dann fast zwanzig Jahre später in der Kritik der reinen Vernunft getan hat, wenn auch dort an einem anderen Gegenstand. Aber genau das ist der Punkt, der in der Kantphilologie hervorgehoben wird. Wir haben es hier mit einer relativ frühen Schrift Kants zu tun, die, wie gesagt, in die vorkritische Phase seines Denkens fällt. Vorkritisch bedeutet aber auch, dass Kant in diesen Schriften noch nicht zu seiner kritischen Position gefunden hat, weshalb diese Schriften nur bedingt als Belege für die kritische Haltung Kants dienen können.
Gerade dieser Punkt kommt der zweiten von der Kantforschung gewählten Verteidigungsstrategie zugute. Denn genau um diese Entwicklung im Denken Kants geht es.
1.2 Ein Gesinnungswandel?
Vor allem eine Erzählung wurde in den letzten Jahren als Möglichkeit angeboten, mit den rassistischen Aussagen in Kants Philosophie umzugehen. So soll Kant selbst im Laufe seiner philosophischen Entwicklung seine Meinung zu diesem Thema geändert haben. Das bedeutet, dass Kant mit rassistischen Einstellungen zu philosophieren begann und erst nach der Veröffentlichung seiner großen kritischen Werke zur praktischen Philosophie langsam erkannte, dass diese rassistischen Ansichten letztlich seiner philosophischen Grundhaltung widersprechen. Aus diesem Grund distanzierte sich Kant in seinen späteren Schriften auch von diesen frühen Meinungen (Kleingeld 2007; Allais 2016)