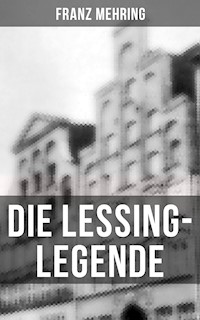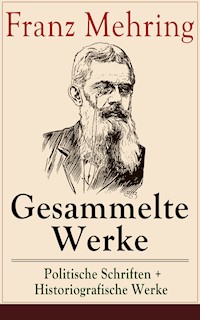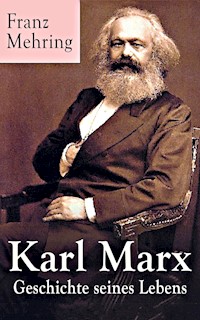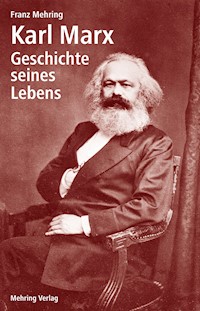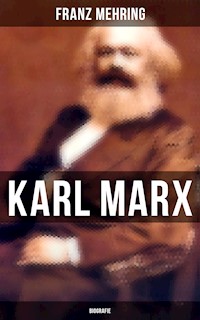
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In seiner Biografie 'Karl Marx' zeigt Franz Mehring eine tiefgründige und facettenreiche Darstellung des Lebens und Werkes des berühmten Philosophen und Ökonomen. Der Autor taucht tief in Marx' Ideen ein, von seiner Jugend in Preußen bis zu seiner Einflussnahme auf die sozialistische Bewegung des 19. Jahrhunderts. Mehrings schriftstellerischer Stil ist präzise und informativ, und er bietet dem Leser einen faszinierenden Einblick in die Entwicklung von Marx' philosophischem Denken und politischem Wirken. Das Buch hebt sich durch seine historische Genauigkeit und literarische Tiefe im Genre der Biografie hervor, und zeigt Mehrings umfangreiche Kenntnisse der marxistischen Ideologie und des historischen Kontexts, in dem Marx lebte. Franz Mehrings 'Karl Marx: Biografie' ist somit nicht nur eine Biografie, sondern auch eine wichtige philosophische Abhandlung über einen der einflussreichsten Denker der modernen Geschichte. Der Autor, Franz Mehring, war selbst ein renommierter deutscher Theoretiker und Historiker und hatte eine enge Verbindung zur marxistischen Bewegung. Seine profunde Kenntnis des politischen und intellektuellen Umfelds, in dem Marx agierte, spiegelt sich in diesem Werk wider. Durch Mehrings penible Recherche und analytische Herangehensweise bietet 'Karl Marx: Biografie' dem Leser einen tiefen Einblick in das Leben eines der wichtigsten Denker des 19. Jahrhunderts. Diese Biografie ist ein Muss für jeden, der an politischer Philosophie, Sozialgeschichte und marxistischen Ideen interessiert ist. Mit eloquenter Prosa und akribischer Recherche empfiehlt sich dieses Buch als unverzichtbare Lektüre für alle, die einen tieferen Einblick in das Leben und Werk von Karl Marx gewinnen möchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Karl Marx: Biografie
Books
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Dies Buch hat seine kleine Geschichte. Als es sich darum handelte, den Briefwechsel zwischen Marx und Engels herauszugeben, machte Frau Laura Lafargue ihre Zustimmung, soweit sie notwendig war, davon abhängig, daß ich als ihr Vertrauensmann an der Redaktion teilnähme; in einer, aus Draveil vom 10. November 1910 datierten Vollmacht beauftragte sie mich, die Bemerkungen, Erläuterungen und Streichungen vorzunehmen, die ich für unerläßlich hielte.
Von dieser Vollmacht habe ich jedoch keinen praktischen Gebrauch gemacht. Zwischen den Herausgebern oder vielmehr dem Herausgeber Bernstein - denn Bebel gab nur den Namen dazu her - und mir ergaben sich keine wesentlichen Meinungsverschiedenheiten, und ihm ohne zwingenden oder mindestens dringenden Grund ins Handwerk zu pfuschen, hatte ich, im Sinne meiner Auftraggeberin, keinen Anlaß, kein Recht und selbstverständlich auch keine Neigung.
Dagegen rundete sich mir in der langen Arbeit an diesem Briefwechsel das Bild ab, das ich aus jahrzehntelangen Studien von Karl Marx gewonnen hatte, und so erwuchs mir unwillkürlich der Wunsch, diesem Bilde einen biographischen Rahmen zu geben, zumal da ich wußte, daß Frau Lafargue daran ihre große Freude haben würde. Ich hatte mir ihre Freundschaft und ihr Vertrauen erworben, nicht etwa weil sie mich unter den Schülern ihres Vaters für den gelehrtesten oder scharfsinnigsten, sondern nur für denjenigen hielt, der in sein menschliches Wesen am tiefsten eingedrungen sei und es am treffendsten darzustellen wisse. Brieflich wie mündlich hat sie mir oft versichert, wie so manche halbverklungene Erinnerung aus ihrem elterlichen Hause durch die Schilderung in meiner Parteigeschichte und namentlich in meiner Nachlaßausgabe ihr wieder frisch und lebendig, wie mancher, von ihren Eltern oft gehörter Name ihr erst durch mich aus einem bloßen Schatten zu einer greifbaren Gestalt geworden sei.
Leider starb die edle Frau, lange ehe der Briefwechsel ihres Vaters mit Engels herausgegeben werden konnte. Wenige Stunden, ehe sie in den Freitod ging, sandte sie mir noch ein herzliches Wort des Grußes. Sie hatte den großen Sinn ihres Vaters geerbt, und ich danke es ihr noch im Grabe, daß sie mir manchen Schatz aus seinem Nachlaß zur Herausgabe anvertraut hat, ohne auch nur den leisesten Versuch, mein kritisches Urteil darüber zu beeinflussen. So erhielt ich von ihr die Briefe Lassalles an ihren Vater, obgleich sie aus meiner Parteigeschichte wußte, wie entschieden und wie oft ich das Recht Lassalles gegen ihren Vater vertreten hatte. Nicht ein Äderchen von dem Wesen dieser großherzigen Frau verrieten dagegen zwei Zionswächter des Marxismus, die, als ich nunmehr zur Ausführung meines biographischen Vorhabens schritt, in das Horn der sittlichen Entrüstung stießen, weil ich in der »Neuen Zeit« einige Bemerkungen über Lassalles und Bakunins Beziehungen zu Marx geäußert hatte, ohne dabei den gebührenden Kotau vor der offiziellen Parteilegende zu machen. Zuerst zieh mich K. Kautsky der »Marxfeindschaft« im allgemeinen und eines angeblich an Frau Lafargue begangenen Vertrauensbruchs« im besonderen, und als ich gleichwohl auf meiner Absicht beharrte, die Biographie von Marx zu schreiben, opferte er von dem bekanntlich sehr kostbaren Raum der »Neuen Zeit« nicht weniger als einige sechzig Seiten einem Pamphlet, worin mich N. Rjasanow - unter einer Flut von Beschuldigungen, deren Gewissenlosigkeit etwa auf gleicher Höhe mit ihrer Sinnlosigkeit stand - des schnödesten Verrats an Marx überführen wollte. Ich habe diesen Leuten das letzte Wort gegönnt, aus einer Empfindung heraus, die ich aus Gründen der Höflichkeit nicht beim richtigen Namen nennen will, schulde aber mir selbst festzustellen, daß ich ihrem Gesinnungsterrorismus nicht um Haaresbreite nachgegeben, sondern auf den nachfolgenden Blättern die Beziehungen Lassalles und Bakunins zu Marx, unter gänzlicher Mißachtung der Parteilegende, nach den Geboten der geschichtlichen Wahrheit dargestellt habe. Natürlich habe ich dabei wieder von jeder Polemik abgesehen, jedoch in den Anmerkungen einige Hauptanklagen der Kautsky und Rjasanow gegen mich ein wenig niedriger gehängt, zu Nutz und Frommen jüngerer Arbeiter auf diesem Gebiet, denen das Gefühl absoluter Wurstigkeit gegen die Anfälle des Marxpfaffentums nicht früh genug eingeimpft werden kann. Wäre Marx in der Tat der langweilige Musterknabe gewesen, den die Marxpfaffen in ihm bewundern, so hätte es mich nie gereizt, seine Biographie zu schreiben. Meine Bewunderung wie meine Kritik - und zu einer guten Biographie gehört die eine wie die andere in gleichem Maße - gilt dem großen Menschen, der nichts häufiger und nichts lieber von sich bekannte, als daß ihm nichts Menschliches fremd sei. Ihn in seiner mächtig-rauhen Größe nachzuschaffen, war die Aufgabe, die ich mir gestellt hatte.
Das Ziel bestimmte dann auch schon den Weg zum Ziele. Alle Geschichtsschreibung ist zugleich Kunst und Wissenschaft, und zumal die biographische Darstellung. Ich weiß im Augenblick nicht, welcher trockene Hecht den famosen Gedanken geboren hat, daß ästhetische Gesichtspunkte in den Hallen der historischen Wissenschaft nichts zu suchen hätten. Aber ich muß, vielleicht zu meiner Schande, offen gestehen, daß ich die bürgerliche Gesellschaft nicht so gründlich hasse wie jene strengeren Denker, die, um dem guten Voltaire eins auszuwischen, die langweilige Schreibweise für die einzig erlaubte erklären. Marx selbst war in diesem Punkte auch des Verdachts verdächtig: mit seinen alten Griechen rechnete er Klio zu den neun Musen. In der Tat, die Musen schmäht nur, wer von ihnen verschmäht worden ist.
Wenn ich danach die Zustimmung des Lesers zu der von mir gewählten Form voraussetzen darf, so muß ich um so mehr einige Nachsicht für den Inhalt erbitten. Ich stand hier von vornherein einer unerbittlichen Notwendigkeit gegenüber: der Notwendigkeit, den Band nicht zu sehr anschwellen zu lassen, wenn er, selbst für vorgeschrittene Arbeiter, noch erreichbar und verständlich bleiben sollte; ohnehin hat er schon das Anderthalbfache des ursprünglich geplanten Umfangs erreicht. Wie oft mußte ich mich mit einem Worte begnügen, wo ich lieber eine Zeile, mit einer Zeile, wo ich lieber eine Seite, mit einer Seite, wo ich lieber einen Bogen geschrieben hätte! Besonders hat unter diesem äußeren Zwange die Analyse der wissenschaftlichen Schriften von Marx gelitten. Um darüber von vornherein keinen Zweifel zu lassen, habe ich den, bei der Biographie eines großen Schriftstellers herkömmlichen Untertitel: Geschichte seines Lebens und seiner Schriften, um die zweite Hälfte gekürzt.
Sicherlich beruht die unvergleichliche Größe von Marx nicht zuletzt darin, daß in ihm der Mann des Gedankens und der Mann der Tat unzertrennlich verbunden waren, daß sie sich gegenseitig ergänzten und unterstützten. Aber es ist doch nicht minder sicher, daß der Kämpfer in ihm allemal den Vortritt nahm vor dem Denker. Sie dachten darin alle gleich, unsere großen Bahnbrecher, wie Lassalle es einmal ausgedrückt hat: wie gerne wolle er ungeschrieben lassen, was er wisse, wenn nur endlich einmal die Stunde praktischen Handelns schlüge. Und wie recht sie damit hatten, haben wir schaudernd in unseren Zeitläuften erlebt, wo ernste Forscher, die drei oder sogar vier Jahrzehnte über jedem Komma in Marxens Werken gebrütet hatten, sich in einer geschichtlichen Stunde, wo sie einmal wie Marx handeln konnten und sollten, sich doch nur wie trillernde Wetterhähne um sich selbst zu drehen wußten.
Verhehlen will ich deshalb aber doch nicht, daß ich mich nicht vor anderen berufen gefühlt hätte, alle Grenzen des ungeheuren Wissensgebiets zu umschreiten, das Marx beherrscht hat. Schon für die Aufgabe, im engen Rahmen meiner Darstellung ein durchsichtig klares Bild vom zweiten und dritten Bande des »Kapitals« zu geben, habe ich die Hilfe meiner Freundin Rosa Luxemburg angerufen. Die Leser werden es ihr ebenso danken wie ich selbst, daß sie meinem Wunsche bereitwillig entsprochen hat; der dritte Abschnitt des zwölften Kapitels ist von ihr verfaßt worden.
Es macht mich glücklich, dieser Schrift ein Schmuckstück ihrer Feder einzuverleiben, wie es mich nicht minder glücklich macht, daß unsere gemeinsame Freundin Clara Zetkin-Zundel mir gestattet hat, mein Schifflein unter ihrem Wimpel auf die hohe See zu senden. Die Freundschaft dieser Frauen ist mir ein unschätzbarer Trost gewesen, in einer Zeit, in deren Stürmen so viele »mannhafte und unentwegte Vorkämpfer« des Sozialismus davongewirbelt sind wie dürre Blätter im Herbstwind.
Steglitz-Berlin, im März 1918
FRANZ MEHRING
Erstes Kapitel: Junge Jahre
1. Haus und Schule
Karl Heinrich Marx wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren. Über seine Abstammung ist wenig bekannt, dank der Verwirrung und Verwüstung, die die kriegerischen Zeitläufte um die Wende des Jahrhunderts in den rheinischen Standesregistern angerichtet haben. Wird doch heute noch um das Geburtsjahr Heinrich Heines gestritten!
Ganz so schlimm steht es nun freilich mit Karl Marx nicht, der in ruhigeren Zeiten geboren wurde. Aber als vor fünfzig Jahren eine Schwester seines Vaters gestorben war, mit Hinterlassung eines ungültigen Testaments, gelang es allen gerichtlichen Nachforschungen nach den Intestaterben doch nicht mehr, die Geburts- und Todestage ihrer Eltern festzustellen, also der Großeltern von Karl Marx. Der Großvater hieß Marx Levi, nannte sich später aber nur Marx und war Rabbiner in Trier; er soll 1798 gestorben sein und war 1810 jedenfalls nicht mehr am Leben. Seine Ehefrau Eva, geborene Moses, war 1810 noch am Leben und soll 1825 gestorben sein.
Von den zahlreichen Kindern dieses Paares widmeten sich zwei gelehrten Berufen: Samuel und Hirschel. Samuel wurde als Rabbiner in Trier der Nachfolger seines Vaters, während sein Sohn Moses als Rabbinatskandidat nach Gleiwitz in Schlesien verschlagen wurde. Samuel war 1781 geboren und starb 1829. Hirschel, der Vater von Karl Marx, war 1782 geboren. Er wandte sich der Jurisprudenz zu, wurde Advokatanwalt und später Justizrat in Trier, ließ sich 1824 als Heinrich Marx taufen und starb 1838. Er war mit Henriette Preßburg verheiratet, einer holländischen Jüdin, deren Ahnen nach Angabe ihrer Enkelin Eleanor Marx eine jahrhundertlange Reihe von Rabbinern aufweisen. Sie starb 1863. Beide hinterließen ebenfalls eine zahlreiche Familie, doch lebten zur Zeit jener Erbschaftsregulierung, deren Akten diese genealogischen Notizen verdankt sind, nur noch vier von ihren Kindern: Karl Marx und drei Töchter, Sophie als Witwe des Anwalts Schmalhausen in Maastricht, Emilie als Ehefrau des Ingenieurs Conrady in Trier und Luise als Ehefrau des Kaufmanns Juta in der Kapstadt.
Seinen Eltern, deren Ehe überaus glücklich war, verdankte Karl Marx, nächst der Schwester Sophie ihr ältestes Kind, eine heitere und sorgenfreie Jugend. Wenn seine »herrlichen Naturgaben« in dem Vater die Hoffnung weckten, daß sie dereinst zum Wohle der Menschheit dienen würden, so hieß ihn die Mutter ein Glückskind, dem alles wohl unter den Händen gerate. Doch ist Karl Marx weder, wie Goethe, der Sohn seiner Mutter, noch, wie Lessing und Schiller, der Sohn seines Vaters gewesen. Die Mutter ging, bei all ihrer zärtlichen Sorge für ihren Gatten und ihre Kinder, ganz in dem Frieden des Hauses auf; sie hat all ihr Lebtag nur ein mangelhaftes Deutsch gesprochen und an den geistigen Kämpfen ihres Sohnes keinen Anteil genommen, es sei denn mit der mütterlichen Bekümmernis, was aus ihrem Karl wohl hätte werden können, wenn er den rechten Weg eingeschlagen hätte. In späteren Jahren scheint Karl Marx seinen mütterlichen Verwandten in Holland näher gestanden zu haben, namentlich einem »Onkel« Philips; er spricht von diesem »famosen alten Jungen«, der sich ihm auch in den Nöten des Lebens hilfreich erwies, wiederholt mit großer Sympathie.
Jedoch auch der Vater blickte manches Mal mit geheimer Angst auf den »Dämon« in dem Lieblingssohne, obgleich er schon wenige Tage nach Karls zwanzigstem Geburtstage starb. Nicht die kleinliche und peinliche Sorge des Hausmütterchens um das gedeihliche Fortkommen des Sohnes quälte ihn, sondern die dumpfe Ahnung von der granitenen Härte eines Charakters, die seinem weichen Wesen völlig fremd war. Jude, Rheinländer, Rechtsgelehrter, so daß er gegen alle Liebreize des ostelbischen Junkertums dreifach hätte gepanzert sein müssen, war Heinrich Marx doch preußischer Patriot, nicht in dem faden Sinne, den dies Wort heute hat, sondern preußischer Patriot etwa von dem Schlage, wie ihn die älteren von uns noch in den Waldeck und Ziegler gekannt haben: mit bürgerlicher Bildung gesättigt, in gutem Glauben an die altfritzige Aufklärung, ein »Ideologe«, wie sie Napoleon nicht ohne Grund haßte. Was dieser unter »dem tollen Ausdruck von Ideologie« verstand, schürte zumal den Haß des Vaters Marx gegen den Eroberer, der den rheinischen Juden die bürgerliche Gleichberechtigung und den rheinischen Landen den Code Napoléon geschenkt hatte, ihr eifersüchtig behütetes, aber von der altpreußischen Reaktion unablässig angefeindetes Kleinod.
Sein Glaube an den »Genius« der preußischen Monarchie ist auch nicht dadurch erschüttert worden, daß ihn die preußische Regierung gezwungen hätte, um seines Amtes willen seine Religion zu wechseln. Das ist wiederholt behauptet worden und auch von sonst unterrichteter Seite, anscheinend um zu rechtfertigen oder doch zu entschuldigen, was weder einer Rechtfertigung noch auch nur einer Entschuldigung bedarf. Selbst vom rein religiösen Standpunkt hatte ein Mann, der mit Locke und Leibniz und Lessing seinen »reinen Glauben an Gott« bekannte, nichts mehr in der Synagoge zu suchen und fand noch am ehesten einen Unterschlupf in der preußischen Landeskirche, in der damals ein duldsamer Rationalismus herrschte, eine sogenannte Vernunftreligion, die selbst auf das preußische Zensuredikt von 1819 abgefärbt hatte.
Aber die Lossagung vom Judentum war unter den damaligen Zeitläuften nicht nur ein Akt religiöser, sondern auch - und vornehmlich - ein Akt sozialer Emanzipation. An der ruhmvollen Geistesarbeit unserer großen Denker und Dichter war das Judentum nicht beteiligt gewesen; das bescheidene Licht eines Moses Mendelssohn hatte seiner »Nation« vergebens den Weg in das deutsche Geistesleben zu erhellen gesucht. Und als just in den Jahren, wo Heinrich Marx zum Christentum übertrat, ein Kreis junger Juden in Berlin die Bestrebungen Mendelssohns wieder aufnahm, geschah es mit dem gleichen Mißerfolge, obgleich sich Männer wie Eduard Gans und Heinrich Heine unter ihnen befanden. Gans, der dies Schifflein steuerte, strich sogar zuerst die Flagge und ging zum Christentum über, und wenngleich Heine ihm zunächst einen derben Fluch nachsandte - »Gestern noch ein Held gewesen, Ist man heute schon ein Schurke« -, so war er doch bald darauf selbst gezwungen, den »Eintrittsschein zur europäischen Kultur« zu lösen. Beide haben ihren historischen Anteil an der deutschen Geistesarbeit des Jahrhunderts erworben, während die Namen ihrer Gefährten, die treuer als sie an der Kultivierung des Judentums arbeiteten, vergessen und verschollen sind.
So ist manches lange Jahrzehnt hindurch der Übertritt zum Christentum für die freien Köpfe des Judentums ein zivilisatorischer Fortschritt gewesen. Und nicht anders ist der Religionswechsel zu verstehen, den Heinrich Marx im Jahre 1824 mit seiner Familie vollzog. Möglich, daß auch äußere Umstände nicht die Tat selbst, aber den Zeitpunkt der Tat bestimmt haben. Die jüdische Güterschlächterei, die in der landwirtschaftlichen Krisis der zwanziger Jahre einen heftigen Aufschwung nahm, hatte einen ebenso heftigen Judenhaß auch in den Rheinlanden erregt, und diesen Haß mitzutragen hatte ein Mann von der unantastbaren Redlichkeit des alten Marx weder die Pflicht, noch auch nur - im Hinblick auf seine Kinder - das Recht. Oder der Tod seiner Mutter, der in diese Zeit gefallen sein muß, hat ihn von einer Rücksicht der Pietät befreit, die ganz seinem Charakter entsprochen hätte, oder es mag auch mitgesprochen haben, daß im Jahre des Übertritts sein ältester Sohn das schulpflichtige Alter erreicht hatte.
Mag dem so oder anders sein, so besteht daran kein Zweifel, daß Heinrich Marx sich die freimenschliche Bildung erarbeitet hatte, die ihn von aller jüdischen Befangenheit befreite, und diese Freiheit hat er seinem Karl als wertvolles Erbe hinterlassen. Nichts in den immerhin zahlreichen Briefen, die er an den jungen Studenten gerichtet hat, verrät eine Spur von jüdischer Art oder Unart, sie sind in einem altväterischen, sentimental-weitläufigen Tone gehalten, im Briefstil noch des achtzehnten Jahrhunderts, wo der echte deutsche Mann schwärmte, wenn er liebte, und polterte, wenn er zürnte. Ohne jede spießbürgerliche Beschränktheit gehen sie willig auf die geistigen Interessen des Sohnes ein, nur mit entschiedener und durchaus berechtigter Abneigung gegen dessen Gelüste, sich als »gemeines Poetlein« aufzutun. Bei allem Schwelgen in den Gedanken an die Zukunft seines Karl kann sich freilich der alte Herr mit »seinen gebleichten Haaren und ein wenig gebeugtem Gemüt« doch nicht ganz des Gedankens entschlagen, ob das Herz dem Kopfe des Sohnes entspreche, ob es Raum für die irdischen, aber sanfteren Gefühle habe, die in diesem Jammertale den Menschen so wesentlich trostreich seien.
In seinem Sinne waren seine Zweifel wohl berechtigt; die echte Liebe, womit er den Sohn »im Innersten seines Herzens« trug, machte ihn nicht blind, sondern hellseherisch. Aber wie der Mensch niemals die letzten Folgen seines Tuns zu überblicken vermag, so hat Heinrich Marx nicht daran gedacht und nicht daran denken können, wie er durch das reiche Maß bürgerlicher Bildung, das er dem Söhne als kostbare Mitgift fürs Leben gab, doch nur den gefürchteten »Dämon« entbinden half, von dem er zweifelte, ob er »himmlischer« oder »faustischer« Natur sei. Wieviel hat Karl Marx im Elternhause schon spielend überwunden, was einem Heine oder einem Lassalle die ersten und schwersten Lebenskämpfe gekostet hat, Kämpfe, deren Wunden bei beiden niemals völlig verharscht sind!
Was die Schule dem heranwachsenden Knaben mitgegeben hat, läßt sich weniger klar erkennen. Karl Marx hat niemals von einem seiner Schulkameraden gesprochen, und so liegt auch von keinem dieser Kameraden eine Kunde über ihn vor. Früh genug hat er das Gymnasium seiner Vaterstadt durchlaufen; sein Abiturientenzeugnis ist vom 24. September [bei Mehring: 25. August] 1835 datiert. Es begleitet den hoffnungsvollen Jüngling in üblicher Weise mit seinen Segenswünschen, mit schablonenhaften Urteilen über die Leistungen in den einzelnen Fächern. Jedoch hebt es besonders hervor, daß Karl Marx häufig auch die schwierigeren Stellen der alten Klassiker zu übersetzen und zu erklären gewußt habe, besonders solche, wo die Schwierigkeit nicht so sehr in der Eigentümlichkeit der Sprache, als in der Sache und dem Gedankenzusammenhange bestehe; sein lateinischer Aufsatz zeige in sachlicher Hinsicht Reichtum an Gedanken und tieferes Eindringen in den Gegenstand, sei aber häufig mit Ungehörigem überladen.
In der eigentlichen Prüfung wollte es mit der Religion nicht gehen, aber auch mit der Geschichte nicht. Im deutschen Aufsatze jedoch fand sich ein Gedanke, der den prüfenden Lehrern schon als »interessant« erschien und uns noch viel interessanter erscheinen muß. Als Thema war gestellt »Betrachtung eines Jünglings bei der Wahl eines Berufs«. Das Urteil lautete, die Arbeit empfehle sich durch Gedankenreichtum und gute planmäßige Anordnung, sonst verfalle der Verfasser auch hier in den ihm gewöhnlichen Fehler, ein übertriebenes Suchen nach einem seltenen, bilderreichen Ausdruck. Dann aber wird wörtlich der Satz hervorgehoben: »Wir können nicht immer den Stand ergreifen, zu dem wir uns berufen glauben; unsere Verhältnisse in der Gesellschaft haben einigermaßen schon begonnen, ehe wir sie zu bestimmen imstande sind.« So kündigte sich in dem Knaben das erste Wetterleuchten des Gedankens an, den allseitig zu entwickeln das unsterbliche Verdienst des Mannes werden sollte.
2. Jenny von Westphalen
Im Herbste 1833 bezog Karl Marx die Universität Bonn, wo er ein Jahr lang vielleicht weniger Rechtswissenschaft studiert, als sich »Studierens halber« aufgehalten hat.
Unmittelbare Kunde liegt auch über diese Zeit nicht vor, aber so wie sie sich in den Briefen des Vaters spiegelt, scheint sich das junge Blut ein wenig ausgeschäumt zu haben. Von einem »wilden Toben« schrieb der Alte erst später in einer sehr ärgerlichen Stunde; zur Zeit klagte er nur über die »Rechnungen à la Karl, ohne Zusammenhang, ohne Resultat«, und mit diesen Rechnungen hat es auch später bei dem klassischen Theoretiker des Geldes nie recht stimmen wollen.
Nach dem lustigen Jahre in Bonn sah es vollends einem studentischen Geniestreiche gleich, als sich Karl Marx, in dem gesegneten Alter von achtzehn Jahren, mit einer Gespielin seiner Kinderjahre verlobte, einer vertrauten Freundin seiner älteren Schwester Sophie, die dem Bunde der jungen Merzen die Wege ebnen half. In der Tat aber war es der erste und schönste Sieg, den dieser geborene Herrscher über Menschen davontrug; ein Sieg, der dem eigenen Vater ganz »unbegreiflich« erschien, bis er ihm erklärlicher wurde durch die Entdeckung, daß die Braut auch »etwas Genialisches« hätte und Opfer zu bringen verstünde, deren gewöhnliche Mädchen nicht fähig wären.
Wirklich war Jenny von Westphalen ein Mädchen nicht nur von ungewöhnlicher Schönheit, sondern auch von ungewöhnlichem Geist und ungewöhnlichem Charakter. Vier Jahre älter als Karl Marx, stand sie doch erst im Anfange der zwanziger Jahre; im vollen Schmelz ihre jungen Schönheit war sie viel gefeiert und viel umworben, und als die Tochter eines hochgestellten Beamten einer glänzenden Zukunft sicher. Alle diese Aussichten opferte sie, wie der alte Marx meinte, einer »gefahrvollen und unsicheren Zukunft«, und er glaubte mitunter auch an ihr die ahnungsschwere Furcht zu beobachten, die ihn beunruhigte. Aber er war des »Engelsmädchens«, der »Zauberin« so sicher, daß er den Sohne zuschwor, kein Fürst werde sie ihm abwenden.
Die Zukunft gestaltete sich viel gefahrvoller und unsicherer, als Heinrich Marx in seinen bängsten Träumen vorhergesehen hatte, jedoch Jenny von Westphalen, deren Jugendbildnis von kindlicher Anmut strahlt, hat mit dem unbeugsamen Mut einer Heldin zu dem Mann ihrer Wahl gehalten, mitten in den furchtbarsten Leiden und Qualen. Nicht vielleicht im hausbackenen Sinne des Wortes hat sie ihm die schwere Last seines Lebens erleichtert, denn, ein verwöhntes Kind des Glückes, war sie den kleinen Miseren des täglichen Lebens nicht immer so gewachsen, wie es eine wetterfeste Proletarierin gewesen sein würde, aber in dem hohen Sinne, womit sie das Werk seines Lebens erfaßte, ist sie ihm eine ebenbürtige Gefährtin geworden. In allen ihren Briefen soviel ihrer erhalten sind, weht ein Hauch echter Weiblichkeit; sie war eine Natur im Sinne Goethes, gleich wahr in jeder Stimmung ihres Gemüts, in dem entzückenden Plauderton heiterer Tage wie in dem tragischen Schmerz der Niobe, der das Elend ein Kind entriß, ohne daß sie ihm auch nur ein bescheidenes Grab betten konnte. Ihre Schönheit war der Stolz ihres Mannes, und als ihre Geschicke nahezu schon ein Menschenalter verkettet waren, schrieb er ihr 1863 aus Trier, wo er zum Begräbnis seiner Mutter weilte: »Ich bin täglich zum alten Westphalenhause gewallfahrtet (in der Römerstraße), das mich mehr interessiert hat als alle römischen Altertümer, weil es mich an die glückliche Jugendzeit erinnert und meinen besten Schatz barg. Außerdem fragt man mich täglich, links und rechts, nach dem quondam ›schönsten Mädchen von Trier‹ und der ›Ballkönigin‹. Es ist verdammt angenehm für einen Mann, wenn seine Frau in der Phantasie einer ganzen Stadt so als ›verwunschene Prinzessin‹ fortlebt.« So auch hat der sterbende Mann, wie fremd ihm immer alle Sentimentalität geblieben ist, in wehmütig erschütterndem Ton von dem schönsten Teil seines Lebens gesprochen, der ihm in dieser Frau beschlossen gewesen sei.
Die jungen Leute verlobten sich zunächst, ohne die Eltern der Braut zu fragen, was seinem gewissenhaften Vater nicht geringe Bedenken erregte. Aber nicht lange danach gaben auch sie ihre Zustimmung. Der Geheime Regierungsrat Ludwig von Westphalen gehörte trotz seines Namens und Titels weder zum ostelbischen Junkertum noch zur altpreußischen Bürokratie. Sein Vater war jener Philipp Westphalen, der zu den merkwürdigsten Gestalten der Kriegsgeschichte zählt. Bürgerlicher Geheimsekretär des Herzogs Ferdinand von Braunschweig, der im siebenjährigen Kriege an der Spitze eines bunt zusammengewürfelten, von englischem Gelde besoldeten Heeres das westliche Deutschland erfolgreich vor den Eroberungsgelüsten Ludwigs XV. und seiner Pompadour schützte, hatte sich Philipp Westphalen zum tatsächlichen Generalstabschef des Herzogs zu machen verstanden, allen deutschen und englischen Generalen des Heeres zum Trotz. Seine Verdienste waren so anerkannt, daß ihn der König von England zum Generaladjutanten von der Armee ernennen wollte, was Philipp Westphalen jedoch ablehnte. Nur soweit mußte er seinen bürgerlichen Sinn zähmen, daß er den Adel »genehmigte«: aus ähnlichen Gründen, wie sich ein Herder oder Schiller zu dieser Erniedrigung bequemen mußte: um die Tochter einer schottischen Baronsfamilie heiraten zu können, die im Feldlager des Herzogs Ferdinand erschienen war, zum Besuch ihrer mit einem General der englischen Hilfstruppen vermählten Schwester.
Ein Sohn dieses Paares war Ludwig von Westphalen. Hatte er von seinem Vater einen historischen Namen geerbt, so reichte auch die Ahnenreihe der Mutter zu großen historischen Erinnerungen herauf; einer ihrer Vorfahren in gerade aufsteigender Linie hatte im Kampfe für die Einführung der Reformation in Schottland den Scheiterhaufen bestiegen, ein anderer, der Earl Archibald Argyle, war als Rebeller im Freiheitskampfe gegen Jakob II. auf dem Marktplatze in Edinburgh enthauptet worden. Mit solchen Familienüberlieferungen entwuchs Ludwig von Westphalen von vornherein den Dunstkreisen des bettelstolzen Junkertums und der dünkelhaften Bürokratie. Ursprünglich in braunschweigischen Diensten, hatte er sich nicht bedacht, diese Dienste fortzusetzen, als das kleine Herzogtum von Napoleon zum Königreich Westfalen geschlagen worden war, da ihm offenbar weniger an dem angestammten Welfen lag als an den Reformen, mit denen die französische Eroberung die verrotteten Zustände seines Heimatländchens heilte. Der Fremdherrschaft selbst blieb er deshalb nicht weniger abgeneigt und hatte im Jahre 1813 die harte Hand des Marschalls Davoust zu spüren. Vor Landrat in Salzwedel, wo ihm seine Tochter Jenny am 12. Februar 1814 geboren wurde, war er dann zwei Jahre später als Rat an die Regierung in Trier versetzt worden; im ersten Eifer besaß der preußische Staatskanzler Hardenberg noch die Erkenntnis, daß die tüchtigsten, von junkerlichen Schrullen freiesten Köpfe in die neugewonnenen Rheinland geworfen werden müßten, die mit ihrem Herzen immer noch an Frankreich hingen.
Karl Marx hat Zeit seines Lebens von diesem Manne mit größter Anhänglichkeit und Dankbarkeit gesprochen. Nicht nur als sein Schwiegersohn, hat er ihn seinen »teuren, väterlichen Freund« genannt und ihn seiner »kindlichen Liebe« versichert. Westphalen konnte ganze Gesänge Homers vom Anfang bis zum Ende hersagen; er kannte die meisten Dramen Shakespeares englisch wie deutsch auswendig; aus dem »alten Westphalenhause« holte sich Karl Marx viele Anregungen, die ihm das eigne Haus nicht bieten konnte und noch viel weniger die Schule. Er selbst ist schon von früh auf ein Liebling Westphalens gewesen, der seine Einwilligung in die Verlobung auch in der Erinnerung an die glücklich Ehe der eignen Eltern gegeben haben mag; im Sinne der Welt hatte die Tochter der altadeligen Baronsfamilie ebenfalls eine schlechte Partie gemacht, als sie sich mit dem armen bürgerlichen Geheimsekretär verband.
In dem ältesten Sohne Ludwig von Westphalens ist die Gesinnung des Vaters nicht lebendig geblieben. Er war ein bürokratischer Streber und schlimmeres als das; in der Reaktionszeit der fünfziger Jahre hat er als preußischer Minister des Innern die feudalen Ansprüche des verstocktesten Zaunjunkertums sogar gegen den Ministerpräsidenten Manteuffel vertreten, der immerhin ein gewitzter Bürokrat war. Mit seiner Schwester Jenny hat dieser Ferdinand von Westphalen in keinen engeren Beziehungen gestanden, zumal da er fünfzehn Jahre älter als sie und auch nur, als Sohn aus einer ersten Ehe des Vaters, ihr Halbbruder war.
Ihr echter Bruder war dagegen Edgar von Westphalen, der nach links von den Pfaden des Vaters abwich wie Ferdinand nach rechts. Er ha gelegentlich die kommunistischen Kundgebungen seines Schwagers Marx mitunterzeichnet. Ein steter Gefährte ist er ihm freilich nicht geworden; er ging über das große Wasser, hatte dort wechselnde Schicksale, kehrte zurück, tauchte bald hier, bald dort auf, ein rechter Wildling, wo man von ihm hört. Aber ein treues Herz hat er immer für Jenny und Karl Marx gehabt, und sie haben ihren ersten Sohn nach ihm genannt.
Zweites Kapitel: Der Schüler Hegels
1. Das erste Jahr in Berlin
Schon ehe Karl Marx sich verlobte, hatte sein Vater bestimmt, daß er seine Studien in Berlin fortsetzen solle; vom 1. Juli 1836 ist der noch erhaltene Schein datiert, worin Heinrich Marx nicht nur die Erlaubnis erteilt, sondern es auch für seinen Willen erklärt, daß sein Sohn Karl im nächsten Semester die Universität Berlin beziehe, um die in Bonn angefangenen Studien der Rechts- und Kameralwissenschaft fortzusetzen.
Die Verlobung selbst wird diesen Entschluß des Vaters eher bestärkt als geschwächt haben; bei ihren langen Aussichten hat sein bedächtiges Wesen vorläufig wohl eine weite Trennung der Liebenden als ratsam erwogen. Sonst mag er bei der Wahl Berlins durch seinen preußischen Patriotismus bestimmt worden sein und auch dadurch, daß die Berliner Universität die alte Burschenherrlichkeit nicht kannte, die Karl Marx nach der vorsorglichen Meinung des Alten genügend in Bonn ausgekostet hatte; »wahre Kneipen sind andere Universitäten gegen das hiesige Arbeitshaus«, meinte Ludwig Feuerbach.
Keinesfalls hat der junge Student selbst sich für Berlin entschieden. Karl Marx liebte seine sonnige Heimat, und die preußische Hauptstadt ist ihm all sein Lebtag widrig gewesen. Am wenigsten konnte ihn die Philosophie Hegels anziehen, die nach dem Tode ihres Stifters die Berliner Universität noch unumschränkter beherrschte als schon bei dessen Lebzeiten, denn sie war ihm vollkommen fremd. Dazu kam die weite Entfernung von der Geliebten. Er hatte zwar versprochen, sich mit ihrem Jawort für die Zukunft zu begnügen und allen äußeren Liebeszeichen für die Gegenwart zu entsagen. Aber selbst unter ihresgleichen genießen solche Schwüre der Liebenden den besonderen Vorzug, ins Wasser geschrieben zu sein; seinen Kindern hat Karl Marx später erzählt, er sei damals in der Liebe zu ihrer Mutter ein wahrer rasender Roland gewesen, und so ruhte das junge glühende Herz nicht eher, bis ihm gestattet wurde, Briefe mit seiner Braut zu wechseln.
Allein den ersten Brief von ihr erhielt er doch erst, als er bereits ein Jahr in Berlin geweilt hatte, und über dies Jahr sind wir in gewisser Beziehung genauer unterrichtet, als über irgendeines seiner früheren oder späteren Lebensjahre: durch einen umfangreichen Brief, den er am 10. November 1837 an seine Eltern richtete, um ihnen »am Schlusse eines hier verlebten Jahres einen Blick auf die Zustände desselben« zu gewähren. Die merkwürdige Urkunde zeigt uns im Jüngling schon den ganzen Mann, der bis zur völligen Erschöpfung seiner geistigen und körperlichen Kräfte um die Wahrheit ringt: seinen unersättlichen Wissensdurst, seine unerschöpfliche Arbeitskraft, seine unerbittliche Selbstkritik und jenen kämpfenden Geist, der das Herz, wo es geirrt zu haben schien, doch nur übertäubte.
Am 22. Oktober 1836 war Karl Marx immatrikuliert worden. Um die akademischen Vorlesungen hat er sich nicht viel gekümmert; in neun Semestern hat er ihrer nicht mehr als zwölf belegt, hauptsächlich juristische Pflichtkollegien, und selbst von ihnen vermutlich wenige gehört. Von den offiziellen Universitätslehrern hat wohl nur Eduard Gans einigen Einfluß auf seine geistige Entwicklung gehabt. Er hörte bei Gans Kriminalrecht und Preußisches Landrecht, und Gans selbst hat den »ausgezeichneten Fleiß« bezeugt, womit Karl Marx die beiden Vorlesungen besucht habe. Beweiskräftiger als solche Zeugnisse, bei denen es sehr menschlich herzugehen pflegt, ist die schonungslose Polemik, die Marx in seinen ersten Schriften gegen die Historische Rechtsschule führte, gegen deren Enge und Dumpfheit, gegen deren schädlichen Einfluß auf Gesetzgebung und Rechtsentwicklung der philosophisch gebildete Jurist Gans seine beredte Stimme erhoben hatte.
Jedoch betrieb Marx nach seiner eigenen Angabe das Fachstudium der Jurisprudenz nur als untergeordnete Disziplin neben Geschichte und Philosophie, und in diesen beiden Fächern hat sich Marx überhaupt um keine Vorlesungen gekümmert, sondern nur das übliche Pflichtkolleg über Logik wenigstens belegt, bei Gabler, dem offiziellen Nachfolger Hegels, aber dem mittelmäßigsten unter dessen mittelmäßigen Nachbetern. Als denkender Kopf hat Marx schon auf der Universität selbständig gearbeitet, und in zwei Semestern einen Wissensstoff bewältigt, den in der langsamen Stallfütterung der akademischen Vorlesungen zu verarbeiten nicht zwanzig Semester genügt haben würden.
Nach seiner Ankunft in Berlin verlangte zunächst die »neue Welt der Liebe« ihr Recht. »Sehnsuchtstrunken und hoffnungsleer« entlud sie sich in drei Heften Gedichte, die alle »meiner teuren, ewig geliebten Jenny von Westphalen« gewidmet wurden. In deren Händen waren sie schon im Dezember 1836, mit »Tränen der Wonne und des Schmerzes begrüßt«, wie Schwester Sophie nach Berlin meldete. Der Dichter selbst urteilte ein Jahr später, in dem großen Briefe an die Eltern, sehr respektlos über diese Kinder seiner Muse. »Breit und formlos geschlagenes Gefühl, nichts Naturhaftes, alles aus dem Mond konstruiert, der völlige Gegensatz von dem, was da ist und dem, was sein soll, rhetorische Reflektionen statt poetischer Gedanken«: dies ganze Sündenregister entrollte der junge Dichter selbst, und wenn er »vielleicht auch eine gewisse Wärme der Empfindung und Ringen nach Schwung« als mildernden Umstand geltend machen möchte, so trafen diese löblicheren Eigenschaften doch nur etwa in dem Sinn und Umfange zu wie bei den Lauraliedern Schillers.
Im allgemeinen atmen seine jugendlichen Gedichte eine triviale Romantik, durch die selten ein echter Ton klingt. Dabei ist die Technik des Verses so unbeholfen und ungelenk, wie sie eigentlich nicht mehr sein durfte, nachdem Heine und Platen gesungen hatten. Auf so seltsamen Irrwegen begann sich das künstlerische Vermögen zu entwickeln, das Marx in reichem Maße besaß und gerade auch in seinen wissenschaftlichen Werken bekundete. Wie er in der Bildkraft seiner Sprache an die ersten Meister der deutschen Literatur heranreichte, so legte er hohen Wert auf das ästhetische Gleichmaß seiner Schriften, ungleich den dürftigen Geistern, denen lederne Langeweile die erste Bürgschaft gelehrten Schaffens ist. Aber unter den mannigfachen Spenden, die ihm die Musen in seine Wiege gelegt hatten, befand sich doch nicht die Gabe der gebundenen Rede.
Allein, wie er seinen Eltern in dem großen Briefe vom 10. November 1837 schrieb: die Poesie durfte nur Begleitung sein; er mußte Jurisprudenz studieren und fühlte vor allem Drang, mit der Philosophie zu ringen. Er nahm Heineccius, Thibaut und die Quellen durch, übersetzte die beiden ersten Pandektenbücher ins Deutsche und suchte eine Rechtsphilosophie auf dem Gebiete des Rechts zu begründen. Dies »unglückliche Opus« wollte er bis auf beinahe dreihundert Bogen geführt haben, was vielleicht doch nur auf einem Schreibfehler beruht. Am Schlusse sah er die »Falschheit des Ganzen« ein und warf sich der Philosophie in die Arme, um ein neues metaphysisches System zu entwerfen, an dessen Schlusse er abermals seiner bisherigen Bestrebungen Verkehrtheit einzusehen gezwungen war. Daneben hatte er die Gewohnheit, sich Auszüge aus allen Büchern zu machen, die er las, so aus Lessings »Laokoon«, Solgers »Erwin«, Winckelmanns »Kunstgeschichte«, Ludens »Deutscher Geschichte«, und so nebenbei Reflektionen niederzukritzeln. Zugleich übersetzte er die »Germania« des Tacitus, die »Trauergesänge« des Ovid und fing privatim, das heißt aus Grammatiken, Englisch und Italienisch zu lernen an, worin er noch nichts erreichte, las Kleins »Kriminalrecht« und seine Annalen und alles Neueste der Literatur, doch dies nur nebenhin. Den Schluß des Semesters bildeten dann wieder »Musentänze und Satyrmusik«, wobei ihm plötzlich das Reich der wahren Poesie wie ein ferner Feenpalast entgegenblitzte und alle seine Schöpfungen in nichts zerfielen.
Danach war das Ergebnis dieses ersten Semesters, daß »viele Nächte durchwacht, viele Kämpfe durchstritten, viele innere und äußere Anregung erduldet«, aber doch nicht viel gewonnen, Natur, Kunst, Welt vernachlässigt und Freunde abgestoßen worden waren. Auch litt der jugendliche Körper unter der Überanstrengung, und auf ärztlichen Rat siedelte Marx nach Stralau über, das damals noch ein ruhiges Fischerdorf war. Hier erholte er sich schnell, und nun begann das geistige Ringen von neuem. Auch im zweiten Semester wurden Massen des verschiedenartigsten Wissensstoffes durchgenommen, jedoch immer deutlicher zeichnete sich Hegels Philosophie als der ruhende Pol in der Flucht der Erscheinungen ab. Als Marx sie zuerst in Fragmenten kennenlernte, wollte ihm ihre »groteske Felsenmelodie« nicht behagen, aber während einer neuen Erkrankung studierte er sie von Anfang bis zu Ende und geriet zudem in einen »Doktorklub« von jungen Hegelianern, wo er sich im Streite der Meinungen immer fester »an die jetzige Weltphilosophie» kettete, freilich nicht ohne daß alles Klangreiche in ihm verstummte und ihn »eine wahre Ironiewut nach so viel Negiertem« befiel.
Alles das offenbarte Karl Marx seinen Eltern und schloß mit der Bitte, sofort - und nicht erst zu Ostern des nächsten Jahres, wie ihm der Vater schon erlaubt hatte - nach Hause kommen zu dürfen. Er wollte sich mit dem Vater aussprechen über die »vielfach hin- und hergeworfene Gestaltung« seines Gemüts; nur in der »lieben Nähe« der Eltern würde er die »aufgeregten Gespenster« besänftigen können.
So wertvoll uns heute dieser Brief ist als ein Spiegel, worin wir den jungen Marx leibhaftig erblicken, so schlecht wurde er in dem elterlichen Hause empfangen. Der schon kränkelnde Vater sah den »Dämon« vor sich, den er immer in dem Sohne gefürchtet hatte, den er doppelt fürchtete, seitdem er eine »gewisse Person« wie sein eigenes Kind liebte, seitdem eine sehr ehrwürdige Familie veranlaßt war, ein Verhältnis gutzuheißen, das anscheinend und nach dem gewöhnlichen Weltenlauf für dieses geliebte Kind voller Gefahren und trüber Aussichten war. Er war nie so eigensinnig gewesen, dem Sohne den Lebensweg vorzuschreiben, wenn es anders nur ein Weg war, der dazu führen konnte, »heilige Verpflichtungen« zu erfüllen; aber was er nun vor sich sah, war eine stürmisch bewegte See ohne jeden sicheren Ankergrund.
So entschloß er sich, trotz seiner »Schwäche«, die er selbst am besten kannte, »einmal hart« zu sein, und wurde in seiner Antwort vom 1. [bei Mehring: 9.] Dezember »hart« nach seiner Weise, maßlos übertreibend und dazwischen wehmütig seufzend. Er fragte, wie der Sohn seine Aufgabe gelöst habe, und antwortete selbst: »Das sei Gott geklagt!!! Ordnungslosigkeit, dumpfes Herumschweben in allen Teilen des Wissens, dumpfes Brüten bei der düsteren Öllampe; Verwilderung im gelehrten Schlafrock und ungekämmten Haaren statt der Verwilderung bei dem Bierglase; zurückscheuchende Ungeselligkeit mit Hintansetzung alles Anstandes und selbst aller Rücksicht gegen den Vater - die Kunst, mit der Welt zu verkehren, auf die schmutzige Stube beschränkt, wo vielleicht in der klassischen Unordnung die Liebesbriefe einer Jenny und die wohlgemeinten, und vielleicht mit Tränen geschriebenen Ermahnungen des Vaters zum Fidibus verwandt werden, was übrigens besser wäre, als wenn sie durch noch unverantwortlichere Unordnung in die Hände Dritter kämen.« Dann übermannt ihn die Wehmut, und er stärkt sich durch die Pillen, die ihm der Arzt verschrieben hat, um unbarmherzig zu bleiben. Die schlechte Wirtschaft Karls wird schwer getadelt. »Als wären wir Goldmännchen, verfügt der Herr Sohn in einem Jahre für beinahe 700 Taler, gegen alle Abrede, gegen alle Gebräuche, während die Reichsten keine 500 ausgeben.« Gewiß sei Karl kein Prasser und kein Verschwender, aber wie könne ein Mann, der alle acht oder vierzehn Tage neue Systeme erfinden und die alten zerreißen müsse, sich mit solchen Kleinigkeiten abgeben? Jeder habe die Hand in seiner Tasche und jeder hintergehe ihn.
In dieser Art ging es noch eine gute Strecke weiter, und zuletzt lehnte der Vater unerbittlich den Besuch Karls ab. »In diesem Augenblick hierher zu kommen, wäre Unsinn. Ich weiß zwar, daß Du Dir wenig aus Vorlesungen machst - wahrscheinlich doch bezahlst -, aber ich will wenigstens das Dekorum beobachten. Ich bin gewiß kein Sklave der Meinung, aber ich liebe auch nicht, daß auf meine Kosten geklatscht werde.« Zu den Osterferien dürfe Karl kommen, oder auch zehn Tage früher, denn so pedantisch wolle der Vater nicht sein.
Durch alle seine Klagen klang der Vorwurf, daß es dem Sohne an Herz fehle, und wie dieser Vorwurf wieder und wieder gegen Karl Marx erhoben worden ist, so mag hier, wo er zum erstenmal ertönt und noch am ehesten ertönen durfte, gleich das Wenige gesagt werden, was darüber gesagt werden kann. Mit dem modischen Schlagwort vom »Rechte des Auslebens«, das eine verzärtelte Kultur erfunden hat, um eine feige Eigenliebe zu beschönigen, ist natürlich nichts gesagt; und nicht viel mehr auch mit dem älteren Worte von dem »Rechte des Genius«, der sich mehr erlauben dürfe als gewöhnliche Menschenkinder. Bei Karl Marx entsprang das unablässige Ringen um die höchste Erkenntnis vielmehr der tiefsten Empfindung des Herzens; er war nicht, wie er sich einmal derb ausgedrückt hat, Ochse genug, um den »Menschheitsqualen« den Rücken zu kehren, oder wie schon Hutten den gleichen Gedanken ausgedrückt hat: Gott hatte ihn mit dem Gemüt beschwert, daß ihm gemeiner Schmerz weher tue und tiefer zu Herzen gehe als anderen. Kein einzelner hat je soviel geleistet, die Wurzeln der »Menschheitsqualen« zu zerstören als Karl Marx. Wie sein Lebensschiff auf hoher See kreuzte, im Sturm und Wetter und im ewigen Kugelregen der Feinde, so hat seine Fahne immer hoch am Maste geflattert, aber ein behagliches Leben an Bord ist es nicht gewesen, weder für den Kapitän, noch für die Mannschaft.
Deshalb war Marx nicht gefühllos gegen die Seinen. Der kämpfende Geist konnte die Empfindungen des Herzens wohl übertäuben, aber niemals ersticken, und oft hat noch der reife Mann schmerzlich beklagt, daß die ihm am nächsten standen, unter den ehernen Losen seines Lebens schwerer zu leiden hätten als er selbst. Auch der junge Student war nicht taub gegen die Notschreie seines Vaters; er verzichtete nicht nur auf den sofortigen Besuch in Trier, sondern auch auf die Osterreise, zum Kummer der Mutter, aber zur großen Genugtuung des Vaters, dessen Groll sich nun schnell zu besänftigen begann. Er hielt zwar an seinen Klagen fest, aber ihre Übertreibungen gab er preis; in der Kunst, abstrakt zu räsonieren, könne er es mit Karl doch nicht aufnehmen, und um die Terminologie zu studieren, bevor er nun gar ins Heiligtum eindringen könne, dazu sei er zu alt. Nur in einem Punkte wolle alles Transzendente nicht helfen, und da beobachte der Sohn klugerweise ein vornehmes Schweigen, nämlich über das lumpige Geld, dessen Wert für einen Familienvater er immer noch nicht zu kennen scheine. Aber aus Müdigkeit wollte der Vater die Waffen niederlegen, und das Wort hatte einen ernsteren Sinn, als es nach dem leisen Humor zu haben schien, der schon wieder durch die Zeilen dieses Briefes spielte.
Er ist vom 10. Februar 1838 datiert, als Heinrich Marx sich eben von einem fünfwöchigen Krankenlager erhoben hatte. Es war keine dauernde Besserung; die Krankheit, anscheinend ein Leberleiden, kehrte wieder und nahm zu, bis gerade ein Vierteljahr später, am 10. Mai 1838, der Tod eintrat. Er kam zur rechten Zeit, um diesem Vaterherzen die Enttäuschungen zu ersparen, an denen es Stück für Stück zerbrochen wäre.
Karl Marx aber hat immer dankbar empfunden, was ihm sein Vater gewesen war. Wie dieser ihn im Innersten des Herzens getragen hatte, so trug er ein Bild des Vaters auf seinem Herzen, bis er es mit ins eigene Grab nahm.
2. Die Junghegelianer
Vom Frühjahr 1838, wo er den Vater verlor, hat Karl Marx noch drei Jahre in Berlin verlebt, in dem Kreise des Doktorklubs, dessen geistiges Leben ihm die Geheimnisse der Hegelschen Philosophie erschlossen hatte.
Diese Philosophie galt damals noch als preußische Staatsphilosophie. Der Kultusminister Altenstein und sein Geheimrat Johannes Schulze hatten sie unter ihren besonderen Schutz genommen. Hegel verherrlichte den Staat als die Wirklichkeit der sittlichen Idee, als das absolut Vernünftige und den absoluten Selbstzweck, daher als das höchste Recht gegen die einzelnen, deren höchste Pflicht es sei, Mitglieder des Staats zu sein. Diese Lehre vom Staat schmeichelte sich der preußischen Bürokratie ausnehmend ein; warf sie doch einen verklärenden Schein selbst auf die Sünden der Demagogenjagd!
Hegel beging mit ihr auch keineswegs eine Heuchelei, denn es erklärte sich aus seiner politischen Entwicklung, daß ihm die Monarchie, in der die Staatsdiener das Beste tun müßten, als die idealste Staatsform galt; allenfalls eine gewisse mittelbare Mitherrschaft der herrschenden Klassen hielt er daneben für notwendig, doch nur in ständischer Beschränkung; von einer allgemeinen Volksvertretung im modern-konstitutionellen Sinne wollte er so wenig wissen wie der preußische König und dessen Orakel Metternich.
Aber das System, das sich Hegel für seine Person zurechtgemacht hatte, stand in unversöhnlichem Widerspruch mit der dialektischen Methode, die er als Philosoph vertrat. Mit dem Begriffe des Seins ist auch der Begriff des Nichts gegeben, und aus dem Kampfe beider entsteht der höhere Begriff des Werdens. Alles ist und ist zugleich nicht, denn alles fließt, ist in steter Veränderung, in stetem Werden und Vergehen begriffen. So war die Geschichte ein in ewiger Umwälzung begriffener, von Niederem zu Höherem aufsteigender Entwicklungsprozeß, den Hegel mit seiner universalen Bildung in den verschiedensten Fächern der historischen Wissenschaft nachzuweisen unternahm, wenn auch nur in der seiner idealistischen Anschauung entsprechenden Form, daß sich in allem geschichtlichen Geschehen die absolute Idee auswirke, die Hegel für die belebende Seele der ganzen Welt erklärte, ohne sonst etwas von ihr auszusagen.
Danach konnte das Bündnis zwischen der Philosophie Hegels und dem Staat der Friedrich Wilhelme nur eine Vernunftehe sein, die gerade so lange währte, wie sich beide Teile gegenseitig ihre Vernunft bescheinigten. Das ging etwa an in den Tagen der Karlsbader Beschlüsse und der Demagogenverfolgungen, aber schon die Julirevolution von 1830 gab der europäischen Entwicklung einen so starken Stoß nach vorwärts, daß Hegels Methode sich ungleich waschechter erwies als sein System. Sobald die immerhin noch schwachen Wirkungen der Julirevolution auf Deutschland erstickt worden waren und die Ruhe des Kirchhofs wieder über dem Volke der Dichter und Denker lag, beeilte sich das preußische Junkertum, den alten verschlissenen Kram der mittelalterlichen Romantik nochmals gegen die moderne Philosophie auszuspielen. Das wurde ihm um so leichter, als die Bewunderung Hegels weniger seine Sache, als die Sache der halbwegs aufgeklärten Bürokratie gewesen war, und Hegel, bei aller Verherrlichung des Beamtenstaats, doch gar nichts dazu getan hatte, dem Volke die Religion zu erhalten, was nun einmal das A und O der feudalen Überlieferung war und im letzten Grunde aller ausbeutenden Klassen ist.
Auf religiösem Gebiete erfolgte dann auch der erste Zusammenstoß. Hatte Hegel gemeint, die heiligen Geschichten der Bibel seien wie profane zu betrachten, den Glauben gehe das Wissen gemeiner, wirklicher Geschichten nichts an, so machte David Strauß, ein junger Schwabe, nun vollen Ernst mit dem Worte des Meisters. Er forderte, daß die evangelische Geschichte der historischen Kritik preiszugeben sei, und bewies die Berechtigung seiner Forderung durch sein »Leben Jesu«, das 1835 erschien und ungeheures Aufsehen erregte. Strauß knüpfte damit an die bürgerliche Aufklärung an, über deren »Aufkläricht« sich Hegel allzu verächtlich ausgesprochen hatte. Aber die Gabe des dialektischen Denkens gestattete ihm die Frage ungleich tiefer zu fassen als der alte Reimarus, der »Ungenannte« Lessings, sie gefaßt hatte. Strauß sah nicht mehr in der christlichen Religion ein Produkt des Betruges oder in den Aposteln eine Rotte von Gaunern, sondern erklärte die mythischen Bestandteile der Evangelien aus dem bewußtlosen Schaffen der ersten christlichen Gemeinden. Vieles aber aus den Evangelien erkannte er noch als geschichtlichen Bericht über das Leben Jesu und Jesus selbst als geschichtliche Person an, wie er überhaupt in den wichtigsten Punkten immer noch einen geschichtlichen Kern voraussetzte.
Politisch war Strauß vollkommen harmlos und ist es all sein Lebtag geblieben. Ein wenig schärfer klang die politische Note in den »Hallischen Jahrbüchern« an, die Arnold Ruge und Theodor Echtermeyer im Jahre 1838 als Organ der Junghegelianer gründeten. Sie gingen zwar auch von der Literatur und Philosophie aus und wollten zunächst nicht mehr sein als ein Gegengewicht gegen die Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, das eingerostete Organ der Althegelianer. Aber Arnold Ruge, hinter den der früh verstorbene Echtermeyer bald zurücktrat, hatte doch schon in der Burschenschaft mitgetan und den Wahnsinn der Demagogenjagd mit sechsjährigem Gefängnis in Köpenick und Kolberg gebüßt. Er hatte dies Schicksal freilich nicht tragisch genommen und sich als Privatdozent in Halle durch glückliche Heiraten eine behagliche Existenz geschaffen, die ihn das preußische Staatswesen trotz alledem für frei und gerecht erklären ließ. Er hätte nichts dagegen einzuwenden gehabt, wenn sich an ihm die boshafte Rede der altpreußischen Mandarinen erfüllt hätte, wonach im Preußischen niemand eine so schnelle Karriere mache wie ein bekehrter Demagoge. Jedoch eben hieran haperte es.
Ruge war kein selbständiger Denker und am wenigsten ein revolutionärer Geist, aber er besaß gerade genug Bildung, Ehrgeiz, Fleiß und Kampflust, um eine wissenschaftliche Zeitung gut zu leiten. Er selbst hat sich einmal nicht unzutreffend einen Großkaufmann des Geistes genannt. Er machte aus seinen »Hallischen Jahrbüchern« einen Sammelplatz aller unruhigen Geister, die nun einmal den - im Interesse aller staatlichen Ordnung leidigen - Vorzug besitzen, das meiste Leben in die Bude der Presse zu bringen. David Strauß fesselte als Mitarbeiter ungleich mehr, als sämtliche Theologen, die mit Spießen und Stangen für die gottgegebene Unfehlbarkeit der Evangelien fochten, die Leser hätten fesseln können. Zwar versicherte Ruge, seine Jahrbücher blieben »Hegelsche Christen und Hegelsche Preußen«, aber der Kultusminister Altenstein, der ohnehin schon von der romantischen Reaktion arg an die Wand gedrückt wurde, traute dem Frieden nicht und ließ sich auf die flehentliche Bitte Ruges um eine staatliche Anstellung als Anerkennung seiner Leistungen nicht ein. So dämmerte den »Hallischen Jahrbüchern« die Erkenntnis auf, daß die Bande gelöst werden müßten, die die preußische Freiheit und Gerechtigkeit gefangen hielten.
Zu den Mitarbeitern der »Hallischen Jahrbücher« gehörten nun auch die Berliner Junghegelianer, in deren Mitte Karl Marx drei Jugendjahre verlebt hat. Der Doktorklub bestand aus Dozenten, Lehrern, Schriftstellern in der ersten Blüte des Mannesalters. Rutenberg, den Karl Marx anfangs in einem Briefe an seinen Vater den »intimsten« seiner Berliner Freunde nannte, hatte am Berliner Kadettenkorps in Geographie unterrichtet, war aber entlassen worden, angeblich weil er eines Morgens betrunken im Rinnstein gelegen hatte, tatsächlich weil er in den Verdacht geraten war, »böswillige« Artikel in Hamburger oder Leipziger Zeitungen veröffentlicht zu haben. Eduard Meyen war an einer kurzlebigen Zeitschrift beteiligt, in der Marx zwei seiner Gedichte veröffentlicht hat, die einzigen glücklicherweise, die je das Licht der Welt erblickt haben. Ob Max Stirner, der an einer Mädchenschule unterrichtete, schon zur Zeit, wo Marx in Berlin studierte, diesem Verein angehört hat, läßt sich nicht sicher feststellen; ein Beweis dafür, daß beide sich persönlich gekannt haben, liegt nicht vor. Auch entbehrt die Frage eines tieferen Interesses, da irgendwelche geistigen Zusammenhänge zwischen Marx und Stirner nicht bestanden haben. Um so stärker ist der Einfluß gewesen, den die geistig hervorragendsten Mitglieder des Doktorklubs auf Marx gehabt haben: Bruno Bauer, der Privatdozent an der Berliner Universität, und Karl Friedrich Köppen, der Lehrer an der Dorotheenstädtischen Realschule war.
Karl Marx zählte kaum zwanzig Jahre, als er sich dem Doktorklub anschloß, aber wie so oft in seinem späteren Leben, wenn er in einen neuen Kreis eintrat, wurde er der belebende Mittelpunkt. Auch Bauer und Köppen, die ihm um etwa zehn Lebensjahre voraus waren, haben in ihm früh die geistig überlegene Kraft erkannt und sich keinen lieberen Kampfgefährten ersehnt als diesen Jüngling, der doch noch viel von ihnen lernen konnte und auch gelernt hat. »Seinem Freunde Karl Heinrich Marx aus Trier« widmete Köppen die ungestüme Kampfschrift, die er im Jahre 1840 zum hundertsten Geburtstage des Königs Friedrich von Preußen veröffentlichte.
Köppen besaß historisches Talent in ungewöhnlich hohem Maße, wovon heute noch seine Beiträge in den »Hallischen Jahrbüchern« zeugen; ihm verdanken wir die erste wirklich geschichtliche Würdigung der roten Schreckenszeit in der großen französischen Revolution. Er wußte die Träger der zeitgenössischen Geschichtsschreibung, die Leo, Ranke, Raumer, Schlosser, der glücklichsten und treffendsten Kritik zu unterziehen. Er selbst hat sich auf den mannigfachsten Gebieten geschichtlicher Forschung versucht, von einer Literarischen Einleitung in die nordische Mythologie, die sich neben die Forschungen Jacob Grimms und Ludwig Uhlands stellen durfte, bis zu einem großen Werk über Buddha, das selbst die Anerkennung Schopenhauers fand, der dem alten Hegelianer sonst nicht grün war. Wenn nun ein Kopf wie Köppen, den ärgsten Despoten der preußischen Geschichte als »wiedergeborenen Geist« herbeiwünschte, um »alle Widersacher, die uns den Eintritt ins Land der Verheißung verwehren, mit flammendem Schwerte zu vertilgen«, so wird man dadurch am schnellsten in die eigentümliche Umwelt versetzt, in der diese Berliner Junghegelianer lebten.
Man darf dabei gewiß zweierlei nicht übersehen. Die romantische Reaktion und alles was ihr anhing, arbeitete mit aller Kraft daran, das Andenken des alten Fritz anzuschwärzen. Es war, wie Köppen meinte, eine »greuliche Katzenmusik: alt- und neutestamentliche Trompeten, moralische Maultrommeln, erbauliche Dudelsäcke, historische Sackpfeifen und andere Schnurrpfeifereien, dazwischen Freiheitshymnen, gebrüllt in urteutonischem Bierbaß«. Ferner aber gab es noch keine kritisch-wissenschaftliche Untersuchung, die dem Leben und den Taten des preußischen Königs einigermaßen gerecht geworden wäre, und konnte es noch nicht geben, da die entscheidend wichtigen Quellen zu seiner Geschichte noch nicht eröffnet waren. Er stand in dem Rufe einer »Aufklärung«, um derentwillen ihn die einen haßten und die andern bewunderten.
In der Tat wollte Köppen mit seiner Schrift wieder der Aufklärung des achtzehnten Jahrhunderts aufhelfen; Ruge sagte von Bauer, Köppen und Marx, ihr Kennzeichen sei die Anknüpfung an die bürgerliche Aufklärung; sie schrieben, eine philosophische Bergpartei, das Mene Mene Tekel Upharsin an den deutschen Gewitterhimmel. Köppen wies die »schalen Deklamationen« gegen die Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts zurück; trotz ihrer Langweiligkeit verdankten wir den deutschen Aufklärern sehr viel; ihr Mangel sei nur gewesen, daß sie nicht aufgeklärt genug gewesen seien. Das gab Köppen vornehmlich den gedankenlosen Nachbetern Hegels zu bedenken, »den einsamen Büßern des Begriffs«, den »alten Brahmanen der Logik«, die, mit untergeschlagenen Beinen in ewiger Ruhe dasitzend, mit eintönigem Geschnarr die heiligen drei Vedas wieder und wieder läsen und nur dann und wann einen lüsternen Blick hinüberwürfen in die tanzende Bajaderenwelt. In dem Organ der Althegelianer wies denn auch Varnhagen die Schrift Köppens als »ekelhaft« und »widerwärtig« zurück; er mochte sich noch besonders getroffen fühlen durch die derben Worte Köppens über die »Kröten des Sumpfs«, jenes Gewürm ohne Religion, ohne Vaterland, ohne Überzeugung, ohne Gewissen, ohne Herz, ohne Wärme und Kälte, ohne Freude und Schmerz, ohne Liebe und Haß, ohne Gott und Teufel, jene Elenden, die vor den Toren der Hölle umherirrten und selbst für diese zu schlecht seien.
Köppen feierte den »großen König« nur als »großen Philosophen«. Allein dabei geriet er doch tiefer in die Brüche, als selbst nach dem Stande der damaligen Erkenntnis erlaubt war. Er meinte: »Friedrich hatte nicht wie Kant, eine doppelte Vernunft, eine theoretische, die ziemlich aufrichtig und keck mit ihren Bedenklichkeiten und Zweifeln und Negationen hervortritt, und eine praktische, vormundschaftliche, öffentlich angestellte, die wieder gut macht, was jene gesündigt hat und deren Studentenstreiche vertuscht. Nur die schülerhafteste Unreife kann behaupten, daß seine philosophisch-theoretische Vernunft der königlich-praktischen gegenüber als sehr transzendent erscheine, und daß der alte Fritz sich oft des Einsiedlers von Sanssouci wenig erinnert habe. Nie ist vielmehr in ihm der König hinter dem Philosophen zurückgeblieben.« Heute würde jeder, der diese Behauptung Köppens zu wiederholen wagte, sich selbst bei der preußischen Geschichtsschreibung den Vorwurf der schülerhaftesten Unreife zuziehen, aber auch für das Jahr 1840 war es doch schon ein starkes Stück, das aufklärende Lebenswerk eines Mannes wie Kant, unter die aufklärerischen Scherze zu stellen, die der borussische Despot mit den französischen Schöngeistern getrieben hatte, die sich zu seinen Hofnarren hergaben.
Was sich darin kundgab, war die absonderliche Dürftigkeit und Leere des Berliner Lebens, die den dortigen Junghegelianern überhaupt verhängnisvoll geworden ist. Gerade an Köppen, der sich ihrer schließlich noch am ehesten erwehren sollte, trat sie am auffallendsten hervor, zumal in einer Kampfschrift, die mit dem ganzen Herzen geschrieben war. In Berlin fehlte noch der kräftige Rückhalt, den die schon reich entwickelte Industrie der Rheinlande dem bürgerlichen Selbstbewußtsein bot, aber nicht nur hinter Köln, sondern auch hinter Leipzig und selbst Königsberg trat die preußische Hauptstadt zurück, sobald der Kampf der Zeit praktisch zu werden begann. »Sie glauben ungeheuer frei zu sein«, schrieb der Ostpreuße Walesrode von den damaligen Berlinern, »wenn sie Cerf, die Hagen, den König, die Tagesereignisse usw. usw., in den Kaffeehäusern bewitzeln, auf Eckenstehermanier, in der bekannten Tonart.« Berlin war erst eine Militär- und Residenzstadt, deren kleinbürgerliche Bevölkerung sich durch ein boshaft-kleinliches Mundwerk für die feige Unterwürfigkeit entschädigte, die sie öffentlich vor jeder Hofequipage bekundete. Eine rechte Stätte dieser Opposition war der Klatschsalon desselben Varnhagen, der sich schon vor der friderizianischen Aufklärung bekreuzigte, so wie Köppen sie verstand.
Es liegt kein Grund vor, daran zu zweifeln, daß der junge Marx die Auffassungen der Schrift geteilt hat, die seinen Namen der Öffentlichkeit zuerst in ehrenvoller Weise nannte. Er stand mit Köppen im nächsten Verkehr und hat viel von der schriftstellerischen Art des älteren Kameraden übernommen. Auch sind sie gute Freunde geblieben, obgleich sich ihre Lebenswege schnell trennten; als Marx zwanzig Jahre später einen Besuch in Berlin abstattete, fand er in Köppen »ganz den alten«, und sie feierten frohe Stunden eines ungetrübten Wiedersehens. Nicht lange darauf, im Jahre 1863, ist Köppen gestorben.
3. Die Philosophie des Selbstbewußtseins
Das eigentliche Haupt der Berliner Junghegelianer war jedoch nicht Köppen, sondern Bruno Bauer. Als berufener Schüler des Meisters wurde er auch anerkannt, zumal als er sich mit spekulativem Hochmut gegen das schwäbische »Leben Jesu« erklärt und sich von Strauß eine derbe Abfuhr geholt hatte. Der Kultusminister Altenstein hielt seine schützende Hand über dieser hoffnungsvollen Kraft. Bei alledem war Bruno Bauer kein Streber, und Strauß hatte schlecht prophezeit, als er ihn bei der »verknöcherten Scholastik« des orthodoxen Häuptlings Hengstenberg landen sah. Vielmehr geriet Bauer im Sommer 1839 mit Hengstenberg, der den alttestamentarischen Gott der Rache und des Zornes zum Gotte des Christentums erheben wollte, in eine literarische Fehde, die sich zwar noch in den Grenzen einer akademischen Streitfrage hielt, aber doch den altersschwachen und schwer geängstigten Altenstein veranlaßte, seinen Schützling den argwöhnischen Blicken der so rachsüchtigen wie rechtgläubigen Orthodoxie zu entziehen. Er sandte Bruno Bauer im Herbst 1839 an die Universität Bonn, zunächst als Privatdozenten, aber mit der Absicht, ihn binnen Jahresfrist als Professor anzustellen.
Um diese Zeit war Bruno Bauer aber schon, wie namentlich aus seinen Briefen an Marx hervorgeht, mitten in einer geistigen Entwicklung, die ihn weit über Strauß hinausführen sollte. Er begann eine »Evangelienkritik«, die ihn dazu führte, mit den letzten Trümmern aufzuräumen, die Strauß noch erhalten hatte. Bruno Bauer wies nach, daß auch nicht ein einziges geschichtliches Atom in den Evangelien enthalten, daß alles in ihnen freie schriftstellerische Tätigkeit der Evangelisten sei; er wies nach, daß die christliche Religion als Weltreligion der antiken, der griechisch-römischen Welt nicht aufgedrängt worden, sondern das eigenste Produkt dieser Welt sei. Er schlug damit den einzigen Weg ein, auf dem die Entstehung des Christentums wissenschaftlich erforscht werden konnte. Es hat schon seinen guten Sinn, wenn der Hof-, Mode- und Salontheologe Harnack, der gegenwärtig im Interesse der herrschenden Klassen die Evangelien zurechtmacht, kürzlich das Fortschreiten auf dem Wege, den Bruno Bauer eröffnet hat, als »miserabel« zu beschimpfen suchte.
Während diese Gedanken in Bruno Bauer zu reifen begannen, war Karl Marx sein unzertrennlicher Gefährte, und Bauer selbst sah in dem um neun Jahre jüngeren Freunde den fähigsten Kampfgenossen. Er war kaum in Bonn warm geworden, als er Marx durch sehnsüchtige Briefe nachzulocken suchte. Ein Professorenklub in Bonn sei die »reine Philisterei« gegenüber dem Berliner Doktorklub, durch den doch immer ein geistiges Interesse gegangen sei; er lache auch viel in Bonn, was man so lachen nenne, aber so habe er noch nie wieder gelacht wie in Berlin, wenn er mit Marx nur über die Straße gegangen sei. Marx möge doch nur mit dem »lumpigen Examen« fertig werden, für das nur Aristoteles, Spinoza, Leibniz und weiter nichts erforderlich sei; er solle doch aufhören, einen solchen Unsinn, eine bloße Farce saumselig zu behandeln. Mit den Bonner Philosophen werde er leichtes Spiel haben; unaufschiebbar sei aber vor allem eine radikale Zeitschrift, die sie gemeinsam herausgeben müßten. Das Berliner Gewäsch und die Mattigkeit der »Hallischen Jahrbücher« seien nicht mehr zu ertragen; Ruge tue ihm leid, aber weshalb jage er das Gewürm nicht aus seinem Blatt heraus?