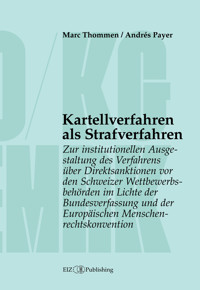
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: buch & netz
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Seit 2023 ist eine institutionelle Reform der Schweizer Wettbewerbsbehörden im Gange. Eine dafür eingesetzte Expertenkommission ist zum Schluss gekommen, dass ein Systemwechsel nicht angezeigt sei, und hat kleinere Änderungen vorgeschlagen. Die vorliegende Studie gelangt zu einem anderen Ergebnis. Sie nimmt eine spezifisch strafprozessuale Perspektive ein und arbeitet heraus, dass das Kartellverfahren über Direktsanktionen sowohl gegenwärtig als auch nach dem Vorschlag der Expertenkommission den Anforderungen der Bundesverfassung und der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht genügt. Auf dieser Grundlage werden Reformvorschläge entwickelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kartellverfahren als Strafverfahren Copyright © by Marc Thommen und Andrés Payer is licensed under a Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Keine Bearbeitung 4.0 International, except where otherwise noted.
© 2024 – CC BY-NC-ND (Werk), CC BY-SA (Text)
Autor: Marc Thommen, Andrés PayerVerlag: EIZ Publishing (eizpublishing.ch)Produktion, Satz & Vertrieb: buch & netz (buchundnetz.com)ISBN:978-3-03805-739-0 (Print – Softcover)978-3-03805-740-6 (Print – Hardcover)978-3-03805-741-3 (PDF)978-3-03805-742-0 (ePub)DOI:https://doi.org/10.36862/eiz-740Version: 1.02 – 20241024
Das Werk ist als gedrucktes Buch und als Open-Access-Publikation in verschiedenen digitalen Formaten verfügbar: https://eizpublishing.ch/publikationen/kartellverfahren-als-strafverfahren/.
Vorwort
Die vorliegende Monografie ist aus einem Rechtsgutachten für den Think Tank Fairer Wettbewerb hervorgegangen. Stand der berücksichtigten Quellen ist der 31. August 2024. Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Auftraggebers, dem an dieser Stelle nochmals gedankt sei. Ein besonderer Dank gilt schliesslich Prof. Dr. iur. Tobias Jaag, LL.M., für seine wertvollen Hinweise.
Zürich/Berlin, im Oktober 2024 Marc Thommen/Andrés Payer
Zusammenfassung
I. Einleitung: Diese Untersuchung zeigt auf, dass die institutionelle Ausgestaltung der schweizerischen Wettbewerbsbehörden und das geltende sowie das von der Expertenkommission vorgeschlagene wettbewerbsrechtliche Direktsanktionsverfahren mit den Vorgaben der Europäischen Menschenrechtskonvention, der Bundesverfassung und den Maximen des Strafprozessrechts nicht in Einklang stehen.
II. Am heutigen Verfahren wird in der Politik, Wirtschaft, Praxis und Lehre kritisiert, dass Untersuchung und Entscheid nicht hinreichend institutionell getrennt seien und dass die WEKO nicht unabhängig sei. In verfahrensrechtlicher Hinsicht wird bemängelt, dass das Gerichtsverfahren zu lange, zu teuer und nicht ergebnisoffen, sondern durch die WEKO-Verfügung vorgezeichnet sei. Es wird deshalb ein unabhängiges Wettbewerbsgericht gefordert.
III. Die Expertenkommission vertritt hingegen die Auffassung, dass Untersuchungs- und Entscheidungsfunktion nicht zwingend zu trennen sind. Es sei zulässig, dass der Sanktionsentscheid erstinstanzlich durch eine Verwaltungsbehörde wie die WEKO gefällt werde, soweit der Weg an ein Gericht offenstehe, das die Vorwürfe tatsächlich und rechtlich frei überprüfe. Sie schlägt deshalb ein «Status quo optimiert»-Modell vor, dass auf den bestehenden Institutionen aufbaut. Dabei sollen die WEKO und ihr Sekretariat institutionell entflechtet werden. So soll das WEKO-Präsidium etwa künftig nicht länger an Untersuchungseröffnungen mitwirken müssen. Der fehlenden Unabhängigkeit soll unter anderem dadurch begegnet werden, dass künftig keine Vertreter von Interessenverbänden mehr in der WEKO einsitzen. Verfahrensrechtlich sollen die Parteien über ein «Statement of Objection» früher Einfluss nehmen können und die Einhaltung der Verfahrensrechte von einem «Hearing Officer» überwacht werden. Ferner sollen nebenamtliche Richter mit Spezialkenntnissen im Wettbewerbsrecht ans Bundesverwaltungsgericht gewählt werden.
IV. Bevor das geltende und das vorgeschlagene Verfahren kritisch gewürdigt werden können, werden als Erstes die Vorgaben der Konvention und der Verfassung analysiert. Kartellrechtliche Direktsanktionen sind Strafen im Sinne der EMRK (A.). Die strafrechtlichen Garantien der Konvention kommen daher zur Anwendung, und zwar – entgegen der Expertenkommission – in vollem Umfang (B.). Nach ständiger Rechtsprechung seit De Cubber dürfen Strafen erstinstanzlich nur durch ein unabhängiges und unparteiisches Gericht verhängt werden. Davon hat der Gerichtshof in Öztürk insofern eine Ausnahme formuliert, als in grosser Zahl vorkommende, tarifartig sanktionierbare Bagatellstraftaten zunächst durch Verwaltungsbehörden beurteilt werden dürfen, soweit solche Verfügungen freier gerichtlicher Überprüfung zugeführt werden können. In Menarini hat der Gerichtshof diese Ausnahme ohne Begründung auf kartellrechtliche Direktsanktionen ausgedehnt. An diese Rechtsprechung hat sich das Bundesgericht im Publigroupe-Entscheid angelehnt (C.). Bei Deals ist die Rechtsprechung strenger. Nach Natsvlishvili sind Verurteilungen, die auf einer Absprache basieren, erstinstanzlich zwingend durch ein Gericht zu erlassen (D.).
V. Als zweite Vorfrage zur inhaltlichen Kritik wird das Kartellverfahren als Strafverfahren analysiert. Das ordentliche wettbewerbsrechtliche Verfahren ist strukturell als Strafbefehlsverfahren einzustufen. Vereinfacht fungieren die WEKO als Staatsanwaltschaft, ihr Sekretariat als Polizei und das Bundesverwaltungsgericht als erstinstanzliches Gericht. Unterschiede bestehen bei der Entscheidmacht: Während der Sanktionsspielraum der Staatsanwaltschaft bei sechs Monaten Freiheitsstrafe gekappt ist, kann die WEKO sämtliche Direktsanktionen verfügen. Die Begründung erfolgt nicht durch die Erlassbehörde (WEKO), sondern die Polizei (Sekretariat). Im Gegensatz zum Strafbefehl hat der Adressat zwar nicht nur zehn, sondern 30 Tage Zeit, um eine gerichtliche Beurteilung zu verlangen, er muss dafür aber zusätzlich Kosten vorschiessen und seine Beschwerde begründen. Eine Berufung gibt es im Kartellverfahren nicht.
Die einvernehmliche Regelung (Art. 29 KG) ist schwierig einzuordnen. Aufgrund des Deals hat sie Ähnlichkeiten mit abgekürzten Verfahren (Art. 358 ff. StPO). Da es bei der einvernehmlichen Regelung eigentlich nicht um eine Sanktionierung des Unternehmens, sondern um Massnahmen zur Beseitigung der Wettbewerbsbeschränkung geht, zeigt sich die Nähe zum Vergleich (Art. 316 Abs. 2 StPO) und zur Wiedergutmachung (Art. 53 StGB). Soweit eine Sanktionierung im Raum steht, ist nach Natsvlishvili die Verhängung durch ein Gericht zwingend. Soweit es um die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands geht, ist die geltende Regelung nur insoweit fragwürdig, als der Vergleich durch das Sekretariat (Polizei) und nicht die WEKO (Staatsanwaltschaft) selbst ausgehandelt wird.
VI. Die Kritik des heutigen Verfahrens ergibt sich nach Klärung dieser beiden Vorfragen (Vorgaben Konvention und Strafprozess) von selbst. Auf eine gerichtliche Erstinstanz kann nach Öztürk nur verzichtet werden, wenn es um geringfügige (1.) Massendelikte (2.) geht, die tarifartig (3.) und ohne Stigma (4.) sanktionierbar sind (Strassenverkehr). Keine dieser vier Voraussetzungen trifft auf kartellrechtliche Direktsanktionen zu. Das zeigt sich nur schon an den Zahlen: Während allein in der Stadt Zürich 900’000 Ordnungsbussen zu maximal 250.– Franken pro Jahr verhängt werden, erlässt die WEKO weniger als vier Sanktionsverfügungen pro Jahr, deren Sanktionen aber bis in den neunstelligen Bereich reichen. Das hat der Gerichtshof verkannt, als er in Menarini die Öztürk-Rechtsprechung auf Kartellsanktionen angewandt hat. Auch historische Erwägungen sprechen gegen Menarini. Wie bereits die Inquisitoren sind wohl auch die Wettbewerbsbehörden von der Dreifach-Rolle des Ermittlers, Anklägers und Entscheiders überfordert. Je länger und aufwendiger Untersuchungen sind, desto unwahrscheinlicher wird ein ergebnisoffener Entscheid. Es braucht daher eine gerichtliche Erstinstanz (A.).
Menarini überzeugt auch nicht, soweit das Urteil das Erfordernis einer «pleine juridiction» zu konkretisieren versucht. Es lässt in casu eine unvollkommene Kontrolle genügen und verletzt damit etablierte Mindestgarantien. Nimmt man die Voraussetzung einer «pleine juridiction» ernst, ist sie vor Bundesverwaltungsgericht nicht erfüllt: Das Bundesverwaltungsgericht ist seiner DNA nach eine Rechtsmittelbehörde und kein erstinstanzliches Sachgericht. Zwar kann es de iure frei überprüfen, de facto hält es sich aber stark zurück, indem es praktisch keine eigenen Sachverhaltserhebungen macht, Rüge- und Begründungspflichten gelten und es der WEKO ein technisches Ermessen einräumt. Das wäre im Strafprozess undenkbar. Man stelle sich ein Strafgericht vor, das einen Strafbefehl nur zurückhaltend überprüft, mit der Begründung, dass die eigentliche Fachkompetenz bei der Staatsanwaltschaft liege. Weiter ist die Überprüfbarkeit der Sanktion unzureichend. Auch darüber hinaus fehlen die vom EGMR geforderten «minimum safeguards» für einen Verzicht auf ein Gericht: Der Zugang zum Bundesverwaltungsgericht ist nicht frei, sondern mit Kosten- und Begründungshürden gepflastert. Angesichts dieser Zugangs- und Prüfungshürden erweist sich das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht (B.) insgesamt als weder «practical» noch «effective».
Diese Bedenken gelten erst recht für die einvernehmliche Regelung (C.), die vom Sekretariat ausgehandelt und von der WEKO abgesegnet wird. Der Strafprozess kennt keine Absprache, die von der Polizei ausgehandelt und von der Staatsanwaltschaft zum Entscheid erhoben werden kann. Vielmehr ist nach Natsvlishvili bei Deals ein Verzicht ausgeschlossen. Es braucht zwingend eine gerichtliche Erstentscheidung bzw. Überprüfung und Absegnung des Deals.
Auch weitere Verfahrensrechte (D.) sind im heutigen Verfahren bedroht. So verletzt etwa die Bekanntmachung des Untersuchungsadressaten die Unschuldsvermutung. Die Selbstbelastungsfreiheit wird nicht vollständig beachtet, indem etwa auch Mitarbeiter zur Aussage verpflichtet werden, deren Handlungen dem Unternehmen zugerechnet werden. Die Zugangs- und Begründungshürden im Rechtsmittelverfahren sowie das der WEKO eingeräumte technische Ermessen führen faktisch dazu, dass eine Schuldvermutung zulasten der Unternehmen besteht, gegen die vor Gericht angekämpft werden muss. Angesichts der sehr langen Verfahren wird oft auch das Beschleunigungsgebot verletzt.
VII. In der Kritik des vorgeschlagenen Verfahrens wird zunächst aufgezeigt, dass im Bericht der Expertenkommission bereits die Methodik (A.) angreifbar ist, weil mit dem Implementierungsaufwand und der Systemkohärenz zwei «objektive» Bewertungskriterien vorangestellt werden, die das Resultat präjudizieren. Mit der Drohkulisse des Umsetzungsaufwands lässt sich so der Status quo (vermeintlich) legitimieren. Auch bei den übrigen Kritikpunkten zeigt sich, dass die als «Status quo optimiert» postulierten Neuerungen eher kosmetischer Natur sind. Eine gerichtliche Erstinstanz (B.) wird nicht geschaffen. Die Einführung des Gerichtsmodells im Kartellverfahren hätte jedoch keine Präjudizwirkung für andere verwaltungsrechtliche Sanktionsverfahren, da das Kartellverfahren Besonderheiten aufweist, die ihm auch der Expertenbericht attestiert. Auch die Einsetzung von nebenamtlichen Fachrichtern ändert nichts daran, dass das Bundesverwaltungsgericht (C.) seiner DNA nach ein kognitionsbeschränktes Rechtsmittelgericht bleibt. Bei der einvernehmlichen Regelung (D.) wurde die Notwendigkeit einer gerichtlichen Absegnung von den Experten schlicht übersehen. Für die Verfahrensrechte (E.) schliesslich gilt: Das vorgeschlagene Statement of Objection ist zu begrüssen. Der Hearing Officer ist ein strafprozessualer Fremdkörper. Die explizite Statuierung der Unschuldsvermutung, die im aktuellen Entwurf des Kartellgesetzes vorgesehen ist, bleibt ein reines Lippenbekenntnis, solange die Sanktionierungen keiner «pleine juridiction» unterstellt werden.
VIII. Als eigener Vorschlag wird deshalb ein Modell skizziert, in dem ein erstinstanzliches Sachgericht die Direktsanktionen verhängt und die einvernehmlichen Regelungen genehmigt. Damit stünden die Direktsanktionen institutionell und verfahrensrechtlich mit den Vorgaben der Konvention, der Bundesverfassung und den Maximen des Strafprozesses im Einklang. Auch dürfte dies die Akzeptanz der Entscheide fördern. Die beste Lösung besteht darin, das Sekretariat als Untersuchungsbehörde, die WEKO als Anklagebehörde, ein neues Bundeswettbewerbsgericht als erstinstanzliche Entscheidbehörde und das Bundesverwaltungsgericht als Berufungsinstanz vorzusehen. Mit Blick auf die Verfahrensbeschleunigung und den Sachverstand wäre auch eine schlankere Lösung denkbar, in der das Sekretariat zu einer eigenständigen Untersuchungs- und Anklagebehörde ausgebaut und die WEKO zu einem personell und institutionell unabhängigen Gericht umfunktioniert wird. Die beiden Behörden müssten dazu jedoch örtlich und personell strikt getrennt werden. Auch hier könnte das Bundesverwaltungsgericht als Berufungsinstanz fungieren.
Inhaltsverzeichnis
1
Einleitung
Nachfolgend wird die gesetzgeberische Ausgangslage dargestellt (A.), die Zielsetzung dieser Untersuchung erklärt (B.), die sich daraus ergebende Eingrenzung beschrieben (C.) und der Aufbau der Untersuchung vorgestellt (D.).
Ausgangslage
Am 24. November 2021 schickte der Bundesrat einen Vorentwurf zur Teilrevision des Kartellgesetzes (KG) in die Vernehmlassung.[1] Hauptziele der Revision waren die Modernisierung der Zusammenschlusskontrolle, die Stärkung des Kartellzivilrechts und die Verbesserung des Widerspruchsverfahrens.[2] Nachdem die Kartellgesetzrevision von 2012 zu einem entscheidenden Teil an der institutionellen Reform der Wettbewerbsbehörden gescheitert war,[3] verzichtete der Bundesrat im Vorentwurf von 2021 darauf, grundlegende Neuerungen in der Organisation und Struktur der Wettbewerbsbehörden vorzuschlagen.[4]
In der Vernehmlassung fielen die Stellungnahmen zu den Hauptpunkten der Revision vorwiegend positiv aus. Doch forderten zahlreiche Vernehmlassungsteilnehmer eine institutionelle Reform der Wettbewerbsbehörden (Wettbewerbskommission und ihr Sekretariat), obwohl diese nicht Gegenstand der Vernehmlassungsvorlage war.[5]
In der Folge beschloss der Bundesrat am 17. März 2023, getrennt von der Teilrevision des KG eine Institutionenreform in Angriff zu nehmen, und beauftragte das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF), ihm im ersten Quartal 2024 einen Vorschlag für eine entsprechende Reform zu unterbreiten.[6]
Am 1. Mai 2023 setzte sodann das WBF eine Expertenkommission mit folgendem Auftrag ein:[7]
«Die Expertenkommission erstellt die notwendigen Grundlagen für die Erarbeitung einer sachlich fundierten und breit abgestützten Reform der Schweizer Wettbewerbsbehörden. Sie bewertet konkrete Modelle für die Ausgestaltung der Behörden mit Blick auf die Verfahrensdauer, den wirksamen Schutz des Wettbewerbs und die Vereinbarkeit mit der Bundesverfassung sowie der Europäischen Menschenrechtskonvention. Sie arbeitet unabhängig von der Bundesverwaltung und wird die Anliegen und Einschätzungen verschiedener Anspruchsgruppen umfassend berücksichtigen.»
Die «Expertenkommission Reform Wettbewerbsbehörden» (im Folgenden: «Expertenkommission») führte umfangreiche rechts- und institutionenvergleichende Untersuchungen, Expertenbefragungen und Anhörungen verschiedener Akteure durch. Am 1. Dezember 2023 legte sie dem Bundesrat ihren Schlussbericht vor (im Folgenden: «Expertenbericht»), in dem sie einen Systemwechsel als nicht angezeigt erachtet und einen «Status quo optimiert» vorschlägt.[8]
Auf der Grundlage dieses Berichts beauftragte der Bundesrat das WBF am 15. März 2024, die Reform der Wettbewerbsbehörden nach den Empfehlungen der Expertenkommission an die Hand zu nehmen und ihm bis Mitte 2025 eine Vernehmlassungsvorlage vorzulegen. Gleichentags wurde auch der Expertenbericht veröffentlicht.[9]
Zielsetzung
Im Folgenden sollen die Praxis und Zusammensetzung der Wettbewerbsbehörden unter den Gesichtspunkten der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), Bundesverfassung (BV) und insbesondere der Maximen des Strafprozessrechts analysiert werden. Dabei sollen nach Möglichkeit Vorschläge für eine Optimierung von wettbewerbsrechtlichen Verfahren gemacht werden.
Im Zentrum der Analyse soll das Verfahren über Direktsanktionen (Art. 49a i.V.m. Art. 5, Art. 7 KG) stehen. Es soll untersucht werden, ob bzw. inwieweit dieses heute und nach dem Vorschlag der Expertenkommission («Status quo optimiert») mit der BV, der EMRK und den daraus abgeleiteten strafrechtlichen bzw. strafprozessualen Grundsätzen vereinbar ist. Die Untersuchung soll andernfalls auch ein Alternativmodell aufzeigen.
Eingrenzung
Ausgeblendet werden im Folgenden insbesondere das Kartellzivilrecht, die Unternehmenszusammenschlüsse, die weiteren Strafbestimmungen,[10] die Zwangsmassnahmen, der Rechtsvergleich und die Frage der Rechtsform der Wettbewerbsbehörden (z.B. öffentlich-rechtliche Anstalt oder unabhängige Verwaltungseinheit ohne Rechtspersönlichkeit).
Weitere mögliche Defizite des Kartellverfahrens in Bezug auf strafprozessuale Garantien, die nicht unmittelbar mit der institutionellen Ausgestaltung zusammenhängen (z.B. Unschuldsvermutung, Nemo-tenetur-Grundsatz, Verfahrensdauer), sollen nur kurz angesprochen, aber nicht vertieft erörtert werden.
Nicht näher untersucht werden die Vorgaben aus anderen Rechtsquellen wie dem Internationalen Pakt über die bürgerlichen und politischen Rechte (UNO-Pakt II).[11]
Gang der Untersuchung
Die Untersuchung gliedert sich in acht Teile. Diesem einleitenden Teil (I. Teil) folgt eine ausführliche Darstellung zunächst des geltenden Verfahrens und der daran geübten Kritik (II. Teil), sodann des von der Expertenkommission vorgeschlagenen neuen Verfahrens und der dafür massgeblichen Erwägungen (III. Teil). Anschliessend werden die Vorgaben der EMRK und der BV herausgearbeitet, wobei Ausgangspunkt der Befund bilden wird, dass kartellrechtliche Direktsanktionen nach EMRK Strafen sind (IV. Teil). Aus diesem Grund soll das Kartellverfahren aus einer spezifisch strafprozessualen Warte betrachtet werden, dies im Unterschied zum Expertenbericht, der das Kartellverfahren hauptsächlich aus verwaltungsrechtlicher Perspektive analysiert und weiterentwickelt hat. Dazu werden zunächst die verschiedenen schweizerischen Strafverfahrensarten dargestellt und sodann anhand des kartellrechtlichen Sanktionsverfahrens Parallelen gezogen (V. Teil). Auf dieser Grundlage können anschliessend sowohl das geltende als auch das vorgeschlagene Kartellverfahren einer strafprozessualen Kritik unterzogen werden (VI. bzw. VII. Teil). Die Untersuchung wird dabei zum Ergebnis kommen, dass beide Verfahren den Vorgaben der EMRK und der BV sowie den Maximen des Strafprozessrechts nicht genügen. Abschliessend wird ein eigener Lösungsvorschlag skizziert (VIII. Teil).
2
Heutiges Verfahren
Im Folgenden wird zunächst die gegenwärtige institutionelle Ausgestaltung des Kartellverfahrens im Allgemeinen und im Hinblick auf Sanktionsverfahren nach Art. 49a KG im Besonderen beschrieben (A.), bevor die daran geübte Kritik der unzureichenden Trennung von Untersuchungs- und Entscheidungsfunktion (B.), der mangelnden Unabhängigkeit der WEKO (C.) und der Missachtung weiterer Verfahrensrechte (D.) dargestellt wird.
Beschreibung
Nach geltendem Recht obliegt die Durchführung der verwaltungsrechtlichen Kartellrechtsverfahren (Art. 18 ff. KG) der Wettbewerbskommission (WEKO) und ihrem Sekretariat.[1] Diese Verfahren umfassen primär die Beurteilung unzulässiger Wettbewerbsbeschränkungen (Art. 5, Art. 7 KG),[2] daneben insbesondere die Prüfung von Unternehmenszusammenschlüssen (Fusionen; Art. 9 f. KG).[3]
Die WEKO ist als Behördenkommission (Art. 57a Abs. 2 RVOG) mit 11–15 Mitgliedern ausgestaltet, die vom Bundesrat gewählt werden (Art. 18 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 KG). Die Mehrheit der Mitglieder muss aus unabhängigen Sachverständigen bestehen (Art. 18 Abs. 2 Satz 2 KG), die übrigen Mitglieder sind aus historischen Gründen Vertreter von Interessenorganisationen. Der Bundesrat bezeichnet die Mitglieder, die zusammen das Präsidium bilden (Art. 18 Abs. 1 KG). Gegenwärtig ist die Kommission aus zwölf Mitgliedern zusammengesetzt, von denen fünf Interessenverbände vertreten und drei das Präsidium bilden.[4]
Die WEKO ist zwar administrativ dem WBF zugeordnet (Art. 19 Abs. 2 KG), von der Konzeption her aber von den anderen Verwaltungsbehörden unabhängig (Art. 19 Abs. 1 KG). Sie kennt heute zwei Kammern, eine für Teilverfügungen und eine für Unternehmenszusammenschlüsse.[5] Die WEKO ist eine Milizbehörde.[6]
Die WEKO verfügt über ein Sekretariat, dessen Hauptaufgabe es ist, die Geschäfte vorzubereiten, die Untersuchungen zu führen und – jeweils zusammen mit einem Mitglied des Präsidiums – die erforderlichen prozessleitenden Verfügungen zu erlassen (Art. 23 Abs. 1 Satz 1 KG). Das Sekretariat verkehrt direkt mit den Beteiligten und Dritten (Art. 23 Abs. 1 Satz 3 KG), stellt Anträge an die WEKO und vollzieht deren Entscheide (Art. 23 Abs. 1 Satz 2 KG).
Das Sekretariat besteht aus der Direktion, die vom Bundesrat gewählt wird, und dem übrigen Personal, das von der Kommission gewählt wird (Art. 24 Abs. 1 KG). Derzeit besteht die Direktion aus fünf Mitgliedern. Ende 2023 beschäftigte das Sekretariat 73 Personen (ohne Praktikanten).[7]
Die Geschäftsführung des Sekretariats wird von der Präsidentin der WEKO beaufsichtigt (Art. 28 Abs. 1 lit. e Geschäftsreglement der WEKO [GR-WEKO]), die auch für die Koordination zwischen WEKO und Sekretariat und die Information der Kommission über die Tätigkeiten des Sekretariats zuständig ist (Art. 28 Abs. 1 lit. a und d GR-WEKO). Zudem ist die Präsidentin hauptverantwortlich für den Entscheid, welche der eröffneten Untersuchungen vorrangig zu behandeln sind (Art. 28 Abs. 1 lit. b GR-WEKO, Art. 27 Abs. 2 KG). Das Sekretariat erteilt den Kommissionsmitgliedern auf Verlangen Auskünfte über laufende Geschäfte, die in deren Entscheidungskompetenz fallen (Art. 31 Abs. 1 lit. e GR-WEKO), und kann mit ihnen auch ausserhalb der Sitzungen verfahrensbezogene oder sonstige Fragen besprechen (Art. 31 Abs. 1 lit. f GR-WEKO).
Wie erwähnt (Rz. 15), beurteilt die WEKO primär unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen (d.h. unzulässige Wettbewerbsabreden nach Art. 5 KG und unzulässige Verhaltensweisen marktbeherrschender und relativ marktmächtiger Unternehmen nach Art. 7 KG). Dabei kann sie zu deren Beseitigung mit den Beteiligten getroffene einvernehmliche Regelungen genehmigen (Art. 29 KG), Massnahmen anordnen (Art. 30 KG) oder Sanktionen nach Art. 49a KG – sog. direkte Sanktionen oder Direktsanktionen –[8] verhängen.[9] Gemäss dieser Bestimmung können Unternehmen, die sich an einer unzulässigen Abrede nach Art. 5 Abs. 3 und 4 KG beteiligen oder marktbeherrschend sind und sich nach Art. 7 KG unzulässig verhalten, mit einem Betrag von bis zu zehn Prozent des in den letzten drei Geschäftsjahren in der Schweiz erzielten Umsatzes belastet werden.[10]
Die WEKO hat von dieser Sanktionsmöglichkeit verschiedentlich Gebrauch gemacht und betroffene Unternehmen öfters mit Beträgen in Millionenhöhe, teilweise im neunstelligen Bereich, belastet.[11] Gemäss Angaben des Sekretariats hat die WEKO in den Jahren 2003 bis 2022 in Untersuchungen wegen Wettbewerbsbeschränkungen insgesamt 170 Verfügungen erlassen, davon 72 Entscheide mit Sanktionen nach Art. 49a KG. In rund der Hälfte der Sanktionsfälle kam es zu einvernehmlichen Regelungen, allerdings nicht immer mit allen Beteiligten. Von den 98 weiteren Verfügungen waren 18 vorsorgliche Massnahmen, 51 materielle Entscheide ohne Sanktionen und 29 andere Verfügungen (Publikation, Kosten, Einsicht usw.).[12] Umgerechnet ergibt das insgesamt 8.5 Verfügungen pro Jahr, davon 3.6 Sanktionsverfügungen.
Der Ablauf eines Verfahrens über Direktsanktionen bzw. die Verfahrensschritte lassen sich zusammenfassend wie folgt beschreiben:
1. Vorabklärung
Das Sekretariat der WEKO führt eine Vorabklärung von Amtes wegen, auf Begehren von Beteiligten oder Anzeige von Dritten hin durch (Art. 26 Abs. 1 KG). In dieser Phase besteht kein Akteneinsichtsrecht (Art. 26 Abs. 3 KG), die betroffenen Unternehmen können jedoch Stellung nehmen und Beweisanträge stellen.[13]
Hat sich der Verdacht auf einen Kartellrechtsverstoss nicht erhärtet, wird die Vorabklärung folgenlos beendet.[14] Falls hingegen (weiterhin) Anhaltspunkte für eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung vorliegen, eröffnet das Sekretariat im Einvernehmen mit einem Mitglied des WEKO-Präsidiums eine Untersuchung (Art. 27 Abs. 1 Satz 1 KG).[15] Eine Untersuchung muss eröffnet werden, wenn die WEKO oder das WBF das Sekretariat damit beauftragt (Art. 27 Abs. 1 Satz 2 KG).
2. Untersuchung
Die Eröffnung einer Untersuchung wird unter Angabe von deren Gegenstand und Adressaten amtlich veröffentlicht (Art. 28 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 KG). Während der Untersuchung haben die Parteien ein Recht auf Akteneinsicht und können weiterhin ihren Standpunkt darlegen und Beweisanträge stellen.[16]
Das Sekretariat führt die Untersuchung durch (Art. 23 Abs. 1 Satz 1 KG)[17] und eruiert den Sachverhalt,[18] wobei die Beteiligten grundsätzlich eine Auskunftspflicht trifft (Art. 40 KG) und Zeugen einvernommen sowie die Betroffenen zur Beweisaussage verpflichtet werden können (Art. 42 Abs. 1 KG, Art. 64 BZP sinngemäss). Zudem kann das Sekretariat einem Präsidiumsmitglied beantragen, Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmen anzuordnen, die das Sekretariat dann durchführt (Art. 42 Abs. 2 KG, Art. 45–50 VStrR sinngemäss).[19] Nach der Praxis des Bundesgerichts kann die WEKO auch vorsorgliche Massnahmen anordnen.[20]
Nach Abschluss der Untersuchung übersendet das Sekretariat seinen Antrag an die WEKO den Parteien zur schriftlichen Stellungnahme (Art. 30 Abs. 2 Satz 1 KG); die Präsidentin der WEKO wird mit einer Kopie des Antrags bedient. Zugleich setzt das Sekretariat den Parteien Frist, um Beweisanträge zu stellen, eine mündliche Anhörung durch die WEKO (Art. 30 Abs. 2 Satz 2 KG) oder eine terminliche Verschiebung der Anhörungen zu beantragen.[21]
Im Antrag des Sekretariats wird der ermittelte Sachverhalt dargestellt und im Lichte des KG rechtlich gewürdigt. Der Antrag kann auf Einstellung des Verfahrens, auf Genehmigung einer allfälligen einvernehmlichen Regelung (Art. 29 KG), auf bestimmte Massnahmen und/oder Sanktionen (Art. 30 bzw. 49a KG) lauten.
Nachdem die Stellungnahmen der Parteien eingegangen sind, kann das Sekretariat seinen Antrag anpassen. Es leitet den finalen Antrag, die Stellungnahmen sowie die Verfahrensakten an die WEKO weiter.[22]
3. Entscheid
Die WEKO entscheidet zunächst, ob auf den Antrag einzutreten ist bzw. die Sache entscheidreif ist. Die Parteien sind von dieser Eintretensdebatte ausgeschlossen; bei Antrag auf Sanktionen werden die Parteien jedoch in der Regel vorgängig mündlich angehört (nichtöffentliche Anhörung).[23] Die WEKO kann das Sekretariat mit weiteren Untersuchungsmassnahmen beauftragen (Art. 30 Abs. 2 Satz 2 KG).
Tritt die WEKO auf den Antrag ein, so führt sie – allenfalls nach einer mündlichen Anhörung der Parteien – die Entscheidberatung ohne die Parteien durch. Kommt sie dabei zum Schluss, dass kein Kartellrechtsverstoss vorliegt, wird das Verfahren eingestellt. Hält sie einen Verstoss für gegeben, kann sie Massnahmen und Sanktionen anordnen. Für die Beschlussfassung genügt das einfache Mehr. Das Sekretariat nimmt an der gesamten Entscheidberatung teil, sofern die Kommission keinen gegenteiligen Beschluss fasst. Seine Mitarbeiter verfassen anschliessend auch den finalen Entscheid, der von der WEKO-Präsidentin und dem Direktor des Sekretariats unterzeichnet wird (Art. 9 GR-WEKO). Der Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.[24]
In der Praxis wird, wie sich aus den Anhörungen der Expertenkommission ergeben hat, praktisch kaum je ein Antrag des Sekretariats von der WEKO grundlegend geändert, abgesehen davon, dass mitunter die Höhe der Sanktion modifiziert wird.[25]
4. Rechtsmittel
Gegen die Verfügungen der WEKO steht den Adressaten innert 30 Tagen seit der Eröffnung die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht offen (Art. 33 lit. f VGG, Art. 50 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung (Art. 55 Abs. 1 VwVG) und ist zu begründen (Art. 52 VwVG). Gerügt werden kann die Verletzung von Bundesrecht, inklusive Ermessensüberschreitung oder -missbrauch, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts oder Unangemessenheit (Art. 49 VwVG).[26] Die Beschwerde ist somit ein sog. vollkommenes Rechtsmittel.[27]
Das Bundesverwaltungsgericht setzt der Vorinstanz und allfälligen Gegenparteien Frist zur Vernehmlassung (Art. 57 Abs. 1 VwVG) und kann die Parteien auf jeder Stufe des Verfahrens zu einem weiteren Schriftenwechsel einladen oder eine mündliche Verhandlung mit ihnen anberaumen (Art. 57 Abs. 2 VwVG). Bei dieser handelt es sich um eine Instruktionsverhandlung, die insbesondere der zusätzlichen Sachverhaltsabklärung, der Konfrontation, der Verschaffung eines persönlichen Eindrucks von den Beteiligten oder der Durchführung von Vergleichsverhandlungen dient.[28]
Vor Bundesverwaltungsgericht können Beweismittel wie Zeugeneinvernahmen, Augenscheine und Parteiverhöre vorgebracht werden (vgl. Art. 39 Abs. 2 VGG). Eine öffentliche Parteiverhandlung wird angeordnet, wenn eine Partei es verlangt oder gewichtige öffentliche Interessen es rechtfertigen (Art. 40 Abs. 1 VGG).[29]





























