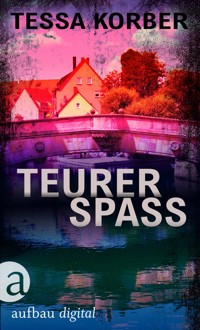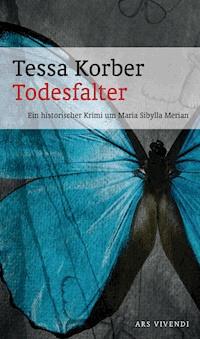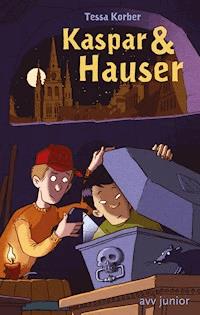
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Kaspar ist neu in Ansbach. Seine Mutter hat dort endlich einen Job gefunden, er aber vermisst das freie Leben in der Nürnberger Südstadt. In Ansbach ist er allein mit sich und seinem wiederkehrenden Traum von dem kleinen Jungen mit dem Holzpferd. Als er in der Schule ein Projekt über Kaspar Hauser übernimmt, ist Kaspar vom Schicksal seines Namensvetters fasziniert: Ist es etwa er, von dem er immer träumt? Wer ist eigentlich sein eigener Vater? Und warum ist außer ihm noch niemand auf diesen Dreh gekommen, mit dem er herausfinden will, wer dieser Kaspar Hauser wirklich war? Was er zusammen mit seinem neu gewonnenen Freund Yong-il vorhat, ist kühn und außerdem verboten …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tessa Korber
Kaspar & Hauser
ars vivendi
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (Erste Auflage April 2017)
© 2017 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Umschlaggestaltung: Markus Spang
Lektorat: Sabine Zürn
Druck: CPI books GmbH, Leck
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-86913-836-7
Inhalt
Kaspar & Co.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Die Autorin
Kaspar & Co.
Kaspar Quent
denkt sich vieles, redet aber nicht gern drüber. Er bleibt lieber unter dem Radar; seine Mutter, findet er, ist schon auffällig genug. Ihm genügt es, wenn man ihn in Ruhe lässt. Aber wenn ihn etwas umtreibt, dann hängt er sich richtig rein. Zum Beispiel in den Fall des rätselhaften Kaspar Hauser, der vor fast 200 Jahren in Ansbach gelebt hat und dessen Herkunft bis heute unbekannt ist. Damit kennt sich Kaspar aus, denn er wüsste selbst gern, wer sein Vater ist.
Jong-il
ist ein fleißiger Schüler aus Südkorea, der im Lokal seiner Mutter mitarbeitet und weiß, dass man die Familie ehren muss. Aber er hat auch seinen eigenen Kopf und einen guten Blick für echte Freunde wie Kaspar Quent.
Herr Holzbrink
hat einen siebten Sinn für interessante Menschen. In seiner Buchhandlung diskutiert er oft bei einer Tasse Tee mit Kaspar und Jong-il über Kaspar Hauser. Von sich selbst erzählt er wenig. Und irgendwann müssen die Jungs sich die Frage stellen: Kann man ihm trauen?
Julia Quent
ist Kaspars Mutter und wollte mal Rocksängerin werden. Mit ihrem Sohn hat sie ein abwechslungsreiches Leben geführt. Frühstück am Mittag, Grillen im offenen Kamin und nachts in Freibäder einbrechen. Klingt traumhaft? Kann aber auch anstrengend sein. Vor allem, wenn Mama sich partout weigert, dem Sohn zu sagen, wer sein Vater ist.
1
Eben spürte ich noch, wie unser alter Opel über die Bundesstraße rappelte. Hinter uns fuhr der Umzugslaster. Wir waren um sechs Uhr aufgestanden, um zu helfen, alles hineinzupacken. All unsere Sachen, alles in Kisten. Unser Zuhause in Nürnberg gab es nicht mehr.
Ich hielt das Navi in meinen Händen, weil die Halterung vorn an der Scheibe mal wieder kaputt war. »Achtung«, sagte die Frauenstimme aus dem Gerät. Wie jedes Mal, wenn Mama wieder zu schnell durch ein Dorf bretterte. »Achtung!« Fremde Häuser zogen vorbei, fremde Landschaften, Wiesen und Hügel.
Dann sehe ich mit einem Mal das weiße Pferd.
Ich kenne es gut. Es ist klein und aus Holz. Es ist ein Spielzeug. Mein Spielzeug.
Wie immer nehme ich voller Vorfreude den Deckel von der großen blauen Porzellanschale und greife hinein. Dann halte ich das Pferd in der Hand. Ich bin jetzt glücklich. Mein ganzer Körper fühlt sich glücklich an, aber auch fern. Und ganz leicht. Ich bin nicht sicher, ob man so leicht sein darf, nicht mal im Traum. Ja, das ist es. Ich bin glücklich. Aber sicher bin ich nicht.
Ich laufe, das Pferd in der kleinen Hand hoch erhoben. Die Umgebung ändert sich schnell. Ein Zimmer ist blau, ganz blau und golden. Ich laufe Steintreppen hinunter, dann kommt Gras. Ein Garten, fast ein Park. Ist das ein Schloss dort hinten? Auf einmal sehe ich den Jungen. Er steht unter alten Bäumen. Das Licht fällt schräg ein wie am Nachmittag und ist ganz golden. Der Junge hat helle Haare, kinderblond. Er ist klein und er blinzelt wegen der Sonne, die hinter mir steht, während ich ihn beobachte. Über einen Teich oder Bach oder Graben hinweg schaue ich ihn an. Er hat jetzt das Holzpferd. Er hält es in der Hand, ich kann es deutlich sehen. Er hält es in der Hand, mit der er seine Augen beschattet. Ein Mann ruft seinen Namen. Ich höre nur die Stimme, ohne etwas zu verstehen. Der Junge schaut mir direkt in die Augen.
Die Bremsen quietschten. Ich fiel nach vorn. Das Navi glitt mir aus der Hand. »Achtung.« Mama hatte eine ihrer typischen Vollbremsungen hingelegt. Wo waren wir?
»Könntest du dir vorstellen, dass das hier unser neues Zuhause ist?«, fragte sie.
2
Ich gähnte verschlafen, blinzelte und schaute hinaus. Wir standen vor einem modernen Häuserblock mit ganz viel Glas und Stahl. Es sah nach Büros aus. Aber nicht nach Wohnungen. Unten drin waren Sonnenstudios, Versicherungen und davor lauter Parkplätze. Man sah die Haustüren gar nicht. Rechts lag ein McDonald's, gegenüber ein riesiges Kaufland. Alle Straßen hier waren zweispurig. Was sollte ich dazu sagen? Es war hässlich. Ich sagte nichts.
»Nein«, meinte Mama an meiner Stelle. »Nein, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also weiter.« Sie blinkte, schaute in den Rückspiegel und reihte sich wieder in den Verkehr ein.
Was war das gewesen, träumte ich immer noch? Es dauerte eine Weile, bis ich begriff. Das eben war gar nicht unser neues Heim! Mama hatte mich reingelegt. Warum machte sie so was? Der Knoten in meinem Hals löste sich nur langsam. »Du bist doof«, sagte ich. Ich knallte das Navi in den Fußraum. »Achtung«, sagte es.
Mama antwortete mit einem Lächeln.
Etwas später hielt sie wieder. Machte den Motor aus. Zog die Handbremse an. Diesmal war es eine Doppelhaushälfte, ein bisschen verwittert und alt und ziemlich klein, aber hey: Es gab einen Garten, vorne mit Unkraut und hinten, wie sich herausstellen sollte, mit Apfelbäumen. Die Fensterläden hingen schief, Efeu hielt sie zusammen. Über der Tür war eine Laterne angebracht, und als wir ausstiegen, bemerkte ich auf der Vortreppe eine große rote Katze, die uns misstrauisch beobachtete, ehe sie sich ins Gebüsch verzog. Ich war sicher, sie war nicht weit weg.
»Wie findest du es?«, fragte Mama. »Ich hatte Angst, dass es dir nicht gefällt. Weil es außerhalb ist und nicht sehr neu. Deshalb hab ich dir erst was Hässlicheres gezeigt. Damit du dann froh bist.«
Ich fand es toll, aber das sagte ich nicht. Ich stieg aus und lief auf den Busch zu, in dem die Katze sitzen musste. Ich ging in die Hocke. Sie war nicht mehr da. Konnte sich unsichtbar machen, wie es schien. Vielleicht verkleinerte sie sich wie Ant-Man, der Superheld? Das würde ich erforschen müssen. Ich stand wieder auf.
»Geht so«, sagte ich.
Drinnen gab es ein Treppenhaus mit einem runden Fenster. Die Stufen waren aus Holz, und die vierte quietschte. Aber das Bad war oben neben meinem Zimmer, sodass ich nachts nicht drauftreten musste. Im Kamin im Wohnzimmer lag noch Asche. Mama versprach, dass wir da Feuer machen würden, auch wenn es erst September war.
Die Umzugsmänner trugen unsere Sachen in die leeren Räume. Der Geruch wurde vertrauter. In irgendeiner Kiste war mein Bettzeug mit dem bunten Bezug. Damit würde ich mir heute Nacht zwischen den Kisten ein Lager bauen.
Mein Zimmer im ersten Stock schaute auf den Garten. Der war riesig. Man konnte rennen, wenn man ans Ende kommen wollte. Und an diesem Ende gab es eine Hecke, die höher war als ich. Mindestens ein Baum eignete sich zum Klettern.
»Schau mal«, sagte Mama, die hinter mir stand und mir über die Schulter schaute, »gleich nebenan stehen Kinderfahrräder.«
Ich sagte nichts. Ich hatte schon etwas anderes, ganz und gar Großartiges entdeckt.
3
Ich wartete, bis Mama telefonierte. Wenn sie erst einmal anfing, dauerte das ewig, und sie war durch nichts mehr zu stören. Leise schlich ich mich durch das Treppenhaus, an der Wohnzimmertür vorbei zur Haustür. Dort standen meine Schuhe. Ich würde vorne rausgehen und dann um das Haus herum. Mama würde nichts merken. »Nein, es war die richtige Entscheidung«, sagte sie gerade zu einer ihrer Freundinnen. »Du kannst nicht mit dreißig noch auf einer Rockbühne stehen und die Nachwuchshoffnung geben. Mit dreißig hast du es geschafft und bist die Diva. Oder du trittst ab. Ich muss doch auch an den Jungen denken.«
Leise schloss ich die Tür. Der Nachbar hatte eine Hecke gepflanzt und zusätzlich noch hölzerne Sichtblenden aufgestellt. Von dort konnte mich also niemand sehen. Vorsichtig ging ich durch das hohe Gras. Es musste gemäht werden. Und überall lagen abgefallene Äste. Auch leere Blumentöpfe. Ich entdeckte einen Fahrradreifen. Und da hinten, unter der Brombeerhecke, da war tatsächlich der Torbogen, den ich vom Fenster aus entdeckt hatte.
Er war aus Sandstein, ganz niedrig, als führte er in einen Keller. Aber er war da. Vier Stufen führten hinunter zu einer Holztür. Sie hatte nur einen rostigen Riegel. Mein Herz klopfte jetzt richtig schnell, als ich ihn zurückschob. Die Tür gab nach. Tageslicht fiel in das Gewölbe. Staub tanzte darin. Da war ein Boden aus gestampfter Erde, in der Ecke eine Matratze, dahinter ein leeres Regal. Ich blieb eine ganze Weile stehen. Dann traute ich mich, die Tür loszulassen und einen Schritt hineinzutun. Auf der Matratze lag viel Staub. Und man sah Abdrücke von Pfoten. Ich schaute mich um, konnte aber kein Tier entdecken. Dafür bemerkte ich, dass die steinerne Decke gewölbt war. Ich wusste, das musste ein alter Keller sein, aus der Zeit, als die Leute noch keine Kühlschränke hatten und hier Lebensmittel lagerten und sogar Eisblöcke. Aber es war mehr als ein Keller. Es war klasse.
»Kaspar?«
Ich zuckte zusammen, als ich Mama rufen hörte. Mist. Vorsichtig spähte ich durch die Tür. Sie stand am Zaun und plauderte mit den Nachbarn. »Bestimmt wird mein Sohn sich freuen«, sagte sie gerade. Und dann rief sie wieder: »Kaspar! Hier sind Kinder!«
Albtraum! Schnell zog ich mich zurück. Ich versuchte, gleichzeitig die Tür zuzuziehen und dabei bis zuletzt eine große Brombeerranke in der Hand zu behalten, damit sie den Eingang verbarg. Daran würde ich noch arbeiten müssen, wenn das Versteck geheim bleiben sollte.
Das Regal hatte zwei Schubladen. In der ersten fand ich alte Müsliriegel. Einen machte ich auf. Er war zäh, schmeckte aber noch süß. In dieser Umgebung schmeckte er ziemlich großartig. Ich würde mir eine Decke besorgen. In das Regal kämen meine Comics. Statt der Müsliriegel Gummibärchen. Und Krabbenkekse. Die mochte ich. Ich würde eine Schaufel brauchen. Vielleicht war hier sogar noch ein Schatz vergraben. Aussehen tat es danach. Ich öffnete die zweite Schublade und fand ein Buch. Die großen Geheimnisse stand auf dem Umschlag. An einer Stelle steckte viel Zeitungspapier zwischen den Seiten. Ich schlug sie auf. Das Rätsel des Kaspar Hauser, stand da. Der größte Kriminalfall Europas. Jemand hatte viel unterstrichen und etwas an den Rand geschrieben. Zeitungsartikel lagen auch dabei. Alles sah ziemlich altmodisch und uninteressant aus. Ich blätterte um. Auf der nächsten Seite gab es eine Illustration. Mich traf der Blick eines Jungen. Er saß in einem niedrigen Keller, fast so wie ich gerade. Er war klein und blond, kinderblond. Und in seiner Hand hielt er ein weißes Holzpferd.
4
»Kaspar! Wo steckst du?« Mama hatte wirklich ein übles Timing. Sie riss mich mitten aus der Lektüre. Ich wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war. Aber das Licht war schwächer geworden. Rasch schob ich das Buch unter mein T-Shirt. Ich würde mich nie wieder von dem Bild des Jungen trennen.
Als ich mich aufrappelte, raschelte es am Eingang. Das rote Fell der Katze blitzte auf. Von dir sind also die Spuren auf der Matratze, dachte ich. Vorsichtig versicherte ich mich, dass Mama zurück ins Haus gegangen war. Ich richtete die Brombeeren, ließ die Tür aber einen Spaltbreit offen für die rote Katze. Sie und ich, wir würden uns ganz bestimmt wiedersehen.
So schnell ich konnte, rannte ich ins Haus, versteckte das Buch und ging zu Mama in die Küche. Nur gut, dass sie es gewohnt war, dass ich herumstreunte. In Nürnberg war das nicht anders gewesen. Mama war cool. Und sie hatte gekocht, Chili con Carne, das konnte sie ganz gut. Und sie lud mich ein, im Kamin mit ihr Feuer zu machen. Das Chili war scharf, das Feuer heiß, es war klasse. Nach einer Weile vergaß ich das Buch beinahe. Jedenfalls war es nicht mehr so dringend, weiter darin zu lesen. Mama sang ein bisschen, und ich fragte sie über ihre neue Arbeit aus.
Sie würde morgen in einem Labor anfangen. Das war für uns beide etwas Neues. In Nürnberg hatte sie Musik gemacht, meist mit ihrer Band, manchmal war sie auch allein aufgetreten. Oder sie hatte gekellnert in einer Bar, die zu einem Kino gehörte. Fast alle unsere Freunde haben da mitgearbeitet. Es war kein normales Kino, mehr so ein Kulturverein, wo sie richtig gute Filme zeigten, in der Bar richtig gutes Essen anboten und zwischendurch eben auch im Nebensaal richtig gute Musik machten. Mir hat das viel Spaß gemacht und Mama auch, glaube ich. Es war aber alles nicht so richtig gut bezahlt. Und die meisten Leute, die wir kannten, waren eher arm.
»Du weißt ja, dass ich früher mal MTA gelernt habe«, fing Mama an.
»Nö«, sagte ich. »Was ist das?«
»Was Medizinisches«, sagte Mama. »MTA steht für medizinisch-technische Assistentin. Man lernt das für die Arbeit in Laboren. Von daher kenne ich Jutta noch. Und Jutta hat mir die Stelle hier verschafft. Am Empfang, weil ich ja keinen Abschluss habe. Aber am Empfang kommt es eher darauf an, dass man einfühlsam mit den Leuten umgeht.«
Es war ein genetisches Labor, wo auch Vaterschaftstests gemacht wurden. Die Leute gaben da Haare ab, Speichel oder Blut. Oder Sperma, sagte Mama. Und dann wurde daraus ermittelt, ob sie verwandt waren. Eine Menge Leute wollten das wissen, meinte Mama. Deshalb sei es eine sichere Arbeit und gut bezahlt.
»Meinst du«, fing ich an, »wir könnten so auch rausfinden, wer Papa ist?«
Mama wurde still. »Du hast keinen Papa«, sagte sie dann. Und dann noch: »Geh auf dein Zimmer, Kaspar.«
Ich ging. Fast sofort konnte ich hören, wie sie mir in den Flur nachkam. Am Fuß der Treppe blieb sie stehen. »Es tut mir leid, Kaspar«, rief sie mir nach. Ich drehte mich nicht nach ihr um.
5
Ich war so sauer auf Mama, dass ich kein Problem damit hatte, unter der Decke bis tief in die Nacht in dem geheimnisvollen Buch zu lesen. Ich musste alles über den Jungen mit dem Holzpferd wissen. Immer wieder betrachtete ich sein Bild. Kein Zweifel, das war das Pferd aus meinen Träumen. Der Junge war blond, und das richtige Alter hatte er auch.
Kaspar Hauser, las ich, war ein Findelkind. Als er am 26. Mai 1828 in Nürnberg das erste Mal auftauchte, war er etwa sechzehn Jahre alt. Er stand eines Tages einfach da, auf dem Unschlittplatz mitten in der Stadt, den kannte ich, obwohl eher die Nürnberger Südstadt mein Revier gewesen war. Kaspar Hauser hatte einen Brief in der Hand, konnte aber selbst weder lesen noch schreiben, nicht einmal richtig sprechen. Nur seinen Namen brachte er heraus. Ja, er konnte nicht mal richtig laufen. Und gesagt hat er immer nur ein und denselben Satz. Als ich ihn las, war mir sofort klar, dass ihm den jemand eingetrichtert haben musste. »Ich will ein Reiter werden, wie mein Vater einer gewesen ist.« Wer sagte so was schon? Vor allem, wenn er ansonsten kaum ein Wort beherrschte.
Kaspar kam als Landstreicher in den Turm der Nürnberger Burg, das war damals das Gefängnis. Aber die Leute merkten gleich, dass er etwas Besonderes war. Sie mochten ihn und sorgten für ihn. Er wurde untersucht, und man stellte fest, dass er wohl lange eingesperrt gewesen war. Denn seine Knie waren verformt, als hätte er lange mit ausgestreckten Beinen auf dem Boden gesessen. Seine Augen waren empfindlich, als wären sie kein Tageslicht gewöhnt. Und Sprechen hatte er nicht gelernt, also hatte man wohl nicht viel mit ihm geredet. Wasser und Brot waren die einzige Nahrung, die er vertrug. Von Fleisch, Alkohol, Kaffee, Gewürze und alles, was intensiver schmeckte, wurde ihm schlecht. Für mich klang das nach Einzelhaft, fast nach Folter. Auf dem Bild saß er in einem Kerker. Es war so gezeichnet, wie man sich ein Verlies vorstellte. Wo Kaspar tatsächlich eingesperrt war, hat man nie herausbekommen, obwohl eine Belohnung darauf ausgesetzt worden war.
Kaspar war freundlich und sanft, hieß es. Ich war wütend auf die Leute, die ihm das angetan hatten. Und auch auf die, die ihn wie eine Zirkus-Attraktion bestaunten und ihn Kunststücke vorführen ließen. Es ging ihm wie einigen von den Mutanten aus den X-Men-Comics, die auch eingesperrt waren oder Schaukämpfe machen mussten. Wäre es gerecht zugegangen, dann wäre jemand gekommen, der ihm verraten hätte, dass er Superkräfte besaß und wie er sie einsetzen konnte. Dann wäre er ein Held geworden.
Kaspar konnte im Dunkeln sehen. Er konnte versteckte Gegenstände aus Metall aufspüren, er nahm sie wahr, auch wenn sie nicht sichtbar waren. Das wurde alles untersucht und beschrieben. Er hatte wirklich besondere Kräfte, wie die X-Men.
Und zweimal hat jemand versucht, Kaspar Hauser umzubringen. Beim zweiten Mal hat es geklappt. Deshalb glaubte ich, dass Kaspar echt wichtig gewesen sein musste. Dahinter musste wirklich ein großes Geheimnis stecken.
Ich klappte das Buch zu und rollte mich unter der Decke zusammen. Ich war noch ganz aufgeregt. Was für ein Glück, dass ich in Ansbach gelandet war! Hier hatte Kaspar gelebt. Und hier war er erstochen worden. Gleich morgen würde ich mir den Tatort ansehen.