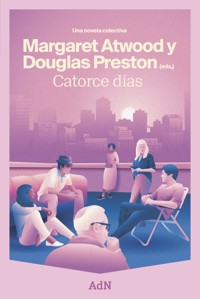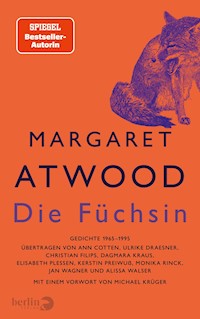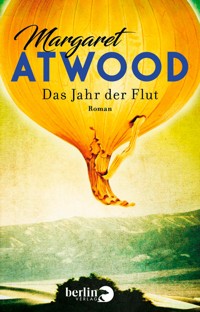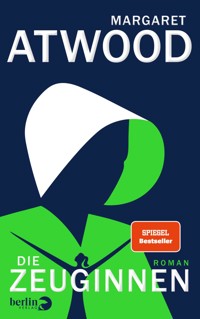10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Katzenauge«, einer der erfolgreichsten Romane von Margaret Atwood, erzählt von der schillernden Gefühlswelt kleiner Mädchen. Die erwachsene Elaine erinnert sich an ihre Freundschaft mit Cordelia, die, grausam und schlagfertig, der Quälgeist ihrer jungen Jahre war. Ein großer Roman über die Kindheit und die von Hassliebe geprägte Beziehung zweier Frauen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
Übersetzung aus dem kanadischen Englischvon Charlotte FrankISBN 978-3-492-97078-5April 2017Die Originalausgabe erschien 1989 unter dem Titel»Cat’s Eye« im Verlag Doubleday, New York© O. W. Toad, Ltd. 1988Copyright für die deutsche Übersetzung von Charlotte Franke:© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 1990Neuauflage im Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2016Alle Rechte vorbehaltenCovergestaltung: zero-media.net, MünchenCoverabbildung: Young Girl in Green, 1927 (oil on canvas),Lempicka, Tamara de (1898–1980)/Musee National d’Art Moderne,Centre Pompidou, Paris, France/Bridgeman ImagesDatenkonvertierung: psb, BerlinSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Die Bilder und die anderen Werke moderner Kunst, die in diesem Buch vorkommen, existieren nicht. Sie wurden jedoch von den Künstlern Joyce Wieland, Jack Chambers, Charles Pachter, Erica Heron, Gail Geltner, Dennis Burton, Louis de Niverville, Heather Cooper, William Kurelek, Greg Curnoe und der pop-surrealistischen Töpferin Lenore M. Atwood und einigen anderen beeinflusst; und von der Isaacs Gallery, dem alten Original.
Die physikalischen und kosmologischen Seitensprünge in diesem Buch sind Paul Davies, Carl Sagan, John Gribbin und Stephen W. Hawking und ihren faszinierenden Büchern zu diesen Themen verpflichtet sowie meinem Neffen David Atwood wegen seiner erhellenden Ausführungen über Fädchen.
Als die Tukanas ihr den Kopf abschnitten, fing die alte Frau ihr Blut in den Händen auf und blies es in die Sonne. »Meine Seele geht auch in dich ein!«, rief sie. Seit dieser Zeit nimmt jeder, der tötet, ohne es zu wollen und ohne es zu wissen, die Seele seines Opfers in seinem Körper auf.
Eduardo Galeano, Erinnerung an das Feuer: Geburten
Warum erinnern wir uns an die Vergangenheit, und nicht an die Zukunft?
Stephen W. Hawking,
EISERNE LUNGE
1
Die Zeit ist keine Linie, sondern eine Dimension, wie die Dimensionen des Raums. Lässt sich der Raum krümmen, so lässt sich auch die Zeit krümmen, und wenn man genügend Wissen besäße und sich schneller als Licht bewegen könnte, dann könnte man auch zurückreisen in der Zeit und an zwei Orten zugleich sein.
Das sagte mir mein Bruder Stephen, wenn er beim Lernen seinen ausgefransten kastanienbraunen Pulli anhatte und dabei die meiste Zeit auf dem Kopf stand, damit Blut in sein Gehirn rann und es mit Nahrung versorgte. Ich wusste nicht, was er meinte, aber vielleicht hat er es mir auch nicht besonders gut erklärt. Er fing schon damals an, die Ungenauigkeit von Wörtern hinter sich zu lassen.
Aber seither habe ich die Zeit als etwas angesehen, das eine Form besitzt, als etwas, das man sehen kann, wie flüssige Dias, die übereinanderliegen. Man blickt nicht an der Zeit entlang zurück, sondern in sie hinein und hinunter wie durch Wasser. Manchmal kommt dieses an die Oberfläche, manchmal jenes, manchmal gar nichts. Nichts geht weg.
2
»Stephen sagt, die Zeit ist keine Linie«, sage ich. Cordelia verdreht die Augen, wie ich es nicht anders erwartet habe.
»Ach ja?«, sagt sie. Diese Antwort stellt uns beide zufrieden. Sie rückt die Zeit an ihren Platz und Stephen auch, der uns »Teenager« nennt, als wäre er nicht selber einer.
Cordelia und ich fahren mit der Straßenbahn in die Stadt, wie immer an den Samstagen im Winter. Die Luft in der Straßenbahn ist muffig, sie riecht verbraucht und nach Wolle. Cordelia gibt sich lässig und stößt mich ab und zu mit dem Ellbogen an, während ihre graugrünen Augen, undurchdringlich und glitzernd wie Metall, völlig ausdruckslos die anderen Leute anstarren. Sie kann jeden niederstarren, und ich bin fast genauso gut. Wir sind unzugänglich, wir funkeln, wir sind dreizehn.
Wir haben lange Wollmäntel an, mit einem Gürtel zum Binden und hochgeschlagenem Kragen, genauso wie die Filmstars, und heruntergeklappte Gummistiefel mit dicken Männersocken. Die Kopftücher, die unsere Mütter uns geben, damit wir sie umbinden, die wir aber abnehmen, sobald wir ihren Blicken entschwunden sind, stecken in unseren Taschen. Wir verabscheuen Kopfbedeckungen. Unsere Münder sind hart, pastellrot, glänzend wie Nägel. Wir halten uns für Freundinnen.
In der Straßenbahn sind immer alte Damen, jedenfalls kommen sie uns alt vor. Ganz verschiedene. Manche in ordentlicher Kleidung – gut geschnittene Harris-Tweedmäntel, mit dazu passenden Handschuhen und adretten Hüten mit einer kleinen steifen Feder an der Seite. Andere sind ärmer und sehen fremdartig aus, um ihre Köpfe und Schultern sind dunkle Schals geschlungen. Andere haben eine rundliche Figur und ein mürrisches Gesicht und selbstgerecht zusammengekniffene Lippen, und an ihren Armen hängen Einkaufsbeutel; diese Frauen bringen wir mit Billigangeboten in Kaufhäusern und Ramschkäufen in Zusammenhang. Cordelia erkennt billige Kleider auf den ersten Blick. »Kunststoff«, sagt sie. »Billig.«
Und dann gibt es die Frauen, die noch nicht aufgegeben haben, die sich noch immer gern herausputzen. Viele sind es nicht, aber sie fallen auf. Sie tragen scharlachrote Kleider, oder auch purpurrote, und wild baumelnde Ohrringe und Hüte, die an Bühnenrequisiten erinnern. Unter ihren Röcken sehen ihre Unterröcke hervor, Unterröcke in ungewöhnlichen, anzüglichen Farben. Alles, was nicht weiß ist, ist anzüglich. Ihr Haar ist strohblond oder babyblau gefärbt oder, was neben ihrer zerknitterten Haut noch verblüffender wirkt, glänzend schwarz wie alte Pelzmäntel. Ihre Lippenstiftmünder sind viel zu groß und die roten Farben fleckig, Augen zittrig rund um die richtigen Augen gezogen. Diese Frauen reden meistens mit sich selbst. Eine von ihnen summt andauernd »Lamm – Lamm« vor sich hin, wie ein Lied; und eine andere sticht mit ihrem Schirm gegen unsere Beine und sagt »nackich«.
Das sind die, die wir am liebsten mögen. Sie sehen fröhlich aus, voller Fantasie, sie scheinen sich nicht darum zu kümmern, was die andern Leute denken. Sie sind entkommen, auch wenn uns nicht klar ist, wem sie entkommen sind. Wir glauben, dass sie sich ihre irre Kleidung und die Ticks selbst ausgedacht haben und dass wir uns, wenn es mit uns mal so weit ist, auch welche auswählen können.
»Genauso werd ich mal sein«, sagt Cordelia. »Allerdings werd ich ein hechelndes Pekinesenhündchen haben und alle Kinder von meinem Rasen jagen. Ich werd einen Hirtenstab tragen.«
»Ich halt mir einen Leguan«, sage ich, »und trag nur noch Cerise.« Es ist ein Wort, das ich erst vor kurzem gelernt habe.
Heute denke ich: Und wenn sie einfach nicht sehen konnten, wie sie aussahen? Vielleicht hatten sie nur schlechte Augen. Mir geht es inzwischen nicht viel anders: zu dicht am Spiegel, und ich sehe mich verschwommen, zu weit weg, und ich kann keine Einzelheiten erkennen. Wer weiß, was für Gesichter ich schneide, wie verrückt ich mich anmale? Selbst wenn ich die richtige Entfernung habe, verändere ich mich. Es wechselt ständig; an manchen Tagen sehe ich aus wie eine abgewrackte Fünfunddreißigjährige, an anderen wie eine muntere Fünfzigerin. Das hängt sehr vom Licht ab und davon, wie man sich betrachtet.
Ich esse in rosa Restaurants, die der Haut schmeicheln. Gelbe Einrichtungen machen gelb im Gesicht. Ich verwende tatsächlich Zeit darauf, über diese Frage nachzudenken. Eitelkeit wird zu einer Plage; ich kann verstehen, warum die Frauen sie am Ende aufgeben. Aber so weit bin ich noch nicht.
In letzter Zeit ertappe ich mich des Öfteren dabei, wie ich laut vor mich hin summe oder auf der Straße mit leicht geöffnetem Mund etwas sabbere. Nur ein bisschen; aber vielleicht ist das die Kante des Meißels, der Riss in der Wand, der sich später weitet und den Blick freigibt – auf was? Welche Ausblicke leuchtender Exzentrizität oder des Wahnsinns?
Es gibt niemanden, dem ich je davon erzählen würde, außer Cordelia. Aber welcher Cordelia? Der Cordelia, die ich heraufbeschworen habe, der mit den umgekrempelten Stiefeln und dem aufgestellten Kragen, oder der davor oder der danach? Es gibt niemals nur eine, von niemandem.
Wenn ich Cordelia noch einmal begegnete, was würde ich ihr dann von mir erzählen? Die Wahrheit oder was mich gut aussehen lassen würde?
Wahrscheinlich Letzteres. Ich brauche das noch immer.
Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe nicht erwartet, sie zu sehen. Aber jetzt, seit ich wieder hier bin, kann ich kaum durch eine Straße gehen, ohne einen Blick von ihr zu erhaschen, wie sie um eine Ecke geht, durch eine Tür verschwindet. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass diese Teile von ihr – eine Schulter, beige, Kamelhaar, ein Profil, eine Wade – Frauen gehören, die im Ganzen gesehen nicht Cordelia sind.
Ich habe keine Ahnung, wie sie jetzt wohl aussehen mag. Ist sie dick, hat sie Hängebrüste, hat sie kleine graue Haare in den Mundwinkeln? Wohl kaum: Die würde sie sich auszupfen. Trägt sie eine Brille mit modischem Gestell, hat sie sich die Augenlider liften lassen, hat sie Strähnen oder getöntes Haar? Alles ist möglich: Wir haben beide das Grenzalter erreicht, diese Pufferzone, die es einem noch erlaubt, sich vorzumachen, dass solche Tricks funktionieren, solange man grelles Sonnenlicht meidet.
Ich denke an Cordelia, wie sie die immer größer werdenden Säcke unter ihren Augen betrachtet, die Haut, ganz aus der Nähe, schlaff und runzlig wie Ellbogen. Sie seufzt, legt Salbe auf, die richtige natürlich, massiert sie mit klopfenden Fingerspitzen ein. Cordelia würde genau wissen, welche die richtige ist. Sie nimmt ihre Hände in Augenschein, die schon ein bisschen runzlig werden, ein bisschen verkrümmt, so wie meine. Alles wird knorrig, der Mund beginnt zu welken, darunter, am Hals, werden in den dunklen Glasscheiben der Unterführung die Umrisse eines Doppelkinns sichtbar. Niemand sonst bemerkt bisher etwas von diesen Dingen, außer wenn sie genau hinsehen; aber Cordelia und ich haben die Angewohnheit, genau hinzusehen.
Sie lässt das Badetuch fallen, das grün ist, ein blasses Meeresgrün, das zu ihren Augen passt, sieht über die Schulter, erspäht im Spiegel die Falten über der Taille wie an einem Hundenacken und die Gesäßbacken, die schlaff herunterhängen, und als sie sich umdreht, das vertrocknete Farnkraut der Haare. Ich stelle sie mir in einem Trainingsanzug vor, ebenfalls meeresgrün, wie sie sich in irgendeiner Turnhalle verausgabt und schwitzt wie ein Schwein. Ich weiß, was sie darüber sagen würde, über all das. Wie wir damals gekichert haben, entzückt und voller Abscheu, als wir das Wachs entdeckten, das ihre älteren Schwestern sich auf die Beine strichen, das voller Haarborsten in einem kleinen Topf erstarrte. Die Grotesken des Körpers haben sie schon immer interessiert.
Ich stelle sie mir vor, wie ich ihr plötzlich, ohne Warnung, begegne. Vielleicht in einem abgetragenen Mantel und einer Strickmütze wie ein Teewärmer, im Rinnstein sitzend, mit zwei Plastiktüten, in denen sie ihre paar Habseligkeiten aufbewahrt, leise vor sich hin murmelnd. Cordelia! Erkennst du mich nicht?, sage ich. Und sie erkennt mich, tut aber so, als täte sie es nicht. Sie steht auf und schlurft auf geschwollenen Füßen davon, in den alten Socken, die sich durch die Löcher in ihren Gummistiefeln drücken, wirft mir einen Blick über die Schulter zu.
Das ist irgendwie befriedigend, schlimmere Dinge noch mehr. Ich beobachte von einem Fenster oder, um besser sehen zu können, einem Balkon aus, wie Cordelia auf dem Bürgersteig unter mir von einem Mann verfolgt wird, wie er sie einholt, ihr einen Rippenstoß versetzt – ich bringe es nicht fertig, ihr ins Gesicht schlagen zu lassen –, sie zu Boden wirft. Aber weiter schaffe ich es nicht.
Besser, ich verlege das Ganze in ein Sauerstoffzelt. Cordelia ist bewusstlos. Ich werde zu spät an ihr Krankenbett gerufen. Es stehen Blumen da, mit einem widerwärtigen Geruch, in einer Vase verwelkend, in Arme und Nase führen Schläuche, das Geräusch letzter Atemzüge. Ich halte ihre Hand. Ihr Gesicht ist aufgedunsen, weiß, wie ungebackener Plätzchenteig, mit gelblichen Kreisen um die geschlossenen Augen. Ihre Augenlider flackern nicht, aber ihre Finger zucken ganz leicht, oder bilde ich mir das nur ein? Ich sitze da und überlege, ob ich die Schläuche aus ihren Armen, den Stecker aus der Wand ziehen soll. Keine Gehirntätigkeit mehr, sagen die Ärzte. Weine ich? Und wer hätte mich wohl hierherholen sollen?
Noch besser: eine eiserne Lunge. Ich habe noch nie eine gesehen, aber in den Zeitungen waren Bilder von Kindern in eisernen Lungen, damals, als die Leute noch Kinderlähmung bekamen. Diese Bilder – die eiserne Lunge ein Zylinder, eine riesige Wurstrolle aus Metall, aus deren einem Ende ein Kopf herausguckte, immer der Kopf eines Mädchens, dessen Haare über das Kissen flössen, mit großen nächtlichen Augen – faszinierten mich, mehr als die Geschichten von Kindern, die über dünnes Eis liefen und einbrachen und ertranken, oder von Kindern, die auf Eisenbahnschienen spielten und denen die Züge Arme und Beine abtrennten. Man konnte Kinderlähmung bekommen, ohne zu wissen, wie oder wo, und in einer eisernen Lunge landen, ohne zu wissen, warum. Irgendetwas, das man einatmete oder runterschluckte oder das man sich von dem schmutzigen Geld, das andere Leute angefasst hatten, holte. Das konnte man nie wissen.
Man benutzte die eisernen Lungen dazu, uns zu erschrecken, und nannte sie als Grund dafür, warum wir Dinge, die wir gern getan hätten, nicht tun konnten. Nicht in öffentlichen Badeanstalten schwimmen, nicht mit vielen Menschen im Sommer zusammensein. Willst du etwa den Rest deines Lebens in einer eisernen Lunge verbringen?, sagten sie. Eine dumme Frage; obgleich mir ein solches Dasein, mit seiner Trägheit und seinem Mitleid, insgeheim auch verlockend vorkam.
Cordelia in einer eisernen Lunge also, beatmet wie man ein Akkordeon spielt. Um sie herum ein mechanisches ächzendes Geräusch. Sie ist bei vollem Bewusstsein, aber unfähig, sich zu bewegen oder zu sprechen. Ich komme in das Zimmer, bewege mich, spreche. Wir sehen uns an.
Irgendwo musste Cordelia doch sein. Vielleicht lebte sie keine Meile von mir entfernt, vielleicht nur einen Häuserblock entfernt. Allerdings habe ich keine Ahnung, was ich tun würde, wenn sie plötzlich vor mir stünde, zum Beispiel in der U-Bahn, wenn sie mir gegenübersäße oder auf dem Bahnsteig wartete und sich die Werbeplakate ansähe. Wir würden beide dastehen, nebeneinander, und einen großen roten Mund anstarren, der sich um ein Stückchen Schokolade schließt, und ich würde mich zu ihr wenden und sagen: Cordelia. Ich bin’s, Elaine. Würde sie sich umwenden, einen theatralischen Schrei ausstoßen? Würde sie mich ignorieren?
Oder würde ich sie ignorieren, wenn ich dazu Gelegenheit hätte? Oder würde ich wortlos zu ihr gehen, sie in die Arme schließen? Oder sie an den Schultern packen und sie schütteln und schütteln.
Ich muss stundenlang herumgelaufen sein, den Hang hinunter bis in die Innenstadt, wo jetzt keine Straßenbahnen mehr fahren. Es ist Abend, graue Tuschfarben, die die Stadt im Herbst anlegt, wie flüssiger Staub. Das Wetter jedenfalls ist noch wie früher.
Jetzt bin ich an der Stelle angekommen, an der wir immer aus der Straßenbahn gestiegen sind, in die Schneematschhaufen, die im Januar am Bordstein lagen, in den ächzenden Wind, der zwischen den heruntergekommenen Gebäuden mit den flachen Dächern, für uns noch die Verkörperung von Urbanität, vom See hereinwehte. Aber dieser Teil der Stadt ist jetzt nicht mehr flach, heruntergekommen, schäbig-vornehm. An den restaurierten Ziegelsteinfassaden leuchten Neonröhren in Kursivschrift, und es gibt eine ganze Menge Messingbeschläge, eine ganze Menge Immobilien, eine ganze Menge Geld. Dahinter ragen riesige rechteckige Türme in den Himmel, ganz aus Glas, erleuchtet, wie gewaltige Grabsteine aus kaltem Licht. Eingefrorenes Kapital.
Aber ich blicke nicht oft hinauf zu den Türmen und auch nicht auf die Menschen, die an mir vorbeikommen in ihrer modischen Aufmachung, Importe, handverarbeitetes Leder, Seide und was auch immer. Sondern ich blicke hinunter, auf den Gehsteig, wie ein Fährtensucher.
Ich spüre, wie sich meine Kehle zusammenschnürt, einen Schmerz an den Kinnbacken. Ich kaue wieder an den Fingern. Sie bluten, ein Geschmack, an den ich mich noch erinnere. Es schmeckt nach Orangeneis am Stiel, Kaugummikugeln, roter Lakritze, angeknabberten Haaren, schmutzigem Eis.
SILBERPAPIER
3
Ich liege auf dem Fußboden, auf einem Futon, der mit einem Duvet bedeckt ist. Futon, Duvet: So weit haben wir es gebracht. Ich frage mich, ob Stephen je herausgefunden hat, was Futons und Duvets sind. Wohl kaum. Wahrscheinlich hätte er einen, wenn man ihm mit Futon gekommen wäre, groß angestarrt, so als wäre er taub oder als wäre man nicht ganz richtig im Kopf. In der Futon-Dimension existierte er nicht.
Als es noch keine Futons und Duvets gab, kostete ein Hörnchen Eis fünf Cent. Jetzt kostet es einen Dollar, wenn man Glück hat, und ist noch dazu kleiner. Das ist unterm Strich der Unterschied zwischen damals und heute: 95 Cent.
Ich stehe jetzt in der Mitte meines Lebens. Ich stelle es mir wie einen Ort vor, wie die Mitte eines Flusses, die Mitte einer Brücke, halbwegs drüber weg, halbwegs vorbei. Eigentlich sollte ich inzwischen allerlei Dinge angesammelt haben: Besitztümer, Verantwortungen, Errungenschaften, Erfahrung und Weisheit. Eigentlich sollte ich ein Mensch mit Substanz sein.
Aber seit ich hierher zurückgekehrt bin, fühle ich mich nicht gewichtiger. Ich fühle mich leichter, als würde ich an Substanz verlieren, Moleküle abgeben, Kalzium von meinen Knochen, Zellen von meinem Blut; als würde ich schrumpfen, als würde ich mich mit kalter Luft füllen oder mit leise rieselndem Schnee.
Doch bei all dieser Leichtigkeit steige ich nicht etwa auf, sondern ab. Oder vielmehr werde ich nach unten gezogen, in die Schichten dieses Ortes, wie in verflüssigten Schlamm.
Tatsache ist, dass ich diese Stadt hasse. Ich hasse sie schon so lange, dass ich mich kaum noch daran erinnern kann, je etwas anderes für sie empfunden zu haben.
Früher einmal war es Mode, darüber zu reden, wie langweilig es hier war. Erster Preis eine Woche in Toronto, zweiter Preis zwei Wochen in Toronto, Toronto die Gute, Toronto die Blaue, wo an den Sonntagen kein Wein zu kriegen war. Jeder, der hier lebte, sagte es: provinziell, selbstzufrieden, langweilig. Wenn man es sagte, dann war das ein Beweis dafür, dass man diese Dinge erkannte, ohne Anteil an ihnen zu haben.
Jetzt wird von einem erwartet, dass man sagt, wie sehr sie sich verändert hat. Weltstadt ist ein Ausdruck, der immer wieder, viel zu häufig, in den Zeitschriften verwendet wird. All die ethnischen Restaurants und das Theater und die Boutiquen. New York ohne den Müll und die Überfälle soll sie sein. Früher fuhren die Leute aus Toronto an den Wochenenden nach Buffalo, die Männer, um sich die Stripteaseshows anzusehen und bis in die Nacht Bier zu trinken, die Frauen, um Einkäufe zu machen; wenn sie zurückkamen, waren sie aufgeregt und missmutig und trugen mehrere Kleider übereinander, um sie durch den Zoll zu schmuggeln. Jetzt läuft der Wochenendverkehr in umgekehrter Richtung.
Ich habe keine dieser Versionen geglaubt, weder die von Langeweile noch die von Weltklasse. Für mich war Toronto niemals langweilig. Langweilig wäre nicht das richtige Wort, um solches Elend zu beschreiben, und solche Verzauberung.
Und ich kann einfach nicht glauben, dass es sich verändert hat. Als ich gestern mit dem Taxi vom Flughafen kam, an den flachen ordentlichen Fabriken und Lagerhäusern vorbei, die früher flache ordentliche Bauernhöfe gewesen waren, eine Meile der Vorsicht und Nützlichkeit nach der andern, und dann durch die Innenstadt mit dem Glitzer und den gestylten europäischen Markisen und den Pflastersteinen, konnte ich erkennen, dass alles noch genauso war wie früher. Unter all der Üppigkeit und Prahlerei ist die alte Stadt noch vorhanden, Straße für Straße aus dicken roten Backsteinhäusern, mit den Säulen davor, die wie weißliche Stiele von Blätterpilzen aussehen, und ihren wachsamen, berechnenden Fenstern. Böswillig, grollend, rachsüchtig, unversöhnlich.
In meinen Träumen von dieser Stadt verirre ich mich immer.
Neben alldem habe ich natürlich auch ein reales Leben. Manchmal kann ich kaum daran glauben, weil es mir nicht wie ein Leben erscheint, mit dem ich je davonkommen würde oder das ich je verdient hätte. Und noch etwas anderes glaube ich: dass alle in meinem Alter erwachsen sind, während ich nur so tue, als ob.
Ich wohne in einem Haus mit Vorhängen und einem Rasen davor, in British Columbia, so weit entfernt von Toronto, wie ich kommen konnte, ohne zu ertrinken. Die unwirkliche Landschaft dort ermutigt mich: die Ansichtskartenberge mit Sonnenuntergängen von der rührseligen Art, die cottageartigen Häuser, die aussehen, als hätten die sieben Zwerge sie in den Dreißigerjahren gebaut, die riesenhaften Schnecken, so viel größer, als eine Schnecke zu sein braucht. Selbst der Regen ist übertrieben, ich kann ihn nicht ernst nehmen. Ich nehme an, dass den Menschen, die dort aufgewachsen sind, diese Dinge genauso real und bedrückend vorkommen wie Toronto mir. Aber an guten Tagen ist es noch immer wie Ferien, wie Flucht. An schlechten Tagen nehme ich es nicht wahr, genauso wenig wie alles andere.
Ich habe einen Ehemann, nicht den ersten. Er heißt Ben. Er ist in keiner Weise ein Künstler, wofür ich dankbar bin. Er besitzt ein Reisebüro, das auf Mexiko spezialisiert ist. Zu seinen besten Eigenschaften zählen billige Flugtickets nach Yucatán. Wegen dieses Reisebüros hat er mich nicht nach Toronto begleitet: In der Zeit vor Weihnachten läuft das Reisegeschäft auf Hochtouren.
Ich habe auch zwei Töchter, die jetzt schon erwachsen sind. Sie heißen Sarah und Anne, gute, vernünftige Namen. Eine von ihnen ist fast schon Ärztin, die andere Wirtschaftsprüferin. Das sind vernünftige Berufe. Ich glaube an vernünftige Entscheidungen. Die sich von meinen eigenen so sehr unterscheiden. Ich glaube auch an vernünftige Namen für Kinder, denn man braucht sich ja nur anzusehen, was mit Cordelia passiert ist.
Neben meinem realen Leben habe ich einen Beruf, der vielleicht nicht ganz so real ist. Ich bin Malerin. Das habe ich sogar in einem Anfall von Wagemut in meinen Pass schreiben lassen, denn die andere Möglichkeit wäre Hausfrau gewesen. Es kommt mir irgendwie noch immer unwahrscheinlich vor, es geworden zu sein; an manchen Tagen möchte ich mich am liebsten verkriechen. Anständige Leute werden nicht Maler: nur aufgeblasene, ehrgeizige, theatralische Leute. Das Wort Künstlerin ist mir peinlich; ich ziehe Malerin vor, weil das mehr nach richtiger Arbeit klingt. Künstler zu sein ist etwas Flitterhaftes, Faules, wie einem die meisten Menschen in diesem Land sagen werden. Wenn man erwähnt, dass man Malerin ist, gucken einen die Leute komisch an. Außer man malt Vögel oder Tiere, oder natürlich, wenn man eine Menge Geld damit verdient. Aber ich verdiene nur so viel, um bei anderen Malern Neid zu wecken, aber nicht genug, um allen zu sagen, sie können mich mal.
Aber die meiste Zeit triumphiere ich und habe das Gefühl, mit knapper Not entkommen zu sein.
Meine Karriere ist der Grund, warum ich hier bin, auf diesem Futon, unter diesem Duvet. Sie machen eine Retrospektive, meine erste. Die Galerie heißt Sub-Versions, eines jener Wortspiele, an denen ich Spaß hatte, solange sie noch nicht derart in Mode waren. Eigentlich müsste ich über diese Retrospektive froh sein, aber ich habe eher gemischte Gefühle; ich gebe nicht gern zu, dass ich schon alt und etabliert genug bin, um eine zu bekommen, auch wenn es sich um eine alternative Galerie handelt, die von lauter Frauen geführt wird. Es kommt mir unglaubwürdig und bedrohlich vor: erst die Retrospektive, dann die Gruft. Aber ich bin auch sauer, weil die Art Gallery in Ontario sie nicht machen wollte. Die haben eine Vorliebe für tote Männer aus dem Ausland.
Das Duvet befindet sich in einem Atelier, das Jon, meinem ersten Ehemann, gehört. Ich finde es interessant, dass er ein Duvet hier hat, obgleich seine Wohnung ganz woanders ist. Bis jetzt habe ich mich noch beherrscht und mich davon abgehalten, in seinem Medizinschränkchen zu stöbern, auf der Suche nach Haarnadeln und weiblichen Deodorants, wie ich es früher getan hätte. Das geht mich jetzt nichts mehr an, ich kann die Haarnadeln seiner eisernen Frau überlassen.
Hier zu übernachten ist wahrscheinlich ziemlich dumm, zu stark rückgewandt. Aber wir haben wegen Sarah, die ja auch seine Tochter ist, immer Verbindung gehalten, und nachdem wir das Gebrüll und das zerbrochene Glas hinter uns gebracht hatten, sind wir fast Freunde geworden, über große Entfernung, was immer leichter ist als aus der Nähe. Als er von der Retrospektive hörte, bot er mir die Wohnung an. Die Preise für ein Hotelzimmer in Toronto, sagte er, selbst in einem zweitklassigen Hotel, werden langsam obszön. Sub-Versions hätte mich untergebracht, aber ich habe das nicht angesprochen. Die Sauberkeit von Hotelzimmern mit ihren quietschend-reinen Badewannen ist mir ein Gräuel. Ich ertrage das Echo meiner Stimme darin nicht, vor allem nicht bei Nacht. Ich ziehe die Hinterlassenschaften, die Unordnung und den persönlichen Schmutz von Leuten vor, die so sind wie ich, Leute wie Jon. Durchreisende und Nomaden.
Jons Studio liegt unten in der King Street, dicht beim Wasser. Früher gehörte die King Street zu jenen Gegenden, die man tunlichst mied, ein Ort mit schmuddligen Lagerhäusern und donnernden Lastwagen und zweifelhaften Gassen. Aber inzwischen ist die Gegend in der Welt aufgestiegen. Künstler haben sich hier eingenistet; tatsächlich ist die erste Künstlerwelle fast vorbei, und es machen sich schon Messingbriefkästen und bemalte Heizrohre, rot wie Feuerlöscher, und Anwaltskanzleien breit. Jons Atelier, im fünften und obersten Stock eines der Lagerhäuser, hat in seiner gegenwärtigen Form nicht mehr lange zu leben. An den Decken breiten sich Lichtschienen aus, die unteren Stockwerke hat man ihres alten Linoleumbelags beraubt, der nach einem Gemisch von Desinfektionsmitteln, uraltem Erbrochenem und Urin roch, und die breiten Bodendielen werden nun mit Sandstrahlgebläse bearbeitet. Das weiß ich, weil ich immer zu Fuß in die fünfte Etage hinaufsteige; zu einem Fahrstuhl haben sie es noch nicht gebracht.
Jon hatte mir den Schlüssel in einem Umschlag unter die Fußmatte gelegt und dazu einen Zettel, auf dem Viel Glück stand, ein Beweis dafür, wie weich er geworden ist oder wie gereift. Viel Glück passt nicht gerade zu seinem früheren Stil. Er ist in Los Angeles, wo er an einem Motorsägenmord arbeitet, aber er wird noch vor der Eröffnung meiner Ausstellung zurück sein.
Das letzte Mal habe ich ihn vor vier Jahren bei Sarahs Abschlussfeier im College gesehen. Er kam mit dem Flugzeug an die Küste, zum Glück ohne seine Frau, die mich nicht leiden kann. Wir sind uns zwar noch nie begegnet, aber ich weiß von ihrem Mangel an Zuneigung. Während der offiziellen Feiern, dem üblichen höflichen Gemurmel und dem Tee mit Plätzchen danach, gaben wir uns als verantwortungsvolle erwachsene Eltern. Wir führten beide Mädchen zum Essen aus und benahmen uns. Wir zogen uns sogar so an, wie Sarah es gern hatte: ich in einem Kostüm, dazu passende Schuhe und alles, und Jon in einem Anzug mit Schlips und Kragen. Ich sagte ihm, er sehe aus wie ein Leichenbestatter.
Aber am darauffolgenden Tag schlichen wir uns zum Lunch davon und ließen uns volllaufen. Dass ich volllaufen sage, ein Wort, das schon ausstirbt, zeigt mir, um was für ein Ereignis es sich handelte. Es war ein Rückblick. Und ich denke daran noch immer als Davonschleichen, obgleich ich es Ben natürlich erzählt hatte. Obgleich es ihm nie in den Sinn käme, mit seiner ersten Frau zum Mittagessen zu gehen.
»Du hast doch immer gesagt, dass es so eine Katastrophe war«, sagte Ben erstaunt zu mir.
»War es ja auch«, sagte ich. »Es war grauenhaft.«
»Warum wolltest du dann mit ihm essen?«
»Das ist schwer zu erklären«, sagte ich, auch wenn es das vielleicht gar nicht war. Was wir teilen, Jon und ich, mag sehr wie nach einem Verkehrsunfall aussehen. Aber wir mögen einander. Wir sind Überlebende, voneinander. Wir waren Haie, füreinander, aber auch das Rettungsboot. Das wiegt so einiges auf.
Früher hat Jon Dinge gebaut. Er machte sie aus kleinen Holz- und Lederstücken, die er in anderer Leute Müll aufstöberte, oder aber er zerbrach irgendwelche Gegenstände – Geigen, Glas – und klebte die Stücke so zusammen, wie sie zerbrochen waren; Bruchmuster nannte er das. Einmal wickelte er farbiges Klebeband um Baumstämme und fotografierte sie dann, ein anderes Mal bildete er einen mit Schimmel überzogenen Brotlaib nach, der mittels eines kleinen Elektromotors ein- und ausatmete. Den Schimmel machte er aus abgeschnittenen Haaren, seinen eigenen und denen seiner Freunde. Ich glaube, auf diesem Brotlaib sind auch noch Haare von mir; ich habe ihn mal dabei ertappt, wie er ein paar Haare aus meiner Haarbürste stibitzte.
Jetzt macht er Special Effects für Kinofilme, um seine Kunstwerke zu finanzieren. Im Studio liegen halb fertige Dinge, die er für seine Arbeit braucht, herum. Auf dem Arbeitstisch, auf dem Farben, Klebstoff, Messer und Scheren liegen, eine Hand und ein Arm aus Kunstharz, aus dem abgeschnittenen Ende schlängeln sich Arterien, Schlaufen und Riemen, um ihn anzubinden. Auf dem Fußboden stehen hohle Gipsbeine und -füße, wie elefantengroße Schirmständer; in einem steckt ein Regenschirm. Auch ein halbes Gesicht ist da, die Haut dunkel verfärbt und welk, das über das wirkliche Gesicht eines Schauspielers gezogen wird. Ein Ungeheuer, von anderen zerstört, auf Rache sinnend.
Jon sagte mir, dass er sich eigentlich nicht sicher ist, ob diese Arbeit mit abgehackten Körperteilen das Richtige für ihn ist. Es ist zu gewalttätig, trägt nichts zur menschlichen Güte bei. Auf seine alten Tage glaubt er also an menschliche Güte, ganz gewiss eine Veränderung; ich habe sogar Kräutertee im Schrank gefunden. Er behauptet, er würde lieber hübsche freundliche Tiere für Kinderaufführungen machen. Aber schließlich muss man essen, wie er sagt, und abgehackte Gliedmaßen sind einfach gefragter.
Ich wünschte, er wäre hier oder Ben oder irgendein anderer Mann, den ich kenne. Ich verliere den Appetit auf Fremde. Früher hätte mich die Aufregung, das Risiko gefesselt; heute denke ich nur an die Unordnung, die Unbequemlichkeiten. Sich seiner Kleider voller Anmut zu entledigen, stets ein Ding der Unmöglichkeit; sich zu überlegen, was man hinterher sagen soll, ohne den Widerhall der Gedanken, die einem durch den Kopf schwirren, geordnet zu haben. Schlimmer noch, die Begegnung mit den Eigentümlichkeiten eines anderen: die Zehennägel, die Ohren, die Haare in den Nasenlöchern. Vielleicht werden wir in unserem Alter wieder so prüde, wie wir es als Kinder waren.
Ich erhebe mich von dem Duvet und fühle mich, als hätte ich gar nicht geschlafen. Flüchtig sehe ich die Kräuterteebeutel in der kleinen Küche durch, Zitronennebel, Morgendonner, und lasse sie für einen starken, wach rüttelnden giftigen Kaffee liegen. Ich stehe wieder in der Mitte des großen Zimmers, ohne genau zu wissen, wie ich von der Küche hierhergekommen bin. Ein kleiner Zeitsprung, eine kleine Störung auf dem Bildschirm, wahrscheinlich Jetlag: abends zu spät ins Bett, morgens groggy. Alzheimer im frühen Stadium.
Ich sitze am Fenster, trinke meinen Kaffee, kaue auf meinen Fingerspitzen, sehe die fünf Stockwerke tief bis nach unten. Aus diesem Winkel sehen die Fußgänger aus wie zusammengequetscht, wie missgebildete Kinder. Überall um mich herum sind kastenförmige Lagerhäuser mit Flachdächern und hinter ihnen die flache Eisenbahnlandschaft, in der die Züge früher rangierten, immer vor und zurück, früher einmal die einzige Unterhaltung, die es an den Sonntagen hier gab. Dahinter der flache Ontariosee, eine Null am Anfang und eine Null am Ende, schiefergrau und bis obenhin mit Gift gefüllt. Selbst der Regen, der von ihm aufsteigt, ist krebserregend.
Ich wasche mich in Jons winzigem, schmierigem Badezimmer, widerstehe dem Medizinschränkchen. Das Bad ist mit Fingerabdrücken übersät und in einem trüben Weiß gestrichen, nicht gerade das schmeichelhafteste Licht. Jon käme sich nicht wie ein Künstler vor, wenn er nicht von einer gehörigen Portion Trübsinn umgeben wäre. Ich kneife die Augen zusammen und sehe in den Spiegel, mache mein Gesicht zurecht: Mit den Kontaktlinsen bin ich zu dicht am Spiegel, ohne sie bin ich zu weit weg. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, diese Dinge im Spiegel mit einer Linse im Mund zu erledigen, glasig und dünn wie Zitronennachgeschmack. Ich könnte aus Versehen daran ersticken, nicht gerade ein würdevoller Tod. Ich sollte mir eine Brille mit zwei verschiedenen Stärken zulegen. Aber dann würde ich wie eine alte irische Putzfrau aussehen.
Ich streife meinen marineblauen Trainingsanzug über, meine Verkleidung als Nichtkünstlerin, und steige die vier Treppen hinunter und bemühe mich, energisch und zielbewusst auszusehen. Ich könnte eine Geschäftsfrau sein, die zum Joggen geht, ich könnte eine Bankdirektorin sein, die ihren freien Tag hat. Ich gehe nach Norden, dann durch die Queen Street nach Osten, auch eine Gegend, durch die wir früher nie gegangen sind. Damals hieß es, dass sich hier schmierige Saufbolde herumtrieben, Wermutbrüder, Penner; angeblich tranken sie reinen Alkohol, schliefen in Telefonzellen und kotzten einem in der Straßenbahn auf die Schuhe. Aber heute sind hier Kunstgalerien und Buchläden, Boutiquen voll schwarzer Kleidung und absonderlichem Schuhwerk, die gezackte Speerspitze des Trends.
Ich beschließe, einen Blick auf die Galerie zu werfen, die ich noch nie gesehen habe, weil alles am Telefon und per Post geregelt worden ist. Ich habe nicht die Absicht hineinzugehen, mich zu erkennen zu geben, noch nicht. Ich will nur einen Blick von außen darauf werfen. Ich werde vorbeigehen, nur ganz beiläufig hinsehen, so tun, als wär ich eine Hausfrau, eine Touristin, jemand, der einen Schaufensterbummel macht. Galerien sind etwas Schreckliches, Orte der Bewertung, des Urteils. Ich muss mich langsam an sie heranarbeiten.
Aber bevor ich die Galerie erreiche, komme ich zu einer Bretterwand, hinter der ein Haus abgerissen wird. Mit einer Spraydose, im trotzigen Widerspruch zum schreiend sauberen Toronto, steht da: Entweder Bacon oder ich, Baby. Und darunter: Was ist Bacon, und wo krieg ich welchen? Daneben hängt ein Poster. Oder weniger ein Poster als ein Flugblatt: ein kräftiges Rot mit grünen Akzenten und schwarzen Buchstaben: RISLEY RETROSPEKTIVE steht da; nur der Nachname, wie bei einem Jungen. Es ist mein Name und mein Gesicht, mehr oder weniger jedenfalls. Es ist das Foto, das ich der Galerie geschickt habe. Außer dass ich jetzt einen Bart trage.
Wer immer diesen Schnurrbart auf das Plakat gemalt hat, wusste, was er tat. Oder was sie tat: Da gibt es keinen Zweifel. Es ist ein gelockter, wallender Schnurrbart, wie der eines Edelmanns, mit einem graziösen Spitzbart am Kinn dazu. Er passt zu meinen Haaren.
Wahrscheinlich sollte ich mir wegen dieses Schnurrbarts Gedanken machen. Ist das nur Schmiererei oder ist es ein politischer Kommentar, ein Akt der Aggression? Ist es mehr wie Kilroy war hier oder mehr wie Verpiss dich? Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich selbst solche Schnurrbärte gemalt habe, und an die Boshaftigkeit, die dabei im Spiel war, an den Wunsch, lächerlich zu machen, runterzumachen, und an das Gefühl von Macht. Es entstellte, es stahl jemandem das Gesicht. Wäre ich jünger, würde ich mich darüber ärgern.
Aber so betrachte ich den Schnurrbart und denke: Sieht gar nicht mal schlecht aus. Der Schnurrbart wirkt wie eine Verkleidung. Ich sehe ihn mir von allen Seiten an, als überlegte ich, ob ich mir einen kaufen sollte. Er wirft ein anderes Licht. Ich muss an Männer und ihre Gesichtshaare denken und an die Möglichkeit, sich zu verkleiden, zu verhüllen, die ihnen stets zur Verfügung steht. Ich denke an Männer mit Schnurrbärten und wie nackt sie sich fühlen müssen, wenn das Ding abrasiert ist. Wie kleiner gemacht. Eine ganze Menge Leute würden mit Schnurrbart viel besser aussehen.
Dann plötzlich habe ich ein Gefühl der Verwunderung. Ich habe es am Ende zu einem Gesicht gebracht, in das man einen Schnurrbart malen kann, ein Gesicht, das Schnurrbärte anzieht. Ein öffentliches Gesicht, ein Gesicht, das zu entstellen sich lohnt. Das ist eine Leistung. Ich habe am Ende also doch irgendwas aus mir gemacht.
Ich frage mich, ob Cordelia dieses Poster wohl sieht. Ich frage mich, ob sie mich darauf wiedererkennen wird, trotz des Schnurrbarts. Vielleicht kommt sie ja zur Eröffnung. Sie wird durch die Tür kommen, und ich werde mich zu ihr umdrehen, ganz in Schwarz, wie es sich für eine Malerin gehört, ich werde erfolgreich aussehen und ein Glas mit einem nicht ganz schlechten Wein in der Hand halten. Ich werde keinen einzigen Tropfen verschütten.
4
Bis wir nach Toronto zogen, war ich glücklich.
Davor wohnten wir eigentlich nirgends, oder wir wohnten an so vielen verschiedenen Orten, dass man sich nur schwer an sie erinnern konnte. Die meiste Zeit fuhren wir in unserem niedrigen, bootsförmigen Studebaker herum, über Nebenstraßen oder zweispurige Highways oben im Norden, mit den weißen Strichen, die die Straße in der Mitte teilten, fuhren an See um See vorbei, an Hügel um Hügel, und mit den Telefonmasten am Straßenrand, größeren und kleineren, deren Drähte auf und ab zu wippen schienen.
Ich sitze allein hinten, zwischen den Koffern und den Pappkartons mit Essen und den Mänteln und in der gasigen, nach chemischer Reinigung riechenden Ausdünstung des Autopolsters. Mein Bruder Stephen sitzt auf dem Vordersitz, am halb geöffneten Fenster. Er riecht nach Pfefferminz-Lifesavers; darunter liegt sein normaler Geruch nach Zedernholzbleistiften und nassem Sand. Manchmal erbricht er sich, in Papiertüten oder am Straßenrand, wenn mein Vater rechtzeitig anhalten kann. Ihm wird schlecht und mir nicht, deshalb muss er vorn sitzen. Es ist seine einzige Schwäche, von der ich weiß.
Von meinem eingezwängten Platz im hinteren Teil des Wagens habe ich eine gute Aussicht auf die Ohren meiner Familie. Die meines Vaters, die unter dem Rand des alten Filzhutes hervorstehen, den er immer trägt, um seinen Kopf vor Zweigen und Harz und Raupen zu schützen, sind groß und sehen weich aus und haben lange Ohrläppchen; sie sehen aus wie Zwergenohren oder wie die Ohren der fleischfarbenen, hundeähnlichen kleinen Figuren in den Mickymaus-Heften. Meine Mutter hat ihre Haare mit Klemmen hochgesteckt, sodass ihre Ohren von hinten zu sehen sind. Sie sind schmal, haben fein geformte obere Ränder, wie die Henkel von Porzellantassen, auch wenn sie nicht zerbrechlich sind. Die Ohren meines Bruders sind rund, wie getrocknete Aprikosen oder wie die Ohren der grünlichen fremden Wesen aus dem Weltraum mit ovalen Köpfen, die er mit seinen Buntstiften malt. Rund um seine runden Ohren und den Nacken hinunter liegen die Haare dick, dunkelblond und glatt. Er wehrt sich dagegen, sie schneiden zu lassen.
Es ist für mich schwierig, meinem Bruder etwas in seine runden Ohren zu flüstern, wenn wir im Auto sitzen. Auf jeden Fall kann er nicht zurückflüstern, weil er nach vorn sehen muss, geradeaus auf den Horizont oder auf die weißen Linien der Straße, die auf uns zurollt, eine langsame Welle nach der anderen.
Die Straßen sind fast immer leer, weil Krieg ist, nur manchmal begegnen wir einem Lastwagen, der mit gefällten Baumstämmen beladen ist oder mit frischem Holz, sie ziehen ihr Parfüm aus Sägemehl hinter sich her. Mittags halten wir am Straßenrand und breiten eine Decke auf dem Boden aus, zwischen den Strohblumen und den Weidenröschen, und essen, was unsere Mutter zubereitet, Brot und Sardinen oder Brot und Käse oder Brot und Sirup oder Brot und Marmelade, wenn nichts anderes zu kriegen war. Fleisch und Käse sind knapp, weil sie rationiert sind. Das bedeutet, dass man ein Zuteilungsbuch mit bunten Marken hat.
Unser Vater macht ein kleines Feuer, um in einem Kessel Wasser für den Tee zu kochen. Nach dem Essen verschwinden wir zwischen den Büschen, einer nach dem anderen, mit Klopapier in der Tasche. Manchmal liegen dort bereits Fetzen von Klopapier, zwischen den Zweigen und vertrockneten Blättern, aber meistens ist keins da. Ich hocke mich hin, lausche hinter mir nach Bären, Tannennadeln stechen mir in die Beine, dann vergrabe ich das Toilettenpapier unter Zweigen und Baumrinde und Farnblättern. Unser Vater sagt, man muss alles immer so zurücklassen, als wäre man gar nicht dort gewesen.
Unser Vater geht in den Wald, er trägt eine Axt, einen Rucksack und eine große Holzkiste mit einem ledernen Schulterriemen. Er blickt hinauf, von einem Baum zum andern, und überlegt. Dann breitet er eine Zeltplane auf dem Boden aus, direkt unter dem Baum, den er ausgesucht hat, und legt sie um den Stamm. Er öffnet die Holzkiste, die in einzelne Fächer mit kleinen Flaschen unterteilt ist. Er schlägt mit dem stumpfen Ende seiner Axt gegen den Baumstamm. Der Baum erzittert; Blätter und Zweige und Raupen prasseln herunter, schlagen auf seinem grauen Filzhut auf, plumpsen auf die Zeltplane. Stephen und ich bücken uns, lesen die Raupen auf, die blaue Streifen haben und samtig und kühl sind wie Hundeschnauzen. Wir stecken sie in die Flaschen, die mit blassem Alkohol gefüllt sind. Wir sehen zu, wie sie zucken und nach unten sinken.
Mein Vater betrachtet die Raupenernte, als hätte er sie selbst herangezüchtet. Er untersucht die angefressenen Blätter. »Ein prachtvoller Befall«, sagt er. Er ist fröhlich, er ist jünger, als ich heute bin.
Der Alkoholgeruch klebt an meinen Fingern, kalt und fern, scharf wie eine Stahlnadel, die sich in sie hineingebohrt hat. Er riecht wie weiße Emailleschüsseln. Wenn ich in der Nacht hinaufblicke zu den Sternen, die kalt und weiß und stechend am Himmel stehen, denke ich, dass sie ganz genau so riechen müssen.
Wenn der Tag zu Ende geht, halten wir wieder an und stellen unser Zelt auf, schwere Leinwand mit Holzstangen. Unsere Schlafsäcke sind kakifarben und dick und klumpig und fühlen sich immer etwas feucht an. Darunter kommen Decken auf den Boden und aufblasbare Luftmatratzen, von denen einem schwindlig wird, wenn man sie aufbläst, und die in Nase und Mund einen Geruch und Geschmack nach alten Gummistiefeln hinterlassen oder nach Ersatzreifen, die in der Garage aufgestapelt sind. Zum Essen setzen wir uns ums Feuer, das immer heller wird, während die Schatten wie dunklere Äste aus den Bäumen wachsen. Wir kriechen in das Zelt und ziehen uns in unseren Schlafsäcken aus, die Taschenlampe wirft einen Kreis auf die Zeltplane, einen hellen Ring, der einen dunkleren wie eine Zielscheibe umschließt. Das Zelt riecht nach Teer und Ölzeug und nach braunem Papier mit verschmiertem Käse und nach zertretenem Gras. Am Morgen sind die Gräser draußen mit Tau bedeckt.
Manchmal übernachten wir in Motels, aber nur, wenn es schon zu spät ist, um einen Platz für das Zelt zu suchen und es aufzustellen. Die Motels befinden sich immer weit entfernt von allem und jedem, sie stehen vor einer dunklen Wand aus Bäumen, und in dem gleichförmigen, undurchdringlichen Dunkel der Nacht schimmern ihre Lichter wie die von Schiffen oder Oasen. Vor ihnen stehen Benzinpumpen, so groß wie Menschen, mit runden Scheiben obendrauf, die leuchten wie blasse Monde oder wie ein Heiligenschein ohne den Kopf. Auf jeder Scheibe befindet sich eine Muschel, ein Stern, ein orangefarbenes Ahornblatt oder eine weiße Rose. Die Motels und Benzinpumpen sind häufig leer oder abgeschlossen: Benzin ist rationiert, sodass niemand viel herumreist, wenn er nicht unbedingt muss.
Oder wir übernachten in Hütten, die anderen Leuten oder der Regierung gehören, oder wir bleiben in aufgelassenen Holzfällerlagern, oder wir stellen zwei Zelte auf, eins zum Schlafen und eins für die Vorräte. Den Winter über bleiben wir in kleinen oder großen Städten oben im Norden, Soo oder North Bay oder Sudbury, in Wohnungen, die in Wirklichkeit das obere Stockwerk von Häusern sind, die anderen Leuten gehören, sodass wir aufpassen müssen, dass wir mit unseren Schuhen auf den Holzböden nicht zu viel Lärm machen. Unsere Möbel kommen dann aus dem Lager. Es sind immer dieselben, aber sie sehen immer fremd aus.
In diesen Wohnungen gibt es Spülklos, weiß und aufregend, in denen mit einem lauten Aufbrüllen in Sekundenschnelle alles verschwindet. Immer wenn wir in einer Stadt ankommen, verbringen mein Bruder und ich viel Zeit im Badezimmer, wir werfen alle möglichen Dinge in die Kloschüssel, Makkaroni zum Beispiel, nur um zuzusehen, wie sie runtergespült werden. Es gibt Warnsirenen, und dann ziehen wir die Vorhänge zu und drehen das Licht aus, obgleich unsere Mutter sagt, dass der Krieg niemals hierherkommen wird. Der Krieg dringt durch das Radio zu uns, entfernt und mit Knistern, sodass die Stimmen aus London hinter den Störgeräuschen dünn werden. Unsere Eltern lauschen mit zweifelnder Miene, sie kneifen die Lippen zusammen: Es könnte sein, dass wir verlieren.
Mein Bruder glaubt das nicht. Er glaubt, dass unsere Seite die gute Seite ist und wir daher gewinnen werden. Er sammelt Zigarettenbilder mit Flugzeugen darauf, er kennt den Namen jedes einzelnen Flugzeugs.
Mein Bruder besitzt einen Hammer und etwas Holz und ein eigenes Klappmesser. Er schnitzt und hämmert: Er macht ein Gewehr. Er nagelt zwei Holzstücke im rechten Winkel aneinander und klopft einen weiteren Nagel für den Abzug hinein. Er hat schon mehrere solcher Holzgewehre und außerdem noch Dolche und Schwerter, auf deren Schneide er mit rotem Buntstift Blut gemalt hat. Manchmal ist das Blut orangefarben, weil ihm der rote Buntstift ausgegangen ist. Er singt:
Mit einem Flügel und einem Gebet,mit einem Flügel und einem Gebetbringen wir sie runter,und wenn die Kiste in Stücke bricht,uns stört das nicht,mit einem Flügel und einem Gebetbringen wir sie runter.
Er singt es wie ein fröhliches Lied, aber ich finde es traurig, denn obwohl ich die Flugzeuge auf den Zigarettenbildern gesehen habe, weiß ich nicht, wie sie fliegen. Ich stelle mir vor, sie fliegen wie Vögel, und ein Vogel, der nur einen Flügel hat, kann nicht fliegen. Das sagt mein Vater immer vor dem Essen, im Winter, wenn er sein Glas hebt und andere Männer mit uns am Tisch sitzen: »Mit einem Flügel kann man nicht fliegen.« Deshalb hat das Gebet in dem Lied keinen Zweck.
Stephen gibt mir ein Gewehr und ein Messer, und wir spielen Krieg. Das ist sein Lieblingsspiel. Während unsere Eltern das Zelt aufstellen oder Feuer machen oder kochen, schleichen wir hinter Bäumen und Büschen herum und zielen durch die Blätter. Ich bin die Infanterie, was bedeutet, dass ich tun muss, was er mir sagt. Er winkt mich nach vorn, holt mich zurück, sagt mir, dass ich den Kopf tief halten muss, damit er mir vom Feind nicht weggeblasen wird.
»Du bist tot«, sagt er.
»Nein, bin ich nicht.«
»Doch, bist du doch. Sie haben dich erwischt. Leg dich hin.«
Man kann nicht mit ihm streiten, denn er kann den Feind sehen und ich nicht. Ich muss mich auf den sumpfigen Boden legen, gegen einen Baumstamm gelehnt, um nicht völlig nass zu werden, bis es für mich an der Zeit ist, wieder lebendig zu werden.
Manchmal ziehen wir, anstatt Krieg zu spielen, durch den Wald, drehen Baumstämme und Felsbrocken um, um zu sehen, was darunter ist. Da sind Ameisen, Wurzelstöcke und Käfer, Frösche und Kröten, Nattern, ja, wenn wir Glück haben, sogar Salamander. Wir tun mit all den Dingen, die wir finden, nichts. Wir wissen, dass sie sterben werden, wenn wir sie in Flaschen stecken und sie aus Versehen im Rückfenster des Autos in der Sonne liegen lassen, wie es uns schon einige Male passiert ist. Daher sehen wir sie uns nur an, sehen zu, wie die Ameisen ihre pillenförmigen Eier in Panik verstecken, wie sich die Schlangen in die Dunkelheit ergießen. Dann legen wir die Holzstücke wieder an ihren Platz zurück, außer wir benötigen irgendwas davon zum Angeln.
Ab und zu prügeln wir uns. Bei diesen Kämpfen gewinne ich nie: Stephen ist größer und rücksichtsloser als ich, und ich will mit ihm lieber spielen, als er mit mir. Wenn wir uns streiten, dann immer nur flüsternd oder in sicherer Entfernung, denn wenn wir dabei erwischt werden, bekommen wir beide eine Strafe. Aus diesem Grund verpetzen wir uns auch nicht gegenseitig. Wir wissen aus Erfahrung, dass die Befriedigung des Verrats die Sache selten wert ist.
Weil diese Kämpfe geheim sind, besitzen sie einen besonderen Reiz. Es ist der Reiz schmutziger Wörter, die wir eigentlich nicht aussprechen dürfen, Wörter wie Arsch; der Reiz von Geheimnistuerei, von Verschwörung. Wir treten uns gegenseitig auf die Füße, zwicken uns in die Arme, immer darauf bedacht, ja nicht laut aufzuschreien, noch in größter Empörung unseren Regeln treu.
Wie lange haben wir so gelebt, wie Nomaden an den fernen Rändern des Krieges?
Heute sind wir lange gefahren, es ist spät geworden, als wir unser Zelt aufschlagen. Wir befinden uns nicht weit von der Straße, neben einem unbekannten See mit zerklüftetem Ufer. Die Bäume spiegeln sich im Wasser, die Blätter der Pappeln sind herbstlich gelb. Die Sonne geht in einem langen, fröstelnden, zögernden Bogen unter, flamingorosa, dann lachsbraun, dann in dem unglaublich bebenden Rot von Mercurochrom. Das rosig gefärbte Licht bleibt zitternd auf der Oberfläche liegen, verblasst dann und ist verschwunden. Es ist eine klare Nacht, mondlos, voller antiseptischer Sterne. Und da ist die Milchstraße, so klar und deutlich, wie es nur geht, was schlechtes Wetter ankündigt.
Wir kümmern uns nicht um all diese Dinge, denn Stephen bringt mir gerade bei, im Dunkeln zu sehen, wie es Soldaten von Sonderkommandos tun. Man kann nie wissen, ob man es nicht einmal brauchen kann, sagt er. Man darf keine Taschenlampe anknipsen; man muss ganz still sein, im Dunkeln, und warten, bis sich die Augen daran gewöhnt haben, dass es kein Licht gibt. Dann beginnen sich die Formen der Gegenstände abzuzeichnen, grau und schimmernd und flüchtig, als würden sie sich aus der Luft heraus verdichten. Stephen sagt, dass ich meine Füße langsam bewegen muss, dass ich bei jedem Schritt auf einem Fuß stehen bleiben muss, aufpassen muss, dass ich nicht auf einen Zweig trete. Er sagt, dass ich ganz ruhig atmen muss. »Wenn sie dich hören, kriegen sie dich«, flüstert er.
Er hockt neben mir, ein dunkler Fleck vor dem Wasser des Sees. Ich sehe das Aufblitzen eines Auges, dann ist er verschwunden. Das ist ein Trick von ihm.
Ich weiß, dass er sich ans Feuer schleicht, zu meinen Eltern, deren Gesichter flackernd, schattenhaft, verschwommen sind. Ich bin allein mit meinem pochenden Herzen und meinem zu lauten Atmen. Aber er hat recht: Jetzt kann ich im Dunkeln sehen.
So sind meine Bilder von den Toten.
5
Ich feiere meinen achten Geburtstag in einem Motel. Mein Geschenk ist eine Brownie-Kamerabox, schwarz und kastenförmig, oben mit einem Griff und hinten mit einem runden Loch, durch das man hindurchsehen kann.
Das erste Bild, das damit aufgenommen wird, ist von mir. Ich lehne am Türrahmen des Motelhäuschens. Hinter mir die Tür, sie ist weiß und geschlossen, die Zimmernummer ist aus Metall, eine Neun. Ich habe Hosen an, die an den Knien ausgebeult sind, und eine Jacke, deren Ärmel zu kurz sind. Man kann es nicht sehen, aber ich weiß, dass ich darunter eine braun und gelb gestreifte Strickjacke von meinem Bruder trage. Die meisten meiner Sachen sind von ihm. Meine Haut ist ganz weiß, der Film ist überbelichtet, mein Kopf etwas geneigt, die handschuhlosen Hände baumeln an der Seite herunter. Ich sehe aus wie die Leute auf alten Einwandererfotos. Ich sehe aus, als hätte man mich vor diese Tür gestellt und mir befohlen, still zu stehen.
Wie war ich damals, was habe ich mir gewünscht? Es ist schwer, sich daran zu erinnern. Habe ich mir einen Fotoapparat zum Geburtstag gewünscht? Wahrscheinlich nicht, obgleich ich mich darüber gefreut habe.
Ich wünsche mir noch ein paar Bilder aus den Verpackungen von Nabisco-Cornflakes, Karten mit Bildern zum Anmalen, die man ausschnitt und zu Häusern in einer Stadt zusammenfaltete. Ich wünsche mir auch ein paar Pfeifenreiniger. Wir haben ein Buch mit dem Titel Hobbys für Regentage, in dem beschrieben ist, wie man aus zwei Dosen und einem Stück Schnur ein Walkie-Talkie bastelt oder wie man ein Boot baut, das losfährt, wenn man einen Tropfen Schmieröl in ein Loch gibt; und auch, wie man aus den ganz kleinen Streichholzschachteln Puppenkommoden mit Schubläden macht und aus Pfeifenreinigern alle möglichen Tiere – einen Hund, ein Schaf, ein Kamel. Auf das Boot und die Kommode bin ich nicht besonders scharf, aber auf die Pfeifenreiniger. Ich habe noch nie einen Pfeifenreiniger gesehen.
Ich wünsche mir Silberpapier aus Zigarettenschachteln. Ich habe schon welches, aber ich will noch mehr. Meine Eltern rauchen keine Zigaretten, daher muss ich es mir zusammensammeln, wo immer ich kann, neben Tankstellen, im Unkraut bei den Motels. Ich habe mir angewöhnt, den Boden abzusuchen. Wenn ich ein Stück Silberpapier finde, säubere ich es und streiche es glatt und hebe es zwischen den Seiten meines Schullesebuchs auf. Ich weiß noch gar nicht, was ich damit tun werde, wenn ich genügend davon habe, aber bestimmt etwas Tolles.
Ich wünsche mir einen Luftballon. Es gibt jetzt wieder welche, nachdem der Krieg vorbei ist. Einmal, als ich im Winter Mumps hatte, fand meine Mutter einen, unten in ihrem Überseekoffer. Sie muss ihn vor dem Krieg dort weggesteckt haben, vielleicht weil sie annahm, dass es eine ganze Weile keine geben würde. Sie blies ihn für mich auf. Er war blau, durchsichtig, rund wie ein privater Mond. Das Gummi war alt und verrottet und platzte gleich darauf, und es brach mir das Herz. Ich wünsche mir einen neuen Luftballon, einen, der nicht platzt.
Ich wünsche mir Freunde, Freunde, die Mädchen sind. Freundinnen. Ich weiß, dass es sie gibt, denn ich habe in Büchern von ihnen gelesen, aber ich habe noch nie eine Freundin gehabt, weil wir nirgends lange genug bleiben.
Die meiste Zeit ist es kalt, stürmisch und bedeckt, mit dem tief hängenden metallischen Himmel des Spätherbstes; oder es regnet, und wir müssen im Motel bleiben. Das Motel ist so, wie wir es gewohnt sind: eine Reihe Cottages, leicht gebaut, verbunden mit den Leitungen von gelben, blauen und grünen Weihnachtslämpchen. Dies sind »Cottages mit Selbstverpflegung«, was bedeutet, dass irgendeine Art Herd drinsteht und dass es ein oder zwei Töpfe und einen Teekessel gibt sowie einen Tisch, auf dem ein Wachstuch liegt. Der Boden in unserem Cottage mit Selbstverpflegung ist mit Linoleum ausgelegt, dessen Blumenmuster verblasst ist. Die Handtücher sind dünn und fadenscheinig, die Laken sind in der Mitte durchgelegen, zerschlissen von den Leibern anderer Gäste. An der Wand hängt ein gerahmter Druck mit einem winterlichen Wald und ein anderer mit fliegenden Enten. In manchen Motels sind die Toiletten im Hof, aber hier gibt es ein richtiges, wenn auch stark riechendes Klo mit Spülung und eine Badewanne.
Wir wohnen schon seit Wochen in diesem Motel, was ungewöhnlich ist: Wir bleiben in den Motels sonst niemals länger als eine Nacht. Wir essen Habitant-Erbsensuppe aus der Dose, die wir in einem verbeulten Topf auf dem Zweiflammenherd erhitzen, und dazu Brotscheiben mit Sirup und Käsestücken. Jetzt, nachdem der Krieg aus ist, gibt es wieder mehr Käse. Wir behalten das, was wir draußen tragen, auch im Haus an und in der Nacht die Strümpfe, denn diese Cottages mit ihren einfachen Wänden sind eigentlich für die Touristen im Sommer gedacht. Das heiße Wasser ist immer nur lauwarm, aber Mutter macht im Teekessel Wasser heiß und schüttet es in die Wanne, wenn wir baden. »Nur damit das Gröbste abgeht«, sagt sie.
Am Morgen wickeln wir uns in Decken, wenn wir frühstücken. Manchmal können wir unseren Atem sehen, sogar im Haus. All das ist nicht normal und irgendwie festlich. Das liegt nicht nur daran, dass wir nicht in die Schule gehen. Länger als drei oder vier Monate hintereinander sind wir sowieso noch nie in die Schule gegangen. Ich war vor acht Monaten das letzte Mal in der Schule und habe nur eine blasse und flüchtige Vorstellung davon, wie es da war.
An den Vormittagen machen wir unsere Schulaufgaben in unseren Arbeitsheften. Unsere Mutter sagt uns, welche Seiten wir machen sollen. Dann lesen wir in unseren Schulfibeln. Meine handelt von zwei Kindern, die in einem weißen Haus mit gerafften Gardinen wohnen, mit einem Rasen davor und einem Lattenzaun ringsherum. Der Vater geht zur Arbeit, die Mutter hat ein Kleid an und eine Schürze umgebunden, und die Kinder spielen mit ihrem Hund und ihrer Katze auf dem Rasen Ball. Nichts in diesen Geschichten ähnelt auch nur im Entferntesten meinem Leben. Es gibt keine Zelte, keine Landstraßen, kein Pieseln in den Büschen, keine Seen, keine Motels. Es gibt keinen Krieg. Die Kinder sind immer sauber, und das kleine Mädchen, das Jane heißt, trägt ein hübsches Kleid und Lackschuhe mit Riemen.
Diese Bücher üben auf mich einen exotischen Reiz aus. Wenn Stephen und ich mit unseren Buntstiften malen, dann malt er Kriege, gewöhnliche Kriege und Kriege im Weltraum. Von den vielen Explosionen sind Rot und Gelb und Orange nur noch Stummel, und Gold und Silber sind auch aufgebraucht, für die vielen metallisch glänzenden Panzer und Raumschiffe, die Helme und die komplizierten Schusswaffen. Ich male Mädchen. Ich male sie in altmodischen Kleidern, mit langen Röcken, Latzschürzen und Puffärmeln, oder in Kleidern wie jenen von Jane und mit großen Schleifen im Haar. Es ist ein elegantes, köstliches Bild, das mir von anderen kleinen Mädchen vorschwebt. Ich denke nicht darüber nach, was ich zu ihnen sagen würde, wenn ich ihnen tatsächlich mal begegnen sollte. So weit bin ich noch nicht.
Am Abend wird von uns erwartet, dass wir das Geschirr abwaschen – »mit den Tellern klappern«, nennt meine Mutter das. Wir zanken uns, flüsternd und einsilbig, wer mit dem Abwaschen dran ist: Das Abtrocknen mit dem stets klammen Geschirrhandtuch ist längst nicht so gut wie das Abwaschen, bei dem man sich wenigstens die Hände wärmt. Wir lassen die Teller und Gläser in der Abwaschschüssel schwimmen und bombardieren sie im Sturzflug mit Löffeln und Messern und flüstern: »Bomben frei.« Wir bemühen uns, so dicht wie möglich an sie heranzukommen, ohne sie tatsächlich zu treffen. Es sind nicht unsere Teller. Das geht unserer Mutter ziemlich auf die Nerven. Wenn es ihr zu viel wird, wäscht sie selber ab; das gilt als Verweis.
Nachts liegen wir in dem durchgelegenen Ausziehbett, Kopf an Fuß, was angeblich bewirkt, dass wir schneller einschlafen, und schubsen uns, ohne einen Muckser von uns zu geben, unter der Decke; oder aber wir probieren aus, wie weit wir mit unserem Fuß samt Socken im Pyjamabein des anderen raufkriechen können. Ab und zu fällt das Scheinwerferlicht eines vorbeifahrenden Autos durch das Fenster, gleitet zuerst über die eine, dann über die andere Wand, bevor es verschwindet. Motorengeräusch ist zu hören, dann das Zischen der Reifen auf der nassen Straße. Dann Stille.
6
Ich weiß nicht, wer das Bild von mir aufgenommen hat. Es muss mein Bruder gewesen sein, denn meine Mutter ist im Haus, hinter der weißen Tür, in ihren grauen Hosen und einem dunkelblauen Hemd aus dickem Tuch, und packt unser Essen in Kartons und unsere Kleider in Koffer. Sie packt nach einem bestimmten System; sie redet mit sich selbst, während sie es tut, erinnert sich selbst laut an Einzelheiten und hat uns gern aus dem Weg.
Gleich nach dem Foto beginnt es zu schneien, einzelne kleine trockene Schneeflocken fallen aus dem harten nördlichen Novemberhimmel. Das Licht verblasst, und die letzten Ahornblätter hängen wie Seetang von den Zweigen, während es immer dunkler wird und sich ein mattes Schweigen vor diesem ersten Schnee ausbreitet. Bevor es zu schneien begann, waren wir schläfrig. Jetzt sind wir übermütig.
Wir laufen draußen vor dem Motel herum, nur in unseren abgetragenen Sommerschuhen, und strecken die nackten Hände nach den herabfallenden Schneeflocken aus, die Köpfe im Nacken, die Münder geöffnet, und schlucken den Schnee herunter. Wenn es mehr wäre und er dick am Boden läge, würden wir uns darin wälzen wie Hunde im Schmutz. Er erfüllt uns mit derselben Begeisterung. Aber unsere Mutter sieht aus dem Fenster und entdeckt uns draußen und auch den Schnee und ruft uns, damit wir reinkommen und unsere Füße mit den dünnen Handtüchern abtrocknen. Wir haben keine Winterschuhe, die uns passen. Während wir im Haus sind, verwandelt sich der Schnee in Graupel.
Mein Vater geht im Zimmer auf und ab, klimpert mit den Schlüsseln in seiner Tasche. Er möchte immer, dass alles schneller geht, und jetzt möchte er losfahren, aber meine Mutter sagt, er müsse die Pferde noch etwas zurückhalten. Wir gehen hinaus und helfen ihm, die Eiskruste von den Autofenstern zu kratzen, und dann tragen wir Kartons hinaus, und am Ende zwängen wir uns selbst ins Auto und fahren nach Süden. Ich weiß, es ist Süden, weil das Sonnenlicht von da kommt, es dringt jetzt schwach durch die Wolken, berührt mit einem Glitzern die vereisten Bäume und springt grell von den Eisflächen am Straßenrand zurück, sodass es schwierig ist, etwas zu erkennen.
Unsere Eltern sagen, wir fahren zu unserem neuen Haus. Diesmal wird uns das Haus richtig gehören, nicht nur gemietet sein. Es steht in einer Stadt, die Toronto heißt. Dieser Name bedeutet mir nichts. Ich denke an das Haus in meiner Schulfibel, weiß, mit einem Lattenzaun und einem Rasen davor und mit Gardinen an den Fenstern. Ich bin neugierig, wie mein Schlafzimmer aussieht.