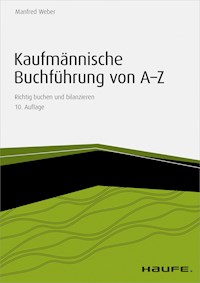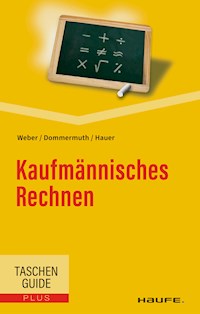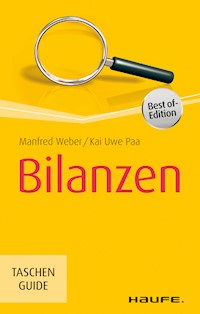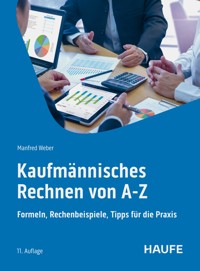
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Haufe Praxisratgeber
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch von Manfred Weber ist ein umfassendes Nachschlagewerk des Wirtschaftsrechnens und der praktischen Statistik. Es macht Sie fit für alle Entscheidungen, bei denen Sie auf eindeutige Zahlen und exakte Berechnungen angewiesen sind. Für die Praxis liefert es wichtige Formeln, Rechenhilfen und Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung, Kostenrechnung und Kalkulation, Investitions- und Wirtschaftlichkeitsrechnung, Erstellung aussagefähiger Statistiken. Mit ausführlichem Stichwortverzeichnis am Ende des Buchs. Inhalte: - Grundlegende kaufmännische Rechenverfahren: von Dreisatz über Prozent-, Zins- und Zinseszinsrechnen bis Diskontierung und Terminrechnen - Sorten-, Devisen- und Wertpapierrechnung - Kosten, Kalkulation und Deckungsbeiträge - Investitionsrechenverfahren, Statistik und Unternehmenssteuerung Neu in der 11. Auflage: - Finanzierung - Immobilien: Geldanlage und Finanzierung - Kapitalverwaltungsgesellschaften
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtImpressumVorwortSo nutzen Sie dieses BuchLexikonteilABC-AnalyseBeispiel: ABC-Analyse in der MaterialwirtschaftSo führen Sie eine ABC-Analyse durchAbschreibungenWelche Vermögensgegenstände können Sie abschreiben?Abschreibungen und AnschaffungskostenWodurch werden die Wertminderungen verursacht?Abschreibungen in der Bilanz und in der KostenrechnungPlanmäßige und außerplanmäßige AbschreibungenAbschreibungsverfahrenKapitalabbau durch AbschreibungenLineare Abschreibung mit gleichbleibenden BeträgenGeometrisch-degressive Abschreibung – fallende BeträgeDie Leistungsabschreibung – ein weiteres VerfahrenAktienkauf, -verkauf und -renditeRechenbegriffeAktienmarkt und RentenmarktDer Aktienhandel erfolgt über BankenAktienkaufAktienverkaufDividendenzahlungen und KursgewinneAktienrenditeEffektivverzinsung=1.550,07·100·36012.310,99·421=10,76%Aktienbewertung – Chartanalyse Aktienbewertung nach der FundamentalanalyseInvesting und TradingKursrisiken bei AktienEine Alternative sind AktienfondsDie Versteuerung von GewinnenAbgeltungsteuer für InvestorenAngebotsvergleichAngebotspreise vergleichenVergleich der QualitätAnnuitätenmethodeWie wird die jährliche Annuität ermittelt?Niedrigerer Zinssatz führt zu längerem KapitalrückflussÄquivalenzziffernkalkulationWas versteht man unter Sortenfertigung?Äquivalenzziffern und ÄquivalenzziffernkalkulationSo führen Sie die Äquivalenzziffernkalkulation ausBABDie Kostenartenrechnung steht am AnfangGemeinkosten auf die Kostenstellen übertragenAuch allgemeine Kostenstellen sind umzulegenKostenstellenrechnung mit dem BABWie lassen sich die Zuschlagsgrundlagen ermitteln?Verwaltungsgemeinkosten−Zuschlagssatz=Verwaltungsgemeinkosten·100HerstellkostenWelche Schritte Sie beim BAB beachten solltenZuschlagssätze ermitteln mit dem mehrstufigen BABMaterialgemeinkosten−Zuschlagssatz(MGKZ)=Materialgemeinkosten·100FertigungsmaterialHerstellkosten der Fertigung und des UmsatzesVerwaltungsgemeinkosten−Zuschlagssatz(VGKZ)=Verwaltungsgemeinkosten·100Herstellkostender FertigungStückkalkulationBarwertmethodeDiese Begriffe sollten Sie kennenAbzinsungMit der Barwertmethode Investitionen prüfenEin Investitionsprojekt durchrechnenDen Kapitalwert einer Investition ermittelnMit Barwertmethode Investitionsvorhaben auswählenBestellmengeWahl der BestellmengeDie optimale Bestellmengedurchschnittl.LagerbestandimZeitraum=Bestellmengeim Zeitraum2Formel zur Berechnung der optimalen BestellmengeBezugsrechtAltaktionäre werden durch das Bezugsrecht entschädigtDas BezugsrechtsverhältnisBezugsrechtswert – MischungsrechnungBezugsrechtswert – FormelBilanzkennzahlenAktivseite der Bilanz zeigt die VermögenslageUmlaufintensität=3.938.100·1007.517.300=52,4%Wie wird das Kapital aufgebracht?Kurz- und langfristiges FremdkapitalkurzfristigesFremdkapitalin%=kurzfristigesFremdkapital·100FremdkapitalVerschuldungsgrad – Fremdkapital zu EigenkapitalBeurteilung der FinanzierungBreak-even-AnalyseGesamtkosten und die ErlösgeradeE=m·pKapazitätsauslastung bestimmt Kosten und ErlöseStückkosten und StückerlöseErlösgerade und VerkaufspreiseVon der Gewinnschwelle zum GewinnmaximumCashflowWie Sie den Cashflow ermittelnBerechnung des CashflowsDie Finanz- und Ertragskraft eines UnternehmensIFRS und BilMoG verlangen eine KapitalflussrechnungCashflow-EigenkapitalrenditeCashflow-Gesamtkapitalrendite=Cashflow+Zinsen1% GesamtkapitalCashflow-UmsatzrenditeCashflow-UmsatzrenditeBerichtsjahr=559.43732.961,02=16,97%Cashflow-Kennzahl VerschuldungsfaktorInvestitionen und CashflowInvestition(Nettoinvestitionen)Cashflow=%Absoluter Cashflow und Cashflow-KennzahlenDarlehenFälligkeitsdarlehen und KündigungsdarlehenSinkende Zinsbelastungen beim AbzahlungsdarlehenKonstante Belastungen beim AnnuitätendarlehenSo berechnen Sie die AnnuitätAnnuität=K·qn·q−1qn−1Nominal- und EffektivzinsCheckliste: Worauf Sie bei der Bank achten solltenDeckungsbeitragsrechnungVerrechnung der Kosten auf die KostenträgerFehlentscheidungen mit der VollkostenrechnungDie Schwächen der VollkostenrechnungTeilkostenrechnungen wollen Kosten richtig zuordnenKostenarten und BeschäftigungsgradDie Grundtypen der Deckungsbeitragsrechnung Der DeckungsbeitragDie einstufige Deckungsbeitragsrechnung Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung eine ErweiterungKurzfristige Erfolgsrechnung mit der DeckungsbeitragsrechnungDie kurzfristige Preisuntergrenze berechnenDie rentabelsten Produkte feststellen und fördernDie Deckungsbeitragsrechnung mit relativen EinzelkostenDiskontierungAufzinsungDiskontierung führt zum BarwertFormeln zur Berechnung des BarwertsDiskontierungsmethode bei InvestitionsvorhabenDreisatzEinfacher Dreisatz mit geradem VerhältnisEinfacher Dreisatz mit ungeradem Verhältnisx=36·86=48Arbeitstage=BruchsatzZusammengesetzter DreisatzEffektivzinsMehr Transparenz durch EffektivzinssatzangabeDen Effektivzinssatz ermittelnp=Z·100·360K·tEffektivzinsermittlung bei Disagio mit der FormelLieferantenkredit oder Bankkredit?Anfänglich effektiver JahreszinsMit Bankkredit finanzierte SkontoinanspruchnahmeEffektivverzinsung von WertpapierenFestverzinsliche WertpapiereGläubigerpapiere und TeilhaberpapiereNennwert und KurswertKurswert=Nennwert·Kurs100Kauf einer AnleiheVerkauf einer AnleiheDie Effektivverzinsung von AnleihenEffektivzinsp=535,39·100·3607.966·456=5,31%Umlaufrenditen festverzinslicher WertpapiereBerechnung der Rendite mit der FormelSonderformen festverzinslicher WertpapiereBonität und Rating von AnleihenChancen und Risiken bei der GeldanlageGläubigerpapiereGeldpolitik der EZBInvestieren bei NiedrigzinsenInvestmentfonds sind oft die bessere AlternativeFinanzierungFinanzierung und InvestitionenAußenfinanzierung und InnenfinanzierungEigenfinanzierung: Kapitalbeschaffung über die Eigentümer oder aus eigener KraftFremdfinanzierung: Kapitalbeschaffung über DritteLangfristiges FremdkapitalKurzfristiges FremdkapitalAnlageintensität – bedeutsam für die FinanzierungHandelskalkulationEinkaufskalkulationVerkaufskalkulationDie Kostenartenrechnung steht am AnfangHandlungskosten und HandlungskostenzuschlagssatzHandlungskostenzuschlag(HKZ)=67.500·100250.000=27%Differenzierte HandlungskostenzuschlagssätzeVon den Selbstkosten zum BarverkaufspreisVom Bar- zum ZielverkaufspreisVom Zielverkaufspreis zum NettoverkaufspreisDer Bruttoverkaufspreis enthält auch die UmsatzsteuerHandelskalkulation mit nur einem ZuschlagssatzHandelsspanneHandelsspanne=(600−384)·100600=36%KalkulationsfaktorImmobilienNeu bauen oder Bestandsimmobilie erwerben?Einfamilienhaus und EigentumswohnungBestandsimmobilien erwerben und sanierenBaufinanzierungDen Hausbau und gewerbliche Objekte richtig finanzierenFinanzierungsgrundsätze für EigenheimeDen Kauf einer Immobilie finanzierenFolgen einer falschen FinanzierungEigenheim vs. Renditehaus – unterschiedliche steuerliche BehandlungIndexzahlenMesszahlen und IndexzahlenPreisindex von LaspeyresPreisindex von PaascheDie Geldentwertung messenMit mehreren Indices die Geldentwertung erfassenVerbraucherpreisindexInflationserwartungenDeutsche AktienindicesAndere wichtige AktienindicesIndexfondsAktienindex-OptionenIndustrielle KostenrechnungKosten und LeistungenDie Aufgaben der Kosten- und LeistungsrechnungDie KostenrechnungDie Kostenstellenrechnung mit dem BABDie KostenträgerrechnungDie Kalkulationsmethode ist stark vom Fertigungsverfahren abhängigDie Zuschlagskalkulation rechnet mit Einzel- und GemeinkostenDas KostenträgerzeitblattIst-, Normal- und PlankostenrechnungInterner ZinsfußDer Kalkulationszinsfuß in der BarwertmethodeWie verzinst sich ein Investitionsobjekt?Internen Zinsfuß eines Investitionsprojektes ermittelnInvestitionsrechnungenErsatz-, Rationalisierungs- und ErweiterungsinvestitionenTechnische und wirtschaftliche Prüfung von InvestitionsvorschlägenStatische und dynamische InvestitionsrechnungenDie Investitionsalternative mit den geringsten KostenDie GewinnvergleichsrechnungDie Rentabilitätsrechnung erfasst den KapitaleinsatzAmortisationsrechnung berücksichtigt InvestitionsrisikoKalkulatorische KostenSachliche Abgrenzung und kostenrechnerische KorrekturenWelche kalkulatorischen Kosten gibt es?Kalkulatorische AbschreibungenKalkulatorische MieteKalkulatorische WagnisseKalkulatorischer UnternehmerlohnKalkulatorische ZinsenVerrechnung der kalkulatorischen KostenKapitalrückflussrechnungPay-back- oder Pay-off-MethodeDie Amortisationszeit berechnenDie Kapitalrückflussrechnung mit unterschiedlich hohen jährlichen RückflüssenKapitalverwaltungsgesellschaften (KVG)InvestmentfondsETFs (Exchange Traded Funds)Thesaurierende und ausschüttende FondsImmobilienfondsKaufmännische ZinsrechnungDie kaufmännische ZinsformelDie summarische ZinsrechnungVerzugszinsen=32.09845=713,29KennzahlenAbsolute und relative KennzahlenBilanzkennzahlenErfolgskennzahlenKennzahlen zu einzelnen UnternehmensbereichenMaterialwirtschaftFertigungVerkaufKGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)Ein Maßstab zur Beurteilung von AktienDas KGV zeigt die relative KurshöheDas KGV und ErtragssteigerungenDie richtige Aktienauswahl treffenKommissionsgeschäfteKommissionsgeschäfte im WirtschaftslebenRechnerische Darstellung von KommissionsgeschäftenEinkaufskommissionVerkaufskommissionKontokorrentkreditWas Sie der Kontokorrentkredit kostetKosten und BeschäftigungKapazitätBeschäftigung und BeschäftigungsgradWie hängen die Kosten vom Beschäftigungsgrad ab?Fixe KostenSprungfixe KostenVariable KostenGesamtkostenk=kf+kvGesetz der MassenproduktionLagerkennzahlenMindestbestand und MeldebestandDurchschnittlicher LagerbestandUmschlagshäufigkeit und durchschnittliche LagerdauerLagerkostensatz – eine andere KennzahlLagerkostensatz=3.750·100197.270=1,9%Die Lagerzinsen und den Lagerzinssatz berechnenLeasingLeasing – oft leichter als KaufImmobilien- und Mobilien-LeasingDie Vorteile des Auto-LeasingsLeasingverträge – worauf Sie achten solltenCheckliste: Vergleich Leasing und KreditkaufMittelwerteDer ModusDer MedianDas arithmetische MittelUngewogenes arithmetisches MittelGewogenes arithmetisches MittelDas geometrische MittelProduktivität und WirtschaftlichkeitProduktivität=Produktionsleistung (AusbringunginStück,m,kg,l)EinsatzvonMaterialmenge,Arbeitszeit, SachkapitalArbeitsproduktivität oder ArbeitszeitproduktivitätAnlagenproduktivität und KapitalproduktivitätKapitalproduktivität=AusbringungsmengeSachkapitalWirtschaftlichkeit ist eine ökonomische KennzahlVergleich von Produktivität und WirtschaftlichkeitProzentrechnungProzentrechnung und PromillerechnungProzentrechnung als BruchrechnungBegriffe der ProzentrechnungBerechnung des ProzentwertesBerechnung des ProzentsatzesBerechnung des GrundwertesProzentrechnung vom vermehrten Grundwert (auf Hundert)Prozentrechnung vom verminderten Grundwert (im Hundert)ProzesskostenrechnungEin neuer Denkansatz in der KostenrechnungBessere Verrechnung der GemeinkostenHauptprozess – zusammenhängende TeilprozesseTeilprozesse und KostentreiberProzesskostensätze ermittelnProzesskostenrechnung mit StundensätzenProzesskostenrechnung ein Instrument des ControllingsRentabilitätEigenkapitalrentabilität ein Erfolgsmaßstab GesamtkapitalrentabilitätEigenkapitalrentabilität und FremdkapitalLeverage-EffektUmsatzrentabilitätReturn on Investment (ROI)UmsatzrentabilitätKapitalumschlagROI – Umsatzrentabilität und KapitalumschlagRückwärtskalkulationVom Bruttoverkaufspreis zum EinkaufspreisDifferenzkalkulationStatistikModerne StatistikPrimärstatistikPanelSekundärstatistikEmpirische Wahlforschung analysiert das WahlverhaltenStichprobenGrundgesamtheitStichprobe und GrundgesamtheitHomograde Statistik – qualitative MerkmaleHeterograde Statistik – quantitative MerkmaleVollerhebungen oder TotalerhebungenStichproben müssen repräsentativ seinPanel und OmnibusbefragungMikrozensusWahrscheinlichkeit und StichprobenWahrscheinlichkeitsrechnung bei Warenprüfungen und in der QualitätskontrolleAdditionssatz und Multiplikationssatz der WahrscheinlichkeitP=P(A)·P(B)P=0,5·0,5P=0,25NormalverteilungStichprobe und GrundgesamtheitStreuungsmaßeUnterschiedliche Struktur statistischer MassenSpannweiteDurchschnittliche Abweichungd=∑i=15xi−x‾·fi=22Standardabweichung=∑i=1nxi−x‾·fi∑i=1nfi=869=3,0912VarianzTarget CostingZielkosten vom Markt ableitenTarget Costing – ein KostenmanagementsystemKundenwünsche und Anforderungen an das ProduktDie sieben Schritte im Target CostingVom Marktpreis zu den ZielkostenFunktionen und Komponenten mit den Zielkosten abstimmenTerminrechnungBerechnung des mittleren Verfalltages (MVT)Ermittlung des RestzahlungsterminsTrendanalyseDie Komponenten einer ZeitreiheTrend (t)Zyklische Komponente (z)Saisonkomponente (s)Irreguläre Komponente (r)y=ti+zi+si+riFreihandmethodeMethode der beiden ReihenhälftenVerfahren der gleitenden MittelwerteMethode der kleinsten QuadrateBereinigung saisonaler SchwankungenUmsatzentwicklung und -analyseUmsatzanalyse nach ProduktenUmsatzanalyse nach AbsatzgebietenVerteilungsrechnungVorkalkulationKalkulation zu verschiedenen ZeitpunktenVorkalkulation – eine Perioden- und eine StückrechnungVorkalkulation auf der Basis der VollkostenrechnungKostenkontrolleWährungsrechnungEuro-Beträge in ausländische WährungAusländische Währungen in Euro umrechnenEuro−Betrag=Betragin AuslandswährungKursAnkaufskurse und Verkaufskurse der BankenWie kommen Devisenangebot und Devisennachfrage zustande?Devisenkurse werden an der Devisenbörse gebildetBanken im Devisen- und SortengeschäftDevisenarbitrageDevisenkassamarkt und DevisenterminmarktWie unterscheiden sich Devisentermingeschäfte und Devisenoptionen?FremdwährungenWertschöpfung – Shareholder-ValueWertschöpfung eines UnternehmensDie WertschöpfungsrechnungVon der Wertschöpfung zum Shareholder-ValueWie kann der Shareholder-Value berechnet werden?Mit welchen Maßnahmen kann dies erreicht werden?ZinsrechnenZins und ZinssätzeGegenüberstellung von Prozent- und ZinsrechnungBerechnen der ZinsenJahreszinsenZ=25.000·5·4100·12=416,67 EuroTageszinsenZ=45.000·8,5·220100·360Berechnung der Tage in der ZinsrechnungBerechnung der Zinstage im AuslandEurozinsmethodeBerechnen von Kapital, Zinssatz und Zeitt1=42,13·100·3607.200·9=23,4 TageZinsrechnung auf und im HundertFreigrenzen für KapitaleinkünfteZinseszinsGegenüberstellung von Zins- und ZinseszinsrechnungAufzinsungTabellen und ZinstafelnAnfangskapital=EndkapitalAufzinsungsfaktorEntwicklung des Endkapitals bei Zins und ZinseszinsAbzinsung von KapitalDie Auswirkungen von NiedrigzinsenZuschlagssätzeKalkulation mit Ist- und NormalzuschlagssätzenAnhangFormelnProzentrechnungZinsrechnungAllgemeine ZinsformelKaufmännische ZinsrechnungZinseszinsrechnungAbschreibungIndexzahlenKalkulationSorten- und DevisenrechnungRechenhilfenRechnen mit der UmsatzsteuerDie Umsatzsteuer aus dem Bruttobetrag herausnehmenDen Nettobetrag direkt aus dem Bruttobetrag ermittelnLieferantenkredit oder Bankkredit?Maße und GewichteLängeneinheitenFlächeneinheitenRaumeinheiten (Volumeneinheiten)GewichtseinheitenAufzinsungstabellenAbzinsungstabellenStichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-648-18847-7
Bestell-Nr. 01005-0008
ePub:
ISBN 978-3-648-18850-7
Bestell-Nr. 01005-0100
ePDF:
ISBN 978-3-648-18848-4
Bestell-Nr. 01005-0151
Manfred Weber
Kaufmännisches Rechnen von A-Z
11. aktualisierte und überarbeitete Auflage, September 2025
© 2025 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Munzinger Str. 9, 79111 Freiburg
www.haufe.de | [email protected]
Bildnachweis (Cover): © ktasimarr, iStock
Produktmanagement: Dipl.-Kfm. Kathrin Menzel-Salpietro
Lektorat: Helmut Haunreiter
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Der Verlag behält sich auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Vorwort
Kaufmännische Rechenoperationen sind für alle wichtig, die sich mit Zahlen im Unternehmen oder im Rahmen der Geldanlage befassen müssen. Formeln und Rechenverfahren geraten aber leicht in Vergessenheit, wenn man sie längere Zeit nicht anwendet. Deshalb sollten Sie ein Nachschlagewerk besitzen, in dem Sie Erklärungen zu Rechenverfahren und Formeln mit Rechenbeispielen finden. Dafür ist die Lexikonform optimal.
Die folgenden Themenbereiche werden behandelt:
Dreisatz, Prozent-, Zins- und Terminrechnen
Zinseszinsrechnen und Diskontierung
Sorten-, Devisen- und Wertpapierrechnung
Kosten, Kalkulation und Deckungsbeiträge
Investitionsrechenverfahren und Statistik
Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung
Formelsammlung im Anhang
Das Buch soll dem Praktiker in Industrie und Dienstleistung ein Leitfaden sein. Gut eignet es sich auch in der beruflichen Weiterbildung und im Studium.
Frau Dipl.-Kfm. Kathrin Menzel-Salpietro danke ich für die Unterstützung bei der Überarbeitung und Aktualisierung der 11. Auflage.
Aichhalden/Schwarzwald
Manfred Weber
So nutzen Sie dieses Buch
Das Buch ist ein umfassendes Nachschlagewerk des Wirtschaftsrechnens und der praktischen Statistik. Auf Ihre Fragen sollten Sie schnell die einschlägigen Antworten finden können. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Das alphabetische Inhaltsverzeichnis gibt Ihnen einen Überblick über die behandelten Stichwörter.
Im Buch können Sie auch nach den im Vorwort genannten Themenbereichen vorgehen.
Eine Antwort auf Ihre Frage können Sie ferner über die Formelsammlung im Anhang und die Verweisstichwörter finden.
Stets können Sie auch über das ausführliche Stichwortverzeichnis am Ende des Buchs den Einstieg finden.
Vom Nachschlagewerk zum Lehrbuch
Ein Lehrbuch hat einen methodischen Aufbau und geht »Schritt für Schritt« vor. Kaufmännisches Rechnen von A-Z gliedert sich inhaltlich in 7 Bereiche, die im Folgenden dargestellt sind. Wenn Sie die unterhalb eines Bereichs aufgelisteten Stichwörter in der vorgegebenen Reihenfolge lesen, erhalten Sie einen Einstieg in die Thematik und gewinnen fortschreitend mehr Detailwissen.
Sinnvoll kann es auch sein, dass Sie nur die Themenbereiche systematisch lesen, die Sie besonders interessieren.
Im Folgenden nun die 7 Themenbereiche:
Grundlegende kaufmännische Rechenverfahren
Dreisatz → Währungsrechnung → Verteilungsrechnung → Prozentrechnen → Zinsrechnen → Kaufmännische Zinsrechnung → Terminrechnung → Zinseszins
Kostenrechnung
Abschreibungen → Abschreibungsverfahren → Kalkulatorische Kosten → BAB → Zuschlagssätze → Industrielle Kostenrechnung/Kalkulation → Prozesskostenrechnung → Kosten und Beschäftigung
Kalkulation
Äquivalenzziffernkalkulation → Angebotsvergleich → Handelskalkulation → Vorkalkulation → Rückwärtskalkulation → Target Costing → Deckungsbeitragsrechnung
Statistik
Statistik → Mittelwerte → Streuungsmaße → Stichproben → Indexzahlen → Trendanalyse → Umsatzentwicklung und -analyse
Finanzen und Geldanlage
Effektivzins → Bilanzkennzahlen → Rentabilität → Festverzinsliche Wertpapiere → Aktienkauf, -verkauf und -rendite → Bezugsrecht → Trendanalyse → KGV → Indexzahlen
Finanzierung und Investition
Darlehen → Kontokorrentkredit → Bilanzkennzahlen → Kapitalrückflussrechnung → Diskontierung → Barwertmethode → Annuitäten → Interner Zinsfuß → Cashflow → Investitionsrechnung → Leasing
Unternehmenssteuerung und Kennzahlen
Kennzahlen → ABC-Analyse → Bestellmenge → Lagerkennzahlen → Produktivität und Wirtschaftlichkeit → Break-even-Analyse → Return on Investment (ROI) → Wertschöpfung
Lexikonteil
ABC-Analyse
Aufgabe der ABC-Analyse ist es, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden. Der Grundgedanke ist, dass unter einer Vielzahl von auftretenden Erscheinungen letztlich nur wenige wirklich wichtig sind. Entsprechend ihrer jeweiligen Bedeutung werden die Ereignisse den Klassen A, B und C zugeordnet.
Beispiel: ABC-Analyse in der Materialwirtschaft
Ein wichtiges Hilfsmittel der Beschaffungsplanung ist in der Industrie und im Handel die ABC-Analyse. Untersuchungen in der Praxis zeigen, dass vielfach auf eine geringe Anzahl oft benötigter und häufig auch teurer Materialsorten ein großer Teil der gesamten Materialkosten entfällt. Dagegen verursachen die meisten anderen Materialien vergleichsweise geringe Kosten, weil sie am Einkaufsumsatz unterdurchschnittlich beteiligt sind.
Bei der ABC-Analyse werden die verschiedenen Materialpositionen, die Artikel, sowohl mengenmäßig als auch wertmäßig dargestellt. Die einzelnen Artikel werden dann nach der Rangfolge der Werte geordnet. Alle Werte werden addiert. Der Gesamtwert wird dann in einen A-, B- und C-Bereich aufgeteilt.
Beispiel: ABC-Analyse
Güter
Mengenanteil in %
Wertanteil in %
A-Güter
15 %
80 %
B-Güter
35 %
15 %
C-Güter
50 %
5 %
A-Güter sind im Beispiel mit einem Anteil von 15 % an der Gesamtzahl aller Materialien beteiligt, sie erreichen aber wertmäßig 80 %.
Die zu den B-Gütern zählenden Materialien sind mittelwertige Güter. Im Beispiel erreichen 35 % der Materialpositionen einen wertmäßigen Anteil von 15 %.
C-Güter sind mit 50 % zahlenmäßig stark vertreten, erreichen aber mit 5 % nur einen kleinen Anteil des gesamten Einkaufswerts. Hier können deshalb auch kostengünstige Planungs-, Dispositions- und Beschaffungsverfahren eingesetzt werden.
Praxis-Tipp
Die ABC-Analyse zeigt Ihnen, worauf Sie sich bei Ihren EinkaufsverhandlungenEinkaufsverhandlungen konzentrieren müssen. Der Einkauf muss sich bei A-Gütern intensiv um günstige Preise und vorteilhafte Lieferungs- und Zahlungsbedingungen bemühen. Bei den umsatzstarken Gütern können Sie schon durch etwas bessere Konditionen nachhaltige Erfolge erzielen.
Die hohe Kapitalbindung bei den A-Gütern erfordert auch knappere Lagerbestände. Eine genaue Lagerbuchführung ist für diese Güter notwendig, auch die bedarfsgesteuerte Materialdisposition ist anzuwenden.
Die ABC-Analyse zeigt Ihnen aber auch, bei welchen Gütern Sie in den Einkaufsverhandlungen und in der Lagerhaltung großzügiger sein können, nämlich den C-Gütern. Infolge ihres geringen Werts verursachen sie keine hohen Zinskosten, auch die Auswirkungen auf die Liquidität sind geringer.
So führen Sie eine ABC-Analyse durch
Bei der Durchführung der ABC-Analyse werden die Bedarfsmengen der einzelnen Materialpositionen mit dem Einstandspreis multipliziert. Sie erhalten eine ungeordnete Aufstellung der Artikel.
Danach sind die Artikel nach der Höhe des Einkaufsvolumens zu ordnen. Die Rangfolge ergibt sich aus den fallenden Bedarfswerten bzw. den fallenden Prozentwerten. Die Auswertung ist der letzte Schritt der ABC-Analyse.
Artikel (A)
Beschaffungsmenge/Stück
Preis je Stück in Euro
Beschaffungsvolumen in Euro
Artikelposition an der Gesamtzahl
%
Anteil am Beschaffungsvolumen
%
Rang-folge
A 1
2.420
0,70
1.694
1,23
1,38
8
A 2
320
0,25
80
0,16
0,07
20
A 3
1.700
22,00
37.400
0,87
30,49
2
A 4
500
5,00
2.500
0,26
2,04
6
A 5
15.300
0,32
4.896
7,81
3,99
4
A 6
700
1,80
1.260
0,36
1,03
12
A 7
8.400
0,05
420
4,29
0,34
18
A 8
180
3,50
630
0,09
0,51
15
A 9
2.000
1,20
2.400
1,02
1,96
7
A 10
32.400
0,09
2.916
16,53
2,38
5
A 11
900
0,60
540
0,46
0,44
17
A 12
4.200
0,20
840
2,15
0,68
14
A 13
750
1,60
1.200
0,38
0,98
13
A 14
55.000
1,00
55.000
28,06
44,83
1
A 15
1.200
1,20
1.440
0,61
1,17
11
A 16
3.000
0,50
1.500
1,53
1,22
9
A 17
610
0,20
122
0,31
0,10
19
A 18
11.200
0,05
560
5,71
0,46
16
A 19
49.400
0,03
1.482
25,21
1,21
10
A 20
5.800
1,00
5.800
2,96
4,72
3
195.980
122.680
100,00
100,00
Tab. 1: Bestimmung der Rangfolge der Artikel nach ihrem Wert
Artikel (A)
Beschaffungsvolumen Euro
Anteil Beschaffungs-volumen %
Anteile in % kumuliert
Wertegruppe
A 14
55.000
44,83
44,83
A
A 3
37.400
30,49
75,32
A
92.400
A 20
5.800
4,72
4,72
B
A 5
4.896
3,99
8,71
B
A 10
2.916
2,38
11,09
B
A 4
2.500
2,04
13,13
B
A 9
2.400
1,96
15,09
B
18.512
A 1
1.694
1,38
1,38
C
A 16
1.500
1,22
2,60
C
A 19
1.482
1,21
3,81
C
A 15
1.440
1,17
4,98
C
A 6
1.260
1,03
6,01
C
A 13
1.200
0,98
6,99
C
A 12
840
0,68
7,67
C
A 8
630
0,51
8,18
C
A 18
560
0,46
8,64
C
A 11
540
0,44
9,08
C
A 7
420
0,34
9,42
C
A 17
122
0,10
9,52
C
A 2
80
0,07
9,59
C
11.768
Tab. 2: Artikeldatei nach der Höhe des Beschaffungswerts
Güter
Artikel
Artikelpositionen
Beschaffungsvolumen %
Beschaffungsvolumen
A
A 14, A 3
10 %
75,32 %
92.400
B
A 20, 5, 10, 4, 9
25 %
15,09 %
18.512
C
Übrige Artikel
65 %
9,59 %
11.768
100 %
100,00 %
122.680
Tab. 3: ABC-Analyse: Beschaffungsvolumen nach A-, B- und C-Gütern
Siehe auch: → Bestellmenge, → Lagerkennzahlen
Abschreibungen
Die Wertminderungen der Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens werden durch Abschreibungen erfasst. Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) hat die Abschreibungsvorschriften für Kapitalgesellschaften und Personenunternehmen vereinheitlicht.
Welche Vermögensgegenstände können Sie abschreiben?
Nicht abgeschrieben werden Vermögensgegenstände, deren Wert sich im Zeitablauf nicht mindert. So gehören unbebaute Grundstücke oder Beteiligungen zum nicht abnutzbaren AnlagevermögenAnlagevermögen.
Die Wertminderung beim abnutzbaren Anlagevermögen wird durch bilanzielle Abschreibungen berücksichtigt. Das bewegliche Anlagevermögen wie Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und Anlagen sowie Fahrzeuge unterliegt einem schnelleren Werteverzehr als das unbewegliche Anlagevermögen (Verwaltungsgebäude, Fertigungs- und Lagerhallen).
Forderungen im Umlaufvermögen sind ein anderer Abschreibungsschwerpunkt. Uneinbringliche Forderungen sind voll und zweifelhafte Forderungen teilweise abzuschreiben.
Abschreibungen und Anschaffungskosten
Die Anschaffung von Anlagegütern verursacht Anschaffungskosten:Anschaffungskosten den Kaufpreis des Anlagegutes (ohne Umsatzsteuer) zuzüglich Anschaffungsnebenkosten wie Fracht, Versicherung und Montagekosten. Nachlässe wie Rabatte und Skonti vermindern die Anschaffungskosten. Diese können relativ leicht anhand der vorliegenden Rechnungen bestimmt werden.
Abnutzbare Vermögensgegenstände sind in der Handelsbilanz und in der Steuerbilanz zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, anzusetzen. Abschreibungen erfassen die Wertminderungen und bewirken eine Verringerung des BuchwertsBuchwerts der Anlagegüter.
Da der Wertverlust nur geschätzt werden kann, sind auch die Abschreibungen nur Schätzungen. Dies gilt auch für den Restvermögenswert eines Anlageguts in der Bilanz.
Wodurch werden die Wertminderungen verursacht?
WertminderungenDie Benutzung eines Gegenstands führt zu einem natürlichen Verschleiß, Abschreibung durch Gebrauch.
Der technische Fortschritt führt zu verbesserten Fertigungsanlagen, wodurch alte Anlagen an Wert verlieren.
Nachfrageverschiebungen bewirken, dass bestimmte Produkte in der Käufergunst verlieren. Dies hat Auswirkungen auf den Wert der Fertigungsanlagen.
Ein natürlicher Verschleiß ist auch festzustellen, wenn ein Anlagegut überhaupt nicht genutzt wird. Es verliert durch Witterungsseinflüsse oder Veralterung an Wert.
Abschreibungen in der Bilanz und in der Kostenrechnung
Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind die Bezugsbasis für die bilanzielle AbschreibungBilanzielle Abschreibung (§ 253 HGB). Der Wertverlust wird als Abschreibung gebucht und als Aufwand in der Gewinn‑ und Verlustrechnung erfasst. Die bilanzielle Abschreibung vermindert den Gewinn, was wiederum zu einer Steuerersparnis führt.
Bei Kapitalgesellschaften ist die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens in der Schlussbilanz oder im Anhang darzustellen (§ 268 Abs. 2 HGB). Die historischen Anschaffungswerte und die kumulierte Abschreibung sind anzugeben.
Praxis-Tipp
Das Steuerrecht spricht von Absetzung für Abnutzung (AfAAfA). Während der Unternehmer die normale AfA vornehmen muss, hat er bei Sonderabschreibungen und erhöhten Abschreibungen ein Wahlrecht.
Bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) ist zwischen privaten Überschusseinkünften und Gewinneinkünften zu trennen (siehe Stichwort »Abschreibungsverfahren«). Sie können bei den privaten Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit, Kapitalvermögen sowie Vermietung und Verpachtung Wirtschaftsgüter bis 410 Euro netto ohne Umsatzsteuer sofort als Werbungskosten abziehen. Das Wirtschaftsgut muss aber beweglich, abnutzbar und selbstständig nutzbar sein, z. B. der Arbeitsstuhl im häuslichen Arbeitszimmer. Das Wahlrecht der Aktivierung bleibt.
Die Anlagenbuchhaltung berechnet die Abschreibungen:
bilanzielle AbschreibungBilanzielle Abschreibung für die Handelsbilanz
Abschreibung für AbnutzungAbschreibung für Abnutzung (AfA) für die Steuerbilanz
kalkulatorische AbschreibungKalkulatorische Abschreibung für die Kostenrechnung
Die kalkulatorische Abschreibung erfasst die tatsächliche Wertminderung der Anlagegüter, da nur auf diese Weise die Selbstkosten und das Betriebsergebnis richtig ermittelt werden können. Das Unternehmen erhält die Gegenwerte der Abschreibungen aus den Verkaufserlösen wieder zurück. Die kalkulatorischen Abschreibungen sollten so hoch bemessen sein, dass auch die jahrelangen Preissteigerungen für Ersatzinvestitionen enthalten sind (→ Kalkulatorische Kosten).
Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen
Die planmäßige AbschreibungPlanmäßige Abschreibung berücksichtigt den zu erwartenden Wertverlust. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind in einem Abschreibungsplan auf die einzelnen Geschäftsjahre der Nutzung zu verteilen. Es handelt sich hier um die vorhersehbare Wertminderung.
Praxis-Tipp
Die Absetzung für Abnutzung (AfA) im Steuerrecht entspricht der planmäßigen Abschreibung.
Die außerplanmäßige AbschreibungAußerplanmäßige Abschreibung tritt durch unerwartete Ereignisse ein, z. B. technischer Defekt, Unfallschaden, Wassereinbruch. Das Anlagegut erleidet eine unerwartete Wertminderung.
Außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren Wert sind im Handelsrecht auf abnutzbare und nicht abnutzbare Anlagegegenstände vorzunehmen.
Siehe auch: → Abschreibungsverfahren, → Kalkulatorische Abschreibungen