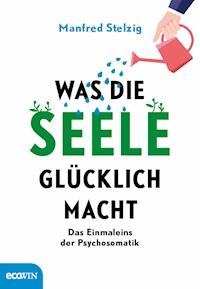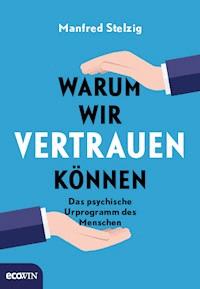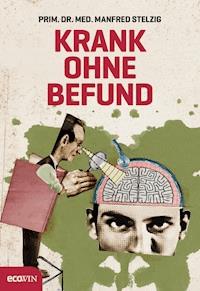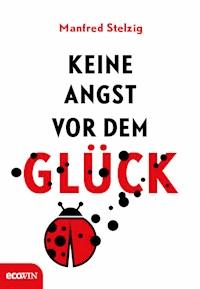
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ecowin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Seele Gutes tun Noch nie ist es uns objektiv gesehen so gut gegangen wie heute: steigende Lebenserwartung, hoher Lebensstandard, viel Freizeit. Trotzdem ist die subjektive Befindlichkeit der Mehrheit so schlecht wie noch nie – Stress, Angst, Depression, Panikattacken. Wie kann das sein? Um all die Anforderungen, die an uns jeden Tag in Beruf und Alltag gestellt werden, auch bewältigen zu können, müssen wir nicht nur körperlich, sondern vor allem auch psychisch im Gleichgewicht sein. Regelmäßige Psychohygiene ist unumgänglich. Manfred Stelzig zeigt anhand konkreter Beispiele aus seiner Praxis, wie man mit ganz einfachen Übungen den eigenen Seelengarten jeden Tag in Ordnung bringen und Hindernisse auf dem Weg zum Glück überwinden kann. Der Bestseller des Erfolgsautors in einer einmaligen Sonderausgabe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Stelzig
KEINE ANGSTVOR DEM GLÜCK
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältigerBearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw.
Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
6. Auflage 2017
© 2008 Ecowin Verlag bei Benevento Publishing,
eine Marke der Red Bull Media House GmbH,
Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Gesetzt aus der Sabon
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Lektorat: Arnold Klaffenböck
Satz: Druckerei Theiss GmbH, Austria
Umschlaggestaltung: b3K design, Andrea Schneider, diceindustries
Printed in Slovakia
ISBN 978-3-7110-0145-0
eISBN 978-3-7110-5212-4
Für Oliver und Jeremias
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Das Phänomen „Angst vor dem Glück“
1. Aberglaube
2. Gesetz der Entropie
3. Bad news are good news
4. Wer hoch steigt, fällt tief
5. Die Angst vor dem Neid anderer
6. Die Erbsünde
7. Das Peter-Prinzip
8. Die Schwarze Pädagogik
9. Die Abhängigkeit
10. Die Gegenabhängigkeit
11. Die verschränkte Verantwortung
12. Identifikation mit dem Aggressor
13. Das Stockholm-Syndrom
14. Die Opferrolle
15. Die Angst vor der Selbstbefriedigung
16. Problemeskalation
17. Die Idealisierung und Dämonisierung
18. Die Kommunikation hinter dem Rücken
19. Fürchtet euch nicht
20. Die Angst vor dem Tod
Die Not mit der Psyche
Die Ureichung des Menschen
Was mache ich, wenn ich das Glücklichsein verlernt habe?
Der Seelengarten
Das Seelenhaus
Übungen zum Aufbau des Seelenhauses
Das Fundament, der Keller, die Basis
Die Kuschelübung
Die Begegnung mit sich selbst
Die Übung mit dem Spiegel
Die Schoßplatzübung
Aktives Verwöhnen
Die Selbstbeelterung oder Neubeelterung
Die Urelternübung
Die Erotik
Die Übung mit dem inneren Liebhaber
Die Übung mit den Urbildern aus Zeitschriften
Die Lebendigkeit (Der Lustfaktor!)
Bewegung
Die Stresswaage
Die Leistungsetage
Beziehungs- und Liebesfähigkeit
Erkenntnis und Wissen
Die Übung mit der göttlichen Instanz
Das Bauchhirn
Das vegetative Nervensystem
Der Sympathikus
Der Parasympathikus
Die Chemie des Gehirns
Serotonin
Noradrenalin
Adrenalin
Cortisol
Glutamat
Gammaaminobuttersäure
Acetylcholin
Dopamin
Endorphine
Oxytocin
Das Phänomen Stress
Ein Loblied auf die Medikamente
Die am häufigsten verwendeten Substanzen
Benzodiazepine
Die Depression
Die Negativspirale
Die Positivspirale
Schlafstörungen
88 Tipps für die seelische Gesundheit
Hinweise auf Literatur und Links
Der Autor
Vorwort
Als mich der Verleger Hannes Steiner anrief und mich einlud, ein Buch mit dem Titel „Keine Angst vor dem Glück“ zu schreiben, willigte ich sofort begeistert ein. Es ist mir ein Anliegen, das mir schon länger auf dem Herzen liegt, schließlich ist die Angst vor dem Glück ein weit verbreitetes Thema, das viele Menschen bewusst und unbewusst beschäftigt. Es drängt sich in meiner täglichen Arbeit als Psychiater und Psychotherapeut immer wieder in den Vordergrund oder erschwert aus dem Hinterhalt die konstruktive Arbeit. Außerdem gibt es mir die Möglichkeit, über die psychische Gesundheit zu schreiben, einen zentralen Aspekt in unserer Gesellschaft, der bislang zu wenig Beachtung findet.
In vielen psychotherapeutischen Gesprächen werden von den Menschen, die zu mir kommen, immer wieder ähnliche Themen angeschnitten. Offensichtlich besteht hier großes Informationsbedürfnis und Aufklärungsbedarf. Das Wissen über psychische Gesundheit sollte zur Basisinformation jedes Menschen gehören, damit er positiv und aktiv damit umgehen kann, um Glück und psychische Gesundheit gestalten zu können.
Meinem Sohn Oliver und seinem Freund Jeremias habe ich dieses Buch gewidmet, weil sie mich im Urlaub beim Schreiben neugierig, interessiert und mit Freude beobachtet haben.
Ich bedanke mich bei meiner Frau Renate, die mit viel Verständnis und Geduld das Werden dieses Buches begleitet hat, und bei meinen Kindern Nikolaus, Isabella, Dominik und Oliver, da sie doch einige Stunden, die eigentlich für sie reserviert waren, der Entstehung dieses Buches abgetreten haben.
Brigitte Gstöttner hat in ihrer fröhlichen Art verlässlich die Schreibarbeiten übernommen und mit ihrem Schwung bei der Verwirklichung dieses Buches geholfen.
Stolz bin ich auf mein Team der Psychosomatik, das mich bei meiner Arbeit tatkräftig unterstützt und für Anregungen sorgt. Dass viele Themen, die in diesem Buch besprochen werden, im tagtäglichen Leben positiv umgesetzt werden können, ist dem Engagement meiner Mitstreiter zu verdanken.
Mein Dank gilt auch Hannes Steiner für seine persönlichen Anregungen und sein engagiertes Begleiten dieses Buches.
Ein großes „Danke“ möchte ich nicht zuletzt meinen Patienten aussprechen, die mit ihrer Offenheit und ihrem Vertrauen meine Einsicht in die wiederkehrenden Themen ermöglicht haben. Gleichzeitig darf ich betonen, dass die in diesem Buch enthaltenen Fallbeispiele anonymisiert und so weit verändert sind, dass keiner identifiziert werden kann. Sollten Sie selbst den Eindruck haben, dass Ihre Lebens- und Leidensgeschichte erzählt wird, vergessen Sie bitte nicht, dass es sich um allgemeingültige Fallbeispiele handelt und daher auch viele andere Menschen beschrieben sein können.
Einleitung
Noch nie ist es uns objektiv gesehen so gut gegangen wie heute: steigende Lebenserwartung, hoher Lebensstandard, viel Freizeit und alles, was die Spaßgesellschaft sonst noch an netten Dingen zu bieten hat. Trotzdem ist die subjektive Befindlichkeit der Mehrheit so schlecht wie noch nie – Stress, Angst, Depression, Panikattacken. Wir sind psychisch krank! Wie kann das sein?
Unsere heutige Hochgeschwindigkeitsgesellschaft verlangt von uns Dinge, auf die wir durch die langsame Evolution einfach nicht vorbereitet waren. Um all die Anforderungen, die an uns jeden Tag im Beruf und im Alltag gestellt werden, auch bewältigen zu können, müssen wir nicht nur körperlich, sondern vor allem auch psychisch im Gleichgewicht sein. So, wie der Mensch des 20. Jahrhunderts gelernt hat und lernen musste, dass er nach einem ganzen Tag im Büro regelmäßig für seinen Körper etwas tun muss, so wird der Mensch des 21. Jahrhunderts lernen müssen, dass es ohne Psychohygiene nicht mehr gehen kann: Glück als Unterrichtsfach.
Stress, Überforderung, Reizüberflutung, Ausgebranntsein – Sie haben sich sicher schon selbst die Frage gestellt: „Wie soll das weitergehen?“ Sind wir diesen Gefahren hilflos ausgeliefert oder kann es uns gelingen, uns zu schützen oder noch besser: unser Leben aktiv und positiv zu gestalten und Belastungen als Herausforderung und Motivation zu sehen?
Glücklichsein kann man lernen. Dazu ist es notwendig, das Glück in seinen verschiedenen Facetten zu beschreiben, um das Ziel zu definieren, das wir erreichen wollen. Die einfachste Definition lautet: Glücklichsein heißt, sich in seiner eigenen Haut wohl zu fühlen, in zweiter Linie liebesfähig zu sein.
Viele Menschen haben Angst vor dem Glück. Sie fühlen sich sicherer in ihrem „wunschlosen Unglück“, wie Peter Handke geschrieben hat, und haben die Hoffnung und das Verlangen nach Glück aufgegeben. Es gibt viele verschiedene psychische Mechanismen, die bewirken, dass wir an unserem Unglück festhalten. Diese sind am Anfang des Buches beschrieben.
Das Kapitel „Die Not mit der Psyche“ widmet sich allgemeinen Überlegungen zur seelischen Gesundheit. Es ist kein Wunder, dass wir alle nicht daran gewöhnt sind, mit der Psyche, mit der Seele geübt umzugehen. Wir lernen es weder in der Schule noch im Berufsleben. Dabei ist es von größter Wichtigkeit, dass Sie beginnen, sich mit den Phänomenen der Psyche und der Seele auseinanderzusetzen, da ohne ein gewisses Maß an Verständnis der Zugang zur aktiven Gestaltung des seelischen Wohlbefindens versperrt sein wird.
Im Kapitel „Ureichung“ wird Ihnen das genetische Programm, das jeder Mensch in sich trägt und das ihm genau mitteilt, was er braucht, um glücklich zu sein, nähergebracht. Die Begriffe „Seelenhaus“ und „Seelengarten“ sind die plastischen Bilder, mit denen Ihnen die Struktur der menschlichen Seele und Psyche vermittelt werden sollen. Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie das Seelenhaus aufgebaut ist und welche Alternativen Sie haben, wenn Sie unglücklich sind, um wieder befreiter, getrösteter, sicherer oder bei schwierigen Erlebnissen mit diesen besser fertig zu werden. Viele Übungen veranschaulichen Ihnen, wie Sie Ihr Seelenhaus in den verschiedenen Etagen wieder festigen und wie Sie lernen können, sich in Ihrer Haut wieder wohler zu fühlen.
Das Kapitel „Die Chemie des Gehirns“ macht Sie mit den Grundbegriffen des Nervenstoffwechsels vertraut. Alles Denken und Fühlen wird durch Nervenbotenstoffe gesteuert. Hier finden Sie prägnante Erklärungen der biologischen Voraussetzungen und Funktionsweisen. Eng damit verbunden ist der nächste Teil, der sich mit den medikamentösen Möglichkeiten beschäftigt, wie die Stimmung und das Glücksgefühl positiv beeinflusst werden können. Über die großartigen Möglichkeiten der grässlicherweise „Antidepressiva“ genannten Medikamente kann man als Spezialist nicht genug berichten und schwärmen.
Die „88 Wohlfühltipps“ am Ende des Buches sollen Ihnen Anregungen geben, wie Sie Ihren Tag vom Aufstehen bis zum Schlafengehen positiver gestalten können: das tägliche „SeelenZähneputzen“ zur Erhaltung Ihrer seelischen Gesundheit.
Insgesamt soll Ihnen dieses Buch helfen, die Angst vor dem eigenen Glück zu überwinden. Es zeigt die Hindernisse auf, die einerseits die Gesellschaft vermittelt, die Sie andererseits selbst aufbauen und beim Gefühl des Glücklichseins im Wege stehen. Es bekämpft Aberglauben, zeigt Wege auf und bietet eine Orientierung, wie es möglich sein kann, glücklich zu werden.
Es tritt auch an, das Gefühl zu bekämpfen, dass das Psychische etwas Nebuloses ist, etwas nicht Benennbares, etwas, in dem man sich nicht auskennen kann. Sie werden Strukturen finden, die Ihnen wohlvertraut sind und bei denen Sie erkennend sagen: „Ja, genau so ist es! Warum ist das nicht schon früher so beschrieben worden?“
Sie sollen ein Buch in Händen halten, das für Sie Lesegenuss bedeutet – so wie der Lustfaktor überhaupt eine große Rolle in diesem Buch spielen soll. Ein Buch, das Sie mit Ihrem Bauch lesen können. Ein Buch, in dem Sie sozusagen vergnügt baden können, ein Buch, mit dem Sie sich wohl fühlen sollen.
So sehr es Ihnen helfen wird, sich besser in Ihrer Seele auszukennen und sich wohler zu fühlen, so wenig möchte es die Medizin, die Psychiatrie oder psychologische sowie psychotherapeutische Behandlungen in Frage stellen geschweige denn mit ihnen konkurrieren. Im Gegenteil: Es will Brücken bauen, soll die Seele besser verständlich machen und den Optimismus fördern, dass man als Betroffener Hilfe auch von Spezialisten in Anspruch nehmen kann und soll. Wer Hilfe annimmt, handelt richtig und verantwortungsbewusst.
Dieses Buch soll auch einen großen Beitrag leisten, das Psychische zu entstigmatisieren, und Vorurteile und Klischees abbauen.
Um einen besseren Lesefluss zu gewährleisten, verwende ich die männliche Form und hoffe, dass meine Leserinnen mir verzeihen.
Das Phänomen „Angst vor dem Glück“
1. Aberglaube
Angst vor dem Glück ist mit dem Aberglauben verknüpft, dass ein Mensch, der glücklich ist, mit etwas Negativem rechnen muss – quasi mit einer Bestrafung für das Glück. Das kann ein Schicksalsschlag oder eine Krankheit sein, etwas, das unausweichlich Menschen, die gerade noch glücklich waren, im nächsten Moment auf eine harte Probe stellt. Jener Aberglaube betrifft viele Menschen und es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesem zu begegnen.
Die häufigste ist die, dass man sich bemüht, nicht glücklich zu sein oder zumindest nicht allzu glücklich. Wenn man selbst immer etwas Negatives in sein Leben hineinmischt – Streit, Konflikte, Konkurrenz, Zorn –, so kann man die Götter besänftigen und muss sich nicht so sehr davor fürchten, dass sie Unheil schicken.
Wenn ich sage „die Götter“, dann deute ich schon an, wie alt dieser Aberglaube ist, wo er eine seiner Wurzeln hat. In der griechischen Mythologie ist die Strafe, die die Götter den Menschen auferlegen, etwas Selbstverständliches, Vertrautes und Gewohntes. Die Nymphe Hybris als Symbol für (menschliche) Selbstüberschätzung, Vermessenheit und Selbstüberhebung ruft die Göttin Nemesis auf den Plan, die im Sinne des gerechten göttlichen Zorns dieses frevelhafte Verhalten bestrafen muss. Auch Friedrich Torberg lässt Tante Jolesch sagen: „Gott soll einen hüten vor allem, was noch ein Glück ist“.
Umgekehrt versuchen viele Menschen, das Glück positiv zu beeinflussen. Sie tragen Amulette, Glücksbringer oder Rosenkränze, hängen sich die Schuhe ihrer Erstgeborenen auf den Rückspiegel des Autos oder Hufeisen über das Eingangstor, tragen Talismane oder befolgen bestimmte Rituale, um den Einfluss der bösen Geister abzuhalten.
Beispiel:
Angelika S. ist glücklich verheiratet, hat zwei Kinder und einen erfolgreichen Mann. Sie selbst arbeitet in einer Bank. Sie lebt in der ständigen Angst, dass ihr Glück vergänglich sein könnte. Wenn sie etwas Positives sagt, muss sie drei Mal auf Holz klopfen, um den Neid der Götter zu beschwichtigen. Bei jeder positiven Erfahrung in ihrem Leben wartet sie ängstlich auf das ausgleichende Negativereignis. Sie ist durch ihre Ängste deutlich in ihrer Lebensfreude eingeschränkt, da diese den Alltag überschatten.
Ihr Gatte ist wesentlich fröhlicher und leichtlebiger. Er versteht die Ängste seiner Frau nicht, kann sie auch nicht teilen und versucht, sie wiederholt aus diesen Ängsten herauszuholen und mit ihr etwas Schönes zu unternehmen. Es gelingt ihm auch immer wieder. Als jedoch kurz nach der Geburt ihres Sohnes der Vater stirbt, fühlt sich Angelika in allen ihren Ängsten bestätigt. Sie ist verunsichert und irritiert, klagt über Schlafstörungen und negatives Grübeln, sodass sie zu mir in Behandlung kommt. Sie kann von mir die Ansicht annehmen, dass man so einen Zustand auf drei Ebenen sehen muss: auf der biologischen, psychischen und sozialen.
Auf der biologischen Ebene war sie bereit, beruhigende Antidepressiva am Abend zu nehmen, wodurch sich die Schlafstörungen rasch besserten, und ein angstlösendes und stimmungsaufhellendes Antidepressivum (siehe Serotonin-Wiederaufnahmehemmer) am Morgen. Auf der psychotherapeutischen Ebene erarbeiteten wir, in welcher Weise sie selbst ihr Leben positiv strukturieren kann und wo ihr Grenzen gesetzt sind. Mit der Zeit erkannte sie, dass sie sich bei Weitem nicht so ausgeliefert fühlen muss, wie sie das jahrelang getan hatte. Durch Einsicht und konsequentes Üben von Trainingseinheiten, die in diesem Buch beschrieben werden, gelang es Angelika S., ihr Leben wesentlich positiver, konstruktiver und optimistischer zu gestalten und auch in ihren sozialen Beziehungen viel mehr Gemeinsamkeit und Glück zu finden.
Lösungsvorschlag:
Werden Sie sich des Phänomens „Angst vor dem Glück“ bewusst und überlegen Sie, wie weit Sie selbst davon betroffen sind. Ein Aberglaube dient meist dazu, eine Unsicherheit zu füllen, eine Wissenslücke notdürftig zu schließen. Daher hoffe ich, dass Sie nach der Lektüre dieses Buches mit den gesammelten Erfahrungen und dem neu erworbenen Wissen eine andere Grundeinstellung zu diesem Aberglauben haben werden als zuvor.
2. Gesetz der Entropie
Die zweite Form, der Angst vor dem Glück Rechnung zu tragen, ist die, dass man gar nicht versucht, glücklich zu sein oder jemanden glücklich zu machen. Wer nicht an das Glück glaubt, braucht auch keine Angst zu haben, es zu verlieren. Im Unglück zu verharren, gibt in gewisser Weise ein Gefühl von Sicherheit. Man ist an diesen Zustand gewöhnt. Es ist auch wesentlich einfacher, destruktiv als konstruktiv zu sein, und viel leichter, zu zerstören als aufzubauen. Das hat schon im Gesetz der Entropie seine Wurzel. Mit sich allein gelassen, strebt ein System dem Chaos zu, dem Zerfall.
Beispiel:
Christian B. ist Patient in der Jugendpsychiatriestation. Seinen Vater hat er nie kennengelernt, seine Mutter muss Geld verdienen, um sich und Christian durchs Leben zu bringen. Deshalb ist sie aber oft nicht zu Hause und Christian auf sich allein gestellt. In der Schule verhält er sich aggressiv und ist ständig in Raufhändel verwickelt. Als er schließlich einen Mitschüler so sehr in den Schwitzkasten nimmt, dass der Betroffene ins Spital eingeliefert werden muss (erfreulicherweise ist nichts Ernsthaftes passiert), wird er in die Jugendpsychiatrie eingeliefert. Dort lebt er weiter sein destruktives Verhalten. Er ist unkooperativ, rebellisch, aggressiv.
Erst die behandelnde Ärztin bringt ihn auf seine Sehnsüchte: auf eine Wunschmutter, die Zeit für ihn hat, die ihn schätzt, die ihn liebt; auf einen Wunschvater, der stolz auf ihn ist; und auf seine Trauer, dass diese Sehnsüchte zwar existieren, aber in der Realität bisher nicht erfüllt wurden. Aus dieser Einsicht kann Christian von den Übungen der Neubeelterung und der Schoßplatzübung (siehe S. 109 ff.) stark profitieren.
Lösungsvorschlag:
Das Urmenschliche ist nicht die Zerstörung, sondern der Aufbau, die Kreativität, die Weitsicht, die Planung der Zukunft, das Fürsorgliche und Verantwortungsbewusste, die Begegnung und die Liebe. Besinnen Sie sich auf das Urmenschliche.
3. Bad news are good news
Es ist auch erforderlich, dass Sie sich auf die positiven Seiten des Lebens einlassen wollen. Das ist nicht so selbstverständlich. Das Positive wird oft abgewertet und abgelehnt. Im Journalistendeutsch heißt es: „Bad news are good news.“ Nur die schlechten Nachrichten verkaufen sich gut und steigern die Umsatzzahlen. Positive Meldungen werden als rosarote Brille, als selbstverständlich oder als kindlicher Umgang mit der Realität eingestuft. Darum müssen Sie selbst in sich hineinhorchen und darauf achten, ob Sie sich auf das Positive einlassen wollen oder nicht.
Es gibt Menschen – und ich gehöre zum Teil auch dazu –, die die Tragödie der Komödie vorziehen. Beides ist jedoch notwendig. Moreno, der Begründer des Psychodramas, betonte, dass derjenige der Gesündeste sei, der die meisten Rollen in sich vereinen und diese auch auf der Lebensbühne spielen könne. Es ist also erforderlich, dass wir Leidende, aber auch Fröhliche, Traurige und Heitere, Tröster und Verzweifelte, Beschützer und Schutzbedürftige, Ängstliche und Mutige, Gute und Böse, Wütende und Versöhnliche sein können. Nur dadurch wird das Leben bunt und lebendig, kreativ und abwechslungsreich.
Beispiel:
Alfons G. besitzt ein großes Industrieunternehmen. Er ist Multimillionär, wohnt in einer wunderschönen Villa, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er lebt in der ständigen Angst, dass Einbrecher in sein Haus eindringen könnten. Aus diesem Grund hat er seine Villa zur Festung umgebaut. Dies beruhigt aber seine Angst nur wenig. Gleichzeitig befürchtet er, dass seine Kinder entführt werden könnten, und lebt in ständiger Sorge und Bekümmertheit. Obwohl er besonders erfolgreich ist, Zugang zu den höchsten Kreisen der Gesellschaft hat, glücklich verheiratet und auch mit seinen Kindern sehr zufrieden ist, kann er sich seines Lebens nicht erfreuen.
Durch die Psychotherapie gelingt es ihm, sich seiner eigenen persönlichen Wertigkeit bewusst zu werden und sich nicht über seinen Reichtum oder Erfolg zu definieren. Er erkennt, dass er in sich Rollen entwickeln muss, mit denen er seine Ängste bekämpfen und dass er diesen Schutz nicht an Alarmanlagen delegieren kann. Es sind Rollen der Wertschätzung, des Schutzes, der Geborgenheit, der Lebensfreude und des Glücks. Auf diesem Weg entwickelt er eine erfülltere Beziehung zu seiner Frau und seinen Kindern, kann die Möglichkeit eines Einbruchs als realistisch akzeptieren und die Gefahr einer Kindesentführung als in unserem Land eher sehr unwahrscheinlich einschätzen. Dies gelingt allerdings nur, indem er sowohl seine Frau als auch seine Kinder als eigenständige Menschen anerkennt und ihnen die Freiheit zur eigenen Lebensgestaltung lässt.
Lösungsvorschlag:
Wenn ein Kind traurig ist, dann sucht es Trost bei den Eltern. Die komplementäre Rolle des Trösters oder der Trösterin wird also von der Mutter oder dem Vater angeboten. Diese Rolle des/der Tröstenden soll gelernt und im inneren Dialog angewendet werden. So sollte jeder nach einer gewissen Zeit in der Lage sein, sich selbst zu trösten, wenn man traurig ist, sich selbst zu beruhigen, wenn man aufgeregt ist, sich selbst Mut zu machen, wenn man Versagensgefühle verspürt. Jeder Mensch hat Teile in sich, die Angst fühlen. Hier ist es notwendig, jene Rollen zu lernen, die Schutz und Geborgenheit vermitteln. Lustigsein ist nur interessant, wenn man auch ernste Rollen kennengelernt hat, und so verhält es sich mit vielen komplementären Rollenpaaren. Derjenige ist also der Gesündeste, der die meisten Rollen erlernt hat.
Suchen Sie selbst in sich Ihren inneren Berater und Heiler, Ihren inneren Beschützer und Versorger, Ihren inneren Liebhaber, Arzt und Psychotherapeuten, aber auch Ihre göttliche Instanz. Versuchen Sie mit diesen Anteilen in ein beruhigendes und aufbauendes Gespräch zu kommen. Denn nur aus Ihrem Inneren kann in Wirklichkeit eine positive Veränderung stattfinden. Von außen können nur die Anregungen dafür kommen. Das Buch soll Sie ermutigen und anleiten, diese innere Instanz zum Schwingen zu bringen, um zu erkennen, wie viel wir selbst für uns und in uns bewirken können.
4. Wer hoch steigt, fällt tief
Der Volksmund kennt Sprüche wie: „Wer hoch steigt, fällt tief“ oder: „Wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis tanzen.“ Denken wir nur an Daedalus und Ikarus, die mithilfe ihrer Flügel aus Federn und Harz fliegen konnten, sich aber zu nah an die Sonne wagten, wobei das Wachs ihrer Flügel schmolz und sie abstürzten. Immer wieder hören wir die Warnung: Sei nicht überheblich, kenne deine Grenzen, sei nicht hoffärtig! Ein Gutteil dieser Warnungen ist gerechtfertigt. Wir sind Menschen und haben unsere Grenzen. Wir sind in einem erheblichen Ausmaß dem Schicksal ausgeliefert. Wir müssen akzeptieren, dass wir sehr vieles nicht selbst in der Hand haben und deswegen nicht verändern können. Dies bedeutet aber nicht, dass wir nichts zu unserem Glück tun können oder tun sollen. Glück ist machbar, und in welcher Weise wir Glück entstehen lassen können (und wo unsere Grenzen gesetzt sind), stelle ich in diesem Buch noch genauer dar.
Beispiel:
Ein Kind spielt glücklich auf den Knien seines Vaters. Diese sind plötzlich ein Kamel, das durch die Wüste schaukelt, anstrengende Dünen sind zu erklimmen und auf der anderen Seite geht es plötzlich rasch bergab. Es wird zum übermütigen Ritt durch die Wüste. Da betritt die Mutter das Zimmer und kommentiert: „Übermut kommt vor dem Fall!“ Die Faszination der Szene ist sofort zerstört, es bleibt ein realistisches Reiten auf den Knien.
Lösungsvorschlag:
Werden Sie sich Ihrer Grenzen bewusst, erkennen Sie jedoch auch die Gestaltungsmöglichkeit, die jeder Augenblick des Lebens Ihnen bietet. Niemand ist seinem Schicksal hilflos ausgeliefert, man muss die Kreativität und Spontaneität, die in jedem von uns steckt, nur zulassen, erleben und umsetzen.
5. Die Angst vor dem Neid anderer
Angst vor dem Glück ist auch eng verknüpft mit der Angst vor dem Neid der anderen. Die innere Botschaft lautet: Es darf dir nicht zu gut gehen, damit die anderen Menschen nicht neidig auf dich werden und nicht beginnen, dir dein Glück zu missgönnen. Hier schwingt nicht die Hoffnung mit, dass es dem anderen auch besser geht, wenn man selbst glücklich ist, sondern die Befürchtung, dass der andere Gegenmaßnahmen ergreifen wird mit dem Ziel, dass es einem wieder weniger gut geht. Die Konsequenz daraus ist, dass man es sich möglichst nicht anmerken lassen soll, wenn es einem gut geht. Das eigene Wohlbefinden ist möglichst zu verstecken. Es gilt Ernsthaftigkeit, eine sorgenvolle Miene und in gewissem Maße einen Lebensfrust zur Schau zu tragen, um den Neid der anderen zu beschwichtigen.
Beispiel:
Herrn Martin F. ist eine große Erbschaft zugefallen. Seine Eltern haben eine große Firma aufgebaut und diese mit Gewinn verkauft, als klar wurde, dass er selbst nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten wollte, sondern eine Buchhandelslehre begann. Als Buchhändler hat er viel Spezialwissen gesammelt und ist mit seinem Beruf zufrieden. Er lebt aber in der ständigen Angst vor dem Neid der anderen. So zieht er immer abgetragene Kleidung an, fährt ein Auto, das eigentlich nur mehr Schrottwert besitzt, und richtet sich seine Mietwohnung spartanisch ein, obwohl er genug Geld hätte, sich eine große Eigentumswohnung in bester Lage zu kaufen. Er scheut sich, gelöst und positiv zu wirken, weil er fürchtet, dass ihm die anderen seine Unbeschwertheit übel nehmen könnten.
Lösungsvorschlag:
Überlegen Sie sich auch die positiven Seiten des Fröhlich- und Glücklichseins. Natürlich weckt es Neid, aber fröhliche, freundliche und glückliche Menschen bewirken im Gegenüber eher positive als negative Gefühle. Seien Sie mutig und lächeln Sie andere an, treten Sie mit ihnen in Kontakt, Sie werden sehen, wie viele Menschen zurücklächeln und Ihre Kontaktaufnahme dankbar beantworten.
6. Die Erbsünde
Angst vor dem Glück hängt auch mit der Erbsünde zusammen. Im Buch Moses steht geschrieben, dass Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Sie haben damit das strikte Verbot Gottes missachtet und sind deshalb aus dem Paradies vertrieben worden. Die Strafe ist die Erbsünde mit der Botschaft: „Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen und (im erweiterten Sinn) verdienen.“ Es stellt sich die Frage, ob diese Strafe überwindbar ist. Der Auftrag würde dann lauten: „Versuche mit Freude zu arbeiten und versuche deine Arbeit positiv zu gestalten, damit du mit Schwung, Kraft und Elan am Werk sein kannst.“
Leider hat man als Analytiker den Eindruck, dass die Menschen die überlieferte Erbsünde wie einen Auftrag befolgen. Sie stöhnen und ächzen unter der Arbeit. Arbeitgeber und Arbeitnehmer versuchen in gleicher Weise, diesen Auftrag umzusetzen. Der Auftraggeber setzt alles daran, sich mit beiden Händen mit Aufgaben zuzuschaufeln, um möglichst wenig Genuss an seiner Arbeit zu finden, und trachtet danach, ein ziemlich hohes Maß an Arbeitsleistung aus dem Arbeitnehmer herauszupressen. Im Vordergrund steht nicht die gemeinsame freudvolle Bewältigung der Arbeit und der Aufträge, sondern ein gemeinsames Quälen: Macht mir die Arbeit Spaß, ist es höchste Zeit, ein schlechtes Gewissen zu entwickeln.
Beispiel:
Frau P. arbeitet als Angestellte in einer Versicherung. Sie hat Großkunden zu betreuen. Sie ist attraktiv, gewandt, überzeugend. Sie ist eine der erfolgreichsten Mitarbeiterinnen des Unternehmens. Obwohl sie regelmäßig belobigt wird und für sie Prämien ausgeschüttet werden, ist sie nicht zufrieden. Sie arbeitet immer intensiver, vergibt immer mehr Termine, die eigentlich in ihre Freizeit fallen, begründet das damit, dass sie sich sagt, dass so ein Einsatz von den Vorgesetzten gewünscht wird, hat immer weniger Freude an ihrem Erfolg und kommt schließlich mit einem schweren Erschöpfungszustand zu mir zur Behandlung.
7. Das Peter-Prinzip
Das Peter-Prinzip beschreibt dieses Phänomen noch von einer anderen Seite. Der Mensch neigt dazu, sich so viel aufzuladen, bis er die erforderliche Bewältigung nicht mehr leisten kann. In Bezug auf die Karriere bedeutet das, dass der Mensch so weit die Karriereleiter hinaufsteigt, bis er nicht mehr suffizient seine Aufgaben erfüllen kann. Diesem Phänomen, gepaart mit der traurigen Erkenntnis, dass man als hochtalentierter und befähigter Mensch seine positive gestalterische Wirkkraft verliert, muss man entgegensteuern. Die verschiedenen Aufgabenfelder sind zu analysieren und die Überlegung ist anzuschließen, welche davon abgegeben oder delegiert werden können, um sich zu entlasten und wieder effizient die Kernaufgaben zu bewältigen.
Beispiel:
Markus L. hat sich als erfolgreicher Anwalt etabliert. Er ist beliebt, umsichtig, ausgleichend, zielorientiert und effizient in seiner Arbeit. Als Familienvater kümmert er sich liebevoll um seine Kinder und erweist sich seiner Frau gegenüber als aufmerksamer Ehemann. Aufgrund seiner Beliebtheit und Tüchtigkeit wird er gebeten, in der Anwaltskammer mitzuarbeiten, was er gerne annimmt. Aber auch die Flüchtlingshilfe hat große Wünsche an ihn, da bekannt ist, dass er sich selbstlos für die Schwachen der Gesellschaft einsetzt. In dieser Überlastung findet er zunehmend weniger Zeit für seine Familie. Häusliche Konflikte sind unvermeidlich. Er entzieht sich damit selbst seine emotionale Basis, wird ungeduldig und gereizt. Er erkennt, dass ihm laufend mehr Fehler unterlaufen. Schließlich entschließt er sich zu einer Therapie, um wieder Ordnung in sein Leben zu bringen.
Lösungsvorschlag:
Nehmen Sie die Erbsünde als Herausforderung. Die Erbsünde ist kein Fluch, sondern eine Bürde, die es zu überwinden gilt.
Versuchen Sie das Schöne an der Arbeit zu sehen und wenn Sie sofort mit der Antwort reagieren: „Da gibt es nichts Schönes“, halten Sie inne und überlegen, was für Sie daran am ehesten angenehm ist. Vergessen Sie nie, dass Sie auch Gestaltungsmöglichkeiten haben. Es ist Ihre Aufgabe, sich das Leben und die Arbeit schön zu machen. Normalerweise kümmert sich niemand anderer darum. Spätestens im Inneren Ihres Kopfes können Sie die Dinge so gestalten, wie Sie es wollen. „Gedanken sind frei“ oder wie André Heller singt: „Die wahren Abenteuer sind im Kopf und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo.“ Sie können bei der Arbeit (innerlich) Musik hören, tanzen oder auf dem Sandstrand laufen.
Suchen Sie sich selbst Ihre Gestaltungsmöglichkeiten, wenn Ihnen die vorgeschlagenen zu „verrückt“ und unrealistisch vorkommen. Natürlich müssen Sie parallel immer mit der Umwelt am Arbeitsplatz kommunizieren, aber das innere Programm kann wie auf einer zweiten Spur ablaufen und Ihnen Leichtigkeit vermitteln.