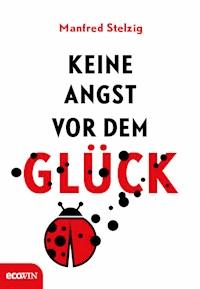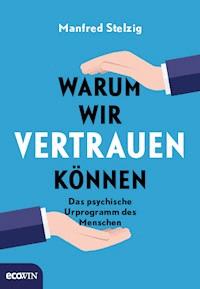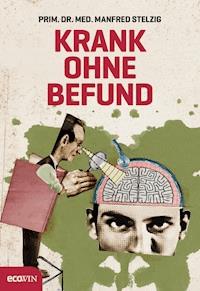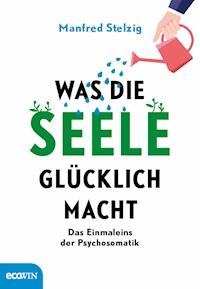
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ecowin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Körper und Seele in Einklang bringen Dieses Buch beschreibt die verblüffenden Zusammenhänge zwischen Körper und Seele. Der Autor gibt zahlreiche anschauliche wie überraschende Beispiele aus seiner jahrelangen Praxis zu den wichtigsten Krankheiten mit oft seelischen Ursachen, wie zum Beispiel Depression, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen oder Ess- und Schlafstörungen. Es wird gezeigt, wie mit speziellen Übungen die Seele wieder ins Gleichgewicht gebracht und der Heilungsprozess des Körpers ermöglicht werden kann. Der Bestseller des Erfolgsautors in einer einmaligen Sonderausgabe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Stelzig
WAS DIE SEELEGLÜCKLICHMACHT
Das Einmaleins der Psychosomatik
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältigerBearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw.Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
8. Auflage 2017
© 2009 Ecowin Verlag bei Benevento Publishing,
eine Marke der Red Bull Media House GmbH,
Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Gesetzt aus der Sabon
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Lektorat: Arnold Klaffenböck
Satz: Druckerei Theiss GmbH, Austria
Umschlaggestaltung: b3K design, Andrea Schneider, diceindustries
Printed in Slovakia
ISBN 978-3-7110-0144-3
eISBN 978-3-7110-5211-7
Für Renate, Nikolaus, Isabella,Dominik und Oliver
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Erwärmung für das Thema
Die Psychosomatik im medizinischen System
Psychosomatik für den Arzt
Die Abwehr der Betroffenen
Erster Teil
Wie entstehen psychosomatische Erkrankungen?
Die Konversionstheorie
Die vegetative Neurose
Die De- und Resomatisierungstheorie
Stresstheorie
Armut macht krank
Die Opferrolle
Der Mangel an Problemlösungsbereitschaft
Selbstliebe und Narzissmustheorie
Ungleichgewicht zwischen leistungsunabhängiger und leistungsabhängiger Liebe
Der falsche Dialog mit den Organen
Mangelnde Abgrenzung
Der Mangel an Aggressivität
Der Mangel an der transzendentalen Dimension
Zweiter Teil
Spezielle psychosomatische Krankheitsbilder
Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates
Das Fibromyalgie-Syndrom
Kreuzschmerzen, das Lumboischialgie-Syndrom
Das Cervical-Syndrom
Die chronische Polyarthritis oder das echte Rheuma
Blasenstörungen
Die Depression
Essstörungen
Adipositas
Die Anorexie
Die Bulimie
Erkrankungen der Haut
Neurodermitis oder atopische Dermatitis
Die Psoriasis
Akne vulgaris
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Somatoforme Störungen des Herzens
Der Bluthochdruck
Koronare Herzkrankheiten
Der Herzinfarkt
Kopfschmerzen
Erkrankungen der Lunge
Asthma bronchiale
Chronisch obstruktive Lungenerkrankungen
Magen-Darm-Erkrankungen
Die Gastritis
Das Magen- und Zwölffingerdarm-Geschwür
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen
Colitis ulcerosa
Morbus Crohn
Onkologie
Somatoforme Störungen
Schlafstörungen
Die Sexualstörungen des Mannes
Erektile Dysfunktion
Die Sexualstörungen der Frau
Schmerzsyndrome
Tinnitus
Unterbauchschmerzen
Die Zähne
Dritter Teil
Bilder zur Struktur der Seele
Der Seelengarten
Das Seelenhaus
Übungen zum Aufbau des Seelenhauses
Das Fundament, der Keller, die Basis
Die Kuschelübung
Die Begegnung mit sich selbst
Die Übung mit dem Spiegel
Die Schoßplatzübung
Aktives Verwöhnen
Die Ureltern-Übung
Die Bewegung
Der innere Liebhaber
Die Übung mit den Urbildern aus Zeitschriften
Die Übung mit der göttlichen Instanz
Literatur, Quellen und Links
Der Autor
Einleitung
Ein Ziel dieses Buches ist, zu vermitteln, dass „Glücklichsein“ möglich, ja sogar erlernbar ist. Das zweite Ziel wird durch den Untertitel „Das Einmaleins der Psychosomatik“ benannt. Diese Publikation schließt die Lücke zwischen der wissenschaftlichen Literatur und den zahlreichen Artikeln, die in Zeitungen und Zeitschriften über „Psychosomatik“ – den Zusammenhang zwischen Körper und Seele – erscheinen. Sollten Sie an einer psychosomatischen Erkrankung leiden, werden Sie Anregungen bekommen, wie Sie Ihre Lebensqualität trotz der Erkrankung verbessern können und erkennen, dass Glücklichsein in Teilaspekten auch hier möglich ist oder sogar die Erkrankung überwunden werden kann.
Der erste Teil des Buches liefert sowohl für Interessierte als auch für Betroffene eine Zusammenfassung der Grundlagen der Psychosomatik mit ihren Entstehungstheorien sowie Vorbeugungs- und Behandlungsansätzen.
Der zweite Teil beschäftigt sich mit den wichtigsten psychosomatischen Krankheitsbildern. Es können natürlich nicht alle möglichen Störungen behandelt werden, das würde den Rahmen dieses Buches sprengen. Wichtig ist mir allerdings, dass Sie ein gutes Verständnis für die Hintergründe psychosomatischer Erkrankungen entwickeln und daraus eine positive Handlungskonsequenz ableiten können. Schreiben Sie mir bitte, wenn Sie ein Thema oder ein Krankheitsbild besonders bewegt oder interessiert.
Im dritten Teil versuche ich Einblick in die Struktur der Seele zu geben und stelle den „Seelengarten“ und das „Seelenhaus“ vor, um zu zeigen, wie jeder von uns in seiner psychischen Struktur aufgebaut ist.
Durch spezielle Übungen soll es Ihnen möglich werden, Strukturdefizite auszugleichen, Anregungen zu erhalten, sich zunehmend in Ihrer Haut wohl zu fühlen, Ihr Selbst zu stärken und einen Schritt in Richtung Glücklichsein zu machen.
Dieses Buch erhebt in keiner Weise den Anspruch auf Vollständigkeit – im Gegenteil, durch die Unvollständigkeit sollen Sie als Leser angeregt werden, eigene Gedanken weiterzuentwickeln und sich in Ihren eigenen Behandlungsansätzen bestärkt fühlen. Ich habe viele Betroffene gesehen, denen der psychodynamische und psychosomatische Ansatz wesentlich vertrauter war, als er in der herkömmlichen medizinischen Literatur vertreten ist.
Was ich unbedingt vermitteln möchte, ist der Anspruch eines jeden Menschen auf die eigene Seele. Es wird Ihnen vielleicht eigenartig vorkommen, wenn ich diesen Anspruch äußere, aber ich mache in meiner täglichen Arbeit die Erfahrung, dass viele Menschen in großen Bereichen ihrer Seele so stark von anderen Menschen bestimmt sind, dass sie nicht Herrscher im eigenen „Seelenhaus“ sind. In der Politik ist das Recht auf Eigentum, Arbeit, Bildung und soziale Absicherung festgelegt, den Anspruch auf eine ungestörte Seele aber müssen wir erst formulieren.
Die Medizin beschäftigt sich vorrangig mit den Entstehungsbedingungen, der Diagnose und der Behandlung von Krankheiten, zunehmend wird auch die Bedeutung der Prophylaxe erkannt. Der psychosomatische Ansatz legt großen Wert darauf, zu erkennen, wie Gesundheit entsteht und erhalten werden kann. Der bedeutende Medizinsoziologe Aaron Antonovsky hat diesen Blickwinkel besonders hervorgehoben. Er beschreibt das Wechselspiel zwischen Gesundheit und Krankheit, betont die ungewohnte Sichtweise: „Was erhält mich gesund?“ anstelle der Frage „Was macht mich krank?“.
Ich möchte Ihnen als Leser den Glauben, wenn nicht gar die Gewissheit vermitteln, dass wir selbst sehr viel für unser körperliches, aber auch seelisches Wohl tun können. Ein Großteil des Buches hat diesen Ansatz im Hintergrund, auch wenn er nicht ständig betont wird. Gesundheit zu erhalten und Gesundheit wiederherzustellen sollte zu einem guten Teil im Bereich der Möglichkeit jedes einzelnen Menschen liegen, einige Zusammenhänge und Anleitungen dazu finden Sie in diesem Buch.
Es wendet sich auch an ärztliche Kollegen und Psychotherapeuten, die Interesse daran haben, psychosomatische Krankheitsbilder hautnah, ganzheitlich erleben zu können. Mein Anspruch an dieses Buch ist, dass nicht nur dem Gehirn eine Botschaft übermittelt wird, sondern beim Lesen auch ein ganzheitlicher Ansatz gefunden werden kann, im Sinne eines Berührtseins, Miterlebens und Verstehens, sodass, wie ich hoffe, die Organe mitschwingen können und sich verstanden fühlen. Dieses Buch soll helfen, psychische und seelische Vorgänge und ihre Verknüpfung mit dem Körperlichen aus dem Bauch heraus zu verstehen. Damit wird nicht nur der Psychotherapie, sondern auch den neuen Erkenntnissen aus der Hirnforschung Rechnung getragen. Denn die meisten Prozesse laufen unbewusst ab, beeinflussen so das Verhalten, das vegetative Nervensystem und über diesen Weg die Organfunktionen. Und genau diese unbewussten Prozesse gilt es zu gestalten und positiv durch Botschaften, die zum Teil direkt an das Organ gerichtet sind, zu verändern.
So wie es ein Juristendeutsch gibt, gibt es natürlich auch ein Mediziner-, Psychologen- und Psychotherapeutendeutsch, und je nach psychotherapeutischer Schule werden andere Fachausdrücke verwendet. Der allgemeinen Verständlichkeit halber habe ich versucht, möglichst ohne diese Formulierungen auszukommen, wenn ich auch durch meine beiden Psychotherapieausbildungen, nämlich die der Psychoanalyse und die der Psychodramatherapie, geprägt bin.
Neben dem Aufzeigen der seelischen Strukturen sollen auch viele Möglichkeiten zur Selbsthilfe bewusst gemacht werden. Oft wird ärztliche und psychotherapeutische Hilfe nötig sein, aber für die grundlegenden Erkenntnisse müssen Sie sich selbst auf die Suche machen und zum eigenen inneren Berater, Heiler, Beschützer, Versorger, Liebhaber, Arzt und Psychotherapeuten werden, und Sie müssen auch Ihre göttliche Instanz finden und stärken. Denn nur aus Ihrem Inneren heraus kann auch in Wirklichkeit eine positive Veränderung stattfinden. Von außen können nur die Anregungen dazu kommen. Das Buch dient zur Ermutigung und Anleitung, diese innere Instanz zum Schwingen zu bringen und zu erkennen, wie viel wir selbst für uns und in uns bewirken können.
Die vielen Beispiele, die ich in diesem Buch schildere, sind anonym. Sollte sich aber jemand wiedererkennen, so möchte ich betonen, dass es auch auf jemand anderen zutreffen könnte, da ich nur allgemeingültige Beispiele ausgewählt habe.
Das Buch soll in keiner Weise eine Ausgrenzung oder Abwertung der Schulmedizin beinhalten, die für die Betroffenen unschätzbare Dienste geleistet hat, sondern es ist der Versuch eines Brückenbauens.
Das „Psychische“ wie Mögen, Sympathie, Zuneigung, Ablehnung, Wut, Ärger oder Verzweiflung wird erweitert um das Seelische, den transzendentalen Anteil, das Kosmische – „Woher kommen wir und wohin gehen wir?“ –, das Ethische und Religiöse. All diese Bereiche spielen in der Entstehung und im Verlauf von psychosomatischen Erkrankungen eine wichtige Rolle, und ich hoffe, dass Sie als Leser am Ende des Buches diese Meinung teilen können.
Der Einfachheit halber verwende ich in diesem Buch die männliche Form, meine Leserinnen mögen mir bitte verzeihen.
Ich habe dieses Buch meiner Frau und meinen Kindern gewidmet, weil mir warm ums Herz wird, wenn ich an sie denke und weil vieles von dem, was ich geschrieben habe, auch aus der Beziehung zu ihnen stammt und zu verstehen ist.
Bedanken möchte ich mich bei den Betroffenen, mit denen ich im Sinne der Psychosomatik und Psychotherapie arbeiten durfte, für ihre Offenheit und Ehrlichkeit, für das Vertrauen, das sie mir entgegengebracht haben, und für die gemeinsame Arbeit, die auch für mich eine große Bereicherung war und wahrhaft Leben bedeutet. Besonders stolz bin ich auch auf mein Team der Psychosomatik in Salzburg, das mich immer auf Trab hält, und schließlich möchte ich mich noch bei meinen Eltern bedanken, die mir den Grundstock zu meinem Seelenhaus mitgegeben und mir durch ihre Fürsorglichkeit und Liebe zu jener Einsicht, aus der ich meine psychosomatischen Übungen entwickeln konnte, verholfen haben.
Erwärmung für das Thema
Es ist zum Wahnsinnigwerden mit der Psychosomatik, die Haare könnten einem zu Berge stehen, man könnte rot anlaufen vor Wut! Wenn man sich die Dinge zu Herzen nehmen würde, könnten sie einem unter die Haut gehen! Sie werden sich vielleicht fragen: „Warum diese psychosomatische Emotionalität gleich zu Beginn?“
Obwohl die Psychosomatik ein Phänomen ist, über das sehr viel bekannt ist und das uns tagtäglich begleitet, hat es sich bedauerlicherweise noch immer nicht im notwendigen Maß in unserem Selbstverständnis und Gesundheitssystem etabliert. Dabei ist dieses Phänomen etwas Wunderbares – Körper und Seele sind untrennbar miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Dass das körperliche Befinden auch die seelische Befindlichkeit beeinflusst, ist allgemein verständlich und akzeptiert. Fühlt man sich körperlich unwohl, besteht auch eine seelische Belastung. Selbst bei einer banalen Erkältung, geschweige denn bei einer akuten oder chronischen Erkrankung, die eine Spitalsbehandlung notwendig macht, wird eine psychische Reaktion wie Ungeduld, Ärger oder Niedergeschlagenheit verständlich sein. Dass eine schwere Erkrankung wie ein Herzinfarkt oder ein Karzinom Depressionen auslösen kann, ist durchweg bekannt. Dass man aber bei solchen Erkrankungen auch das Recht auf eine psychiatrisch-psychotherapeutische Hilfe und Behandlung hat, ist schon wieder weniger klar. Und die andere Variante – nämlich dass seelische Vorgänge die körperliche Funktionstüchtigkeit und Gesundheit beeinflussen – ist noch wesentlich umstrittener, bekommt aber zunehmend mehr Stellenwert.
Im Spitzensport wird allgemein akzeptiert, dass einem Schispringer „die Nerven flattern“ oder ein Fußballer einen Elfmeter verschießt, weil er den psychischen Druck nicht aushält. Nerven und Psyche werden synonym verwendet. Mit Konzentrationsübungen und Visualisierungen werden Spitzensportler psychisch für körperliche Höchstleistungen fit gemacht, das heißt, dass mentales Training sowohl die körperliche als auch die psychische Leistungsfähigkeit verbessert – Körper, Seele und Geist beeinflussen einander in positiver Weise!
Meist stellen wir diese positive Verbindung unbewusst her: Wir legen uns zum Beispiel in die Sonne. Wer kennt das Bild im Frühling nicht, wenn nach einem langen Winter die Menschen ins Freie strömen, um Sonne und damit Energie zu tanken, oder dafür auf Urlaub fahren. Wir machen einen Spaziergang, „saugen“ die frische Luft und die Natur ein oder gehen unseren Hobbys wie Schilaufen, Tennis und Fußball nach – „mens sana in corpore sano“, „ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“, so das uralte lateinische Sprichwort dazu.
Der Volksmund anerkennt seit jeher die Wirkung der Seele auf den Körper: Etwas schlägt sich auf den Magen, nimmt einem die Luft oder geht unter die Haut, lässt einem den Atem stocken, man ist blind vor Liebe oder Wut, nimmt sich etwas zu Herzen – das sind nur einige wenige Beispiele für die Bedeutung dieser Verbindung (mehr dazu im zweiten Teil dieses Buches). Und damit wird auch ein wesentlicher Faktor angesprochen: Seelische Überbelastungen, die nicht kompensiert werden, können als Funktionsstörungen oder Organerkrankungen ihren Niederschlag finden. Bei Schreckreaktionen ist uns die körperliche Beteiligung sehr vertraut. Bei oft relativ harmlosen Ereignissen, die noch einmal gut gegangen sind, bis hin zu schweren Belastungen, wie zum Beispiel nach einem Autounfall oder nach einer schweren körperlichen Bedrohung, reagieren wir mit körperlichen Symptomen wie Händezittern, Schweißausbruch, „weichen Knien“, Mundtrockenheit, Blutdruckschwankungen und Schwindelzuständen. Hier ist der Zusammenhang zwischen Seele und Körper evident und akzeptiert, bei schwereren seelischen Belastungen aber, die eine Erkrankung auslösen oder mit verursachen können, wird der seelische Anteil plötzlich vernachlässigt. Dabei kennen wir ein „Stressulcus“, ein Magengeschwür, das plötzlich aufgrund einer besonderen Belastung auftritt, oder den Herzinfarkt, der ausgelöst wird durch einen extremen psychischen Schock.
Im alltäglichen Gebrauch gibt es eine Methode, bei der bewusst und nachkontrollierbar die Zusammenhänge zwischen Körper, Geist und Seele sichtbar werden: das Bio-Feedback. Dabei werden die Atmungsfrequenz, der Herzschlag, Blutdruck, Hautwiderstand, die Hauttemperatur sowie die Muskel(ver)spannung gemessen. Und fantastischerweise sieht man selbst auf dem Bildschirm, wie sich die Messgrößen abhängig von dem, was man sich gerade vorstellt, verändern, welche Vorstellungsbilder beruhigend und entspannend wirken, den Blutdruck und die Herzfrequenz senken und sich insgesamt positiv auf das Vegetativum auswirken. Denken Sie zum Beispiel an den letzten Urlaub, an den Strand, an das Meer, an die Entspannung und die Muße, dann werden sich alle Werte beruhigen und normalisieren. Denken Sie jedoch an den letzten Konflikt, an die Auseinandersetzung am Arbeitsplatz, mit Behörden oder Familienangehörigen, so werden Sie unmittelbar sehen können, wie Herzfrequenz und Blutdruck steigen und die Erregung am Bildschirm sichtbar wird.
Das zeigt deutlich, wie wichtig es ist, Herrscher über die eigenen Gedanken zu sein oder zumindest zu werden, da man in der Lage sein muss, auch in Zeiten von Belastungen an schöne und entspannende Dinge zu denken, um sich wieder erholen zu können und seine vegetativen Werte in einen Normalzustand zu bringen. Dadurch können Verspannungen der Muskulatur, Durchblutungsstörungen, Bluthochdruck und Spannungskopfschmerzen positiv verändert werden, die Wechselwirkungen sind im BioFeedback direkt ablesbar. Natürlich sollen Sie auch dann weiterüben, wenn Sie nicht am Gerät angeschlossen sind. Mit dieser Trainingsmethode lernen Sie, auf einer zweiten Schiene des Bewusstseins an etwas Schönes zu denken, das jederzeit abrufbar ist und gegen übermäßigen Stress schützt. Die Kunst dabei besteht darin, zu lernen, diese zweite Schiene aufzubauen und rasch zwischen den einzelnen Schienen wechseln zu können. Eine zweite Möglichkeit, mit der die Verbindung zwischen Gedanken, Gefühlen und dem Körper nachgewiesen und genützt wird, ist der Lügendetektor. Durch die Veränderung des Hautwiderstandes kann herausgefunden werden, ob ein Mensch die Wahrheit spricht oder nicht. Hier sehen wir, wie eng vernetzt Körper und Seele sind.
Die schönste Verbindung in dem komplizierten Geflecht aus Gefühl und körperlicher Reaktion ist aber die Verliebtheit. Herzklopfen, „Schmetterlinge im Bauch“, Hitzeempfindungen, sexuelle Erregtheit über „weiche Knie“ oder Schwindelzustände bis hin zu besonderer körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit sind vertraute Erscheinungen.
Die Auswirkungen von Gefühlen auf körperliche Reaktionen lassen sich nicht nur mit Bio-Feedback nachweisen, auch neue bildgebende Verfahren in der Medizin liefern Bilder vom Gehirnstoffwechsel und zeigen so Mängel und krankhafte Veränderungen, die der Mediziner dann in Beziehung zu Hormonen und Botenstoffen aus dem Blut setzt und so beweisen kann, dass das, was wir fühlen, auch sichtbar gemacht werden kann.
Die Psychosomatik im medizinischen System
Obwohl die wechselseitige Beziehung zwischen Körper und Seele an sich unbestritten ist, finden diese Auswirkungen in der medizinischen Krankheitslehre und im therapeutischen Vorgehen nur mühsam entsprechende Beachtung. Auch wenn die psychosomatische Literatur, wissenschaftliche Untersuchungen und therapeutische Maßnahmen große Erfolge erzielen – wirkliche Auswirkungen auf die breite Basis haben sie nicht.
Die Medizin ist im Laufe der Entwicklung zu einer Naturwissenschaft geworden. Evidence-based medicine ist das Credo, nur das Wiederholbare und das Beweisbare finden Eingang in die medizinische Wissenschaft. Und das ist zum größten Teil auch gut. Die medizinische Forschung hat sich damit einen eigenständigen Platz errungen und sich von philosophischen und religiösen Überlegungen und Einflussnahmen relativ unabhängig gemacht.
Ohne diese Bereiche kommt die Medizin jedoch nicht aus, sonst wird sie kalt und unmenschlich. Nicht nur im Bereich der Medizinethik, der Stammzellenforschung, der In-vitro-Fertilisation (der künstlichen Befruchtung), der Schwangerschaftsunterbrechung etc. ist ein großer Teil der Medizin mit ethischen, religiösen und philosophischen Überlegungen verknüpft. Auch die tägliche Begegnung, die Kommunikation, die Fürsorge, die Verantwortung, das Arbeitsklima und leider auch große Bereiche der Psychosomatik sind der naturwissenschaftlichen Beweisführung nicht leicht zugänglich.
Wir müssen uns also die grundsätzliche Frage stellen, wie weit die Medizin auch eine Geisteswissenschaft sein muss. Widerstrebt es nicht dem Menschsein, den Menschen auf die physikalischen und biochemischen Parameter zu reduzieren? Einer der großen Vorreiter der Psychosomatik, Thure von Uexküll, hat das Maschinenmodell in der Medizin beklagt. Er fordert eine grundsätzlich andere Sichtweise, einen Paradigmenwechsel und führt den etwas sperrigen Namen „bio-psycho-soziales System“ ein. Er betont, dass alle Erkrankungen im Zusammenspiel von biologischen, also körperlichen und organischen Funktionen, psychischen und seelischen, aber auch sozialen Funktionen, wie Beruf, Einkommen, Wohnverhältnisse etc., zu sehen sind. Wir wissen heute aus vielen Studien: Armut macht krank.
Der berühmte Chirurg Rudolf Virchow hat überheblich gemeint, dass er schon viele Leichen seziert, aber noch nie eine Seele gefunden habe. Zugegeben, wir sind heute deutlich weiter und niemand wird die Existenz der Psyche, der Seele bestreiten, trotzdem ist ein Rest dieser Grundhaltung zu spüren. Wo ist also ihr Platz in der Medizin?
Eine wesentliche Arbeit, die belegt, wie wichtig die Beachtung des psychischen Geschehens im Alltag ist, ist die Analyse von Stuhr und Haag, in der insgesamt 30 wissenschaftliche Arbeiten verglichen werden. Dabei wurde untersucht, wie viele Patienten in einem Allgemeinkrankenhaus und in Allgemeinpraxen unter behandlungsrelevanten psychischen Störungen leiden, die die körperliche Befindlichkeit mit beeinflussen – mit dem Ergebnis, dass im stationären Bereich 41,8 Prozent an behandlungsbedürftigen psychischen Störungen litten, in der Allgemeinpraxis sogar 49 Prozent. Da die meisten Menschen im Spital aber nur körperlich abgeklärt werden, bleibt der psychische Hintergrund der Erkrankung im Dunkeln und unbehandelt, der volkswirtschaftliche Schaden ist enorm. Ein chirurgischer oder internistischer Patient etwa wird bei der Aufnahme gründlich organisch durchuntersucht, um eine optimale Behandlung zu gewährleisten. Wird etwas übersehen, drohen rechtliche Konsequenzen. Anders aber ist das für die Psychosomatik: Hier dürfen die meisten Erkrankungen unerkannt und unbehandelt bleiben. Arolt hat 200 Patienten auf internen und 200 auf chirurgischen Stationen untersucht und festgestellt, dass 46,5 Prozent unter einer psychischen Störung litten. Dazu muss man wissen, dass nach einer europaweiten Studie (Herzog und Mitarbeiter) nur ungefähr zwei Prozent der Patienten im Allgemeinspital eine psychiatrische, psychologische oder psychotherapeutische Mitbehandlung erfahren, Tendenz steigend.
Jetzt werden Sie sich als Leser dieses Buches vielleicht denken, dass Ihnen das gerade noch fehlt, wenn Sie in einem Spital auch noch einem Psychotherapeuten, einem Psychologen oder gar einem Psychiater vorgestellt würden. Mit dieser Ablehnung befinden Sie sich in bester Gesellschaft, nur wird damit trotzdem eine große Chance vergeben. Denn die meisten psychischen Miterkrankungen im Spital wären gut behandelbar: Erschöpfungszustände, Stresssymptome, Depressionen, die sich in Form körperlicher Beschwerden ausdrücken, Schmerzen, die eine Unzahl von Belastungsfaktoren im Hintergrund haben können, Alkoholprobleme, die ein klares therapeutisches Konzept benötigen und in den Griff zu bekommen sind.
Beispiel
Ein junger Mann wird mit unklaren Bauchschmerzen auf der Chirurgie aufgenommen und genau medizinisch untersucht. Blutbefunde, Ultraschall, endoskopische Abklärung usw. werden erhoben. Es wird nichts Organisches entdeckt, das die Schmerzen erklären könnte. Normalerweise wird der Chirurg dem Patienten dann eben mitteilen, dass erfreulicherweise nichts Organisches gefunden worden, dass der Patient also gesund ist. Der Patient freut sich natürlich über diese Mitteilung und geht nach Hause. Eine große Chance ist damit vertan. Seine Probleme am Arbeitsplatz, seine Konflikte mit den Eltern und seine Sorgen mit der Freundin sind nicht zur Sprache gekommen. Er hat keinen Verbündeten gefunden, keine Ansprechperson, bei der er sich entlasten konnte, keinen Fachmann, mit dem er besprechen konnte, wie er besser mit seiner Notsituation umgehen könnte. Mit Glück wird er seine Belastungssituation selbst überwinden und seine Probleme in den Griff bekommen können. Oft ist das jedoch anders, und genau daraus ergibt sich das Problem der medizinisch bedingten Chronifizierung.
Dass das kein Einzelfall ist, belegt auch die folgende Studie: Nach einer Untersuchung im St.-Johanns-Spital von Maier und Wenger im Universitätsklinikum Salzburg wurden in den Jahren 1995 bis 1998 220 Patientinnen aufgrund von chronischen Unterbauchschmerzen mithilfe einer Beckenspiegelung – einem zwar kleinen endoskopischen Eingriff, aber immerhin ein chirurgischer Eingriff mit Eröffnung der Bauchwand – untersucht. Von den 220 Patientinnen hatten 122 einen unauffälligen Organbefund, nur 60 von diesen 220 Patientinnen wurde angeboten, mit einer Psychologin oder Psychotherapeutin zu sprechen. 13 davon lehnten dieses Angebot ab, die anderen waren zu einem Gespräch bereit und konnten so die Zusammenhänge zwischen den Schmerzen und einer psychischen Belastung oder Erkrankung abklären.
Aus psychosomatischer Sicht wäre eine andere Vorgehensweise sinnvoll. Da klar ist, dass bei mindestens der Hälfte der Untersuchten keine organische Ursache zu finden sein wird, sollte bei allen Betroffenen ein Gespräch erfolgen, um herauszufinden, welche psychodynamischen Gründe die Unterbauchschmerzen bewirken könnten. Oft sind es Beziehungsprobleme, erlittene sexuelle Grenzüberschreitungen, ein Kinderwunsch oder ein Energiedefizit im Sinne der allgemeinen Überforderung, die sich im Unterbauch äußert. Die Sicherung dieses Gespräches, das die Hintergrundverbindungen verständlich macht, sollte im Routineprogramm jeder Abklärung enthalten sein. Wir sprechen von der „psychosomatischen Basisversorgung“.
Und so möchte ich eine große Lanze dafür brechen, dass von beiden beteiligten Parteien, also sowohl von der Patientenseite als auch von der Medizinerseite, das Psychische und Seelische mehr Beachtung und Akzeptanz finden. Die Patienten scheuen die Diagnose der Depression genauso wie die Mediziner und sind sich dabei nicht bewusst, dass dadurch auch die Heilungschance missachtet wird.
Aus meiner Sicht hat das jedoch durchaus auch eine rechtliche Konsequenz. Eine Depression beispielsweise kann sich auch in starken Schmerzzuständen ausdrücken und einen langen Krankenstand verursachen. Diagnostiziert der Arzt die Depression nicht, wird sie nicht behandelt und die Schmerzen können nicht gebessert werden. Der dadurch ausgelöste längere Krankenstand, das unnötige Leiden, der eventuell eingetretene Verdienstentgang etc. könnten Thema einer Klage werden. Und das Bild verändert sich nur langsam.
Weltweit werden sogenannte Konsiliardienste in Allgemeinkrankenhäusern installiert, eigene psychosomatische Dienste also, in denen Psychotherapeuten, Psychologen und Psychiater zusammenarbeiten, die die psychische Behandlung der Patienten auf den einzelnen Stationen übernehmen. Im österreichischen Krankenanstaltengesetz von 1991 wird eine ausreichende psychologische und psychotherapeutische Versorgung im Allgemeinkrankenhaus gefordert und festgehalten. Die durchschnittliche Versorgungskapazität dieser psychotherapeutischen und psychiatrischen Einrichtungen beträgt nach der bereits erwähnten Studie Herzogs durchschnittlich jedoch nur zwei Prozent, und diese zwei Prozent sind wiederum den 41,8 Prozent gegenüberzustellen, die tatsächlich unter einer psychischen Störung leiden. Die Frage lautet daher, auch wenn die Tendenz steigend ist: Was passiert mit dem restlichen Prozentsatz?
In der Psychosomatik sprechen wir in diesem Fall von iatrogener Chronifizierung, von einer Verlängerung der Beschwerden, die durch das medizinische System herbeigeführt wird. Dadurch, dass bei entsprechenden körperlichen Beschwerden die Patienten keinen Zugang zu dem psychischen Faktor finden und damit die psychische Erkrankung, die die Beschwerden eigentlich bewirkt, nicht diagnostiziert wird, bleibt sie bestehen. Die Patienten lassen sich aufgrund der tatsächlich verspürten Beschwerden immer wieder durchuntersuchen, da der Zusammenhang mit der psychischen Überlastung für sie nicht nachvollziehbar ist. Nach Untersuchungen von Reimer sowie in anderen Studien beträgt die durchschnittliche Chronifizierung fünf Jahre. Der volkswirtschaftliche Schaden aus wiederholten körperlichen Durchuntersuchungen, stationären Wiederaufnahmen, verlängerten Krankenständen und dem hohen Medikamentenverbrauch sowie Berufsunfähigkeitspensionen ist dabei enorm.
Daher ist es wichtig, mit den Betroffenen gemeinsam den psychischen Hintergrund zu erarbeiten und damit das Verstehen des psychischen Geschehens und das Akzeptieren der psychischen Problematik zu ermöglichen. Erst daraus folgt die Diagnose und ein Behandlungskonzept, das sowohl medikamentöse Hilfe im Sinne von Unterstützung der körpereigenen Neurotransmitter, der „Glückshormone“, als auch eine Psychotherapie einschließt und eventuell die Zuweisung an einen Psychotherapeuten oder Psychologen notwendig macht.
Und damit sind wir schon beim nächsten Problem: bei den Psychopharmaka. Medikamente, die das Nervensystem beeinflussen, das psychische und seelische Befinden, werden mit großem Argwohn betrachtet. Die Betroffenen leisten starken Widerstand, diese Medikamente einzunehmen. Sie meinen, dass es doch lächerlich sei, gegen psychische Überforderung Psychopharmaka zu verwenden. Sind sie einmal so weit gekommen, das Psychische an ihrer Erkrankung, an ihrem Zustand zu akzeptieren, meinen sie: „Das muss man doch selbst schaffen können.“
Ein wesentlicher Teil dieses Buches zielt auf dieses „Selbstschaffen-Können“ auch ab. Nur ist zu bedenken, dass wir sowohl durch alle angeführten Übungen als auch durch andere Entspannungsverfahren, aber auch durch Psychotherapie das Nervenhormonsystem beeinflussen, wie wir in den neuen bildgebenden Verfahren der Medizin beweisen können. Wir werden dem psychischen und seelischen Geschehen auch sicherlich mit Psychopharmaka nicht gerecht, wir sollten uns nur vor Augen halten, dass bei einem Gefühl der Erschöpfung, des „Ausgebranntseins“, der Depression ein Mangel an Neurotransmittern, an Botenstoffen des Gehirns besteht und dass wir diesen Mangel mit Medikamenten ganz gut ausgleichen können.
Auf dieser medikamentösen Schiene werden Sie Ihren tatsächlichen Sorgen als Betroffener natürlich nicht gerecht. Aber vergleichen Sie den Menschen einmal mit einer Firma. Es kann möglich sein, dass ein Betrieb in die „roten Zahlen“ rutscht. Er wirtschaftet defizitär. Selbstverständlich ist es notwendig, diesen Betrieb zu sanieren. Man muss unter anderem auf die Produktionsabläufe achten, berücksichtigen, wo wirtschaftlicher produziert und wie die innere Harmonie zwischen Einkauf und Verkauf verbessert werden kann. Manchmal wird dieser Umstrukturierungsprozess jedoch zu wenig sein. Eine Finanzspritze von außen, ein finanzkräftiger Partner muss aus dem Tief heraushelfen, damit alles wieder in Fluss kommen kann. Und so können Sie die Psychopharmaka auch wie die Finanzspritze, wie den finanzkräftigen Partner sehen.
Durch die Erkenntnisse der Hirnforschung ist relativ klar, um welche Stoffe es sich handelt. Das System der Botenstoffe ist zwar kompliziert und bei Weitem noch nicht ganz erforscht, aber man weiß, dass Serotonin und Noradrenalin einen entscheidenden Einfluss haben. Ein Serotoninmangel drückt sich in Antriebsarmut, Abgeschlagenheit, Gereiztheit, körperlichem Unbehagen, Schmerzen, dem Gefühl, sich Dinge nicht mehr richtig merken zu können, Konzentrationsstörungen, Angstzuständen und Depressionen aus. Sie sehen schon, dass die „Depression“ nur ein Teil aus einem ganzen Bündel an Beschwerden ist, die auftreten können. Daher neige ich dazu, viel mehr von einem Serotoninmangel-Syndrom zu sprechen, weil das viel einleuchtender ist und den Nagel eher auf den Kopf trifft, als alles unter „Depression“ zu subsumieren.
Psychosomatik für den Arzt
Die Psychosomatik erfordert ein spezielles Fachwissen. In der Praxis bedeutet das, dass zu einem Medizinstudium und zu einer Ausbildung zum Allgemeinmediziner oder Facharzt noch eine weitere Ausbildung oder zumindest Zusatzqualifikation notwendig ist. Das Problem ist nur, dass weder im Spital noch in der Praxis im Rahmen des Routinebetriebs genügend Zeit für die spezielle Behandlung psychosomatischer Beschwerden zur Verfügung steht. Es muss also eine Extrazeit dafür reserviert werden, zum Beispiel am Nachmittag, was wiederum eine Umstrukturierung der Ordination für diese Zeit erfordert.
Aber es wäre auch nicht zwingend notwendig, dass Ärzte die psychotherapeutische Behandlung von psychosomatischen Erkrankungen selbst übernehmen. Es gehört in den Bereich der medizinischen Träume, dass Körper und Seele immer nur gemeinsam behandelt werden können. Sie sind zwar untrennbar miteinander verbunden und der eine Teil beeinflusst den anderen, aber die Behandlung wird sich oft aufteilen müssen. Die Aufgabe des Arztes besteht darin, die Zusammenhänge zu erkennen, anzusprechen, die Diagnose zu stellen und mit dem Patienten gemeinsam ein erweitertes Behandlungskonzept zu erarbeiten. Dazu gehört natürlich auch, dass eine gute Verbindung zwischen Arzt und Psychotherapeut vorhanden ist, damit die Motivation zur Psychotherapie noch persönlicher vermittelt werden kann. Das Wissen um die psychosomatische Gesprächsführung ist somit in jedem Fall notwendig.
Die Gespräche mit dem Arzt sind ein ganz wichtiger Teil der Gesamtstrategie. Der Mediziner Sándor Bálint sprach vom „Arzt als Medizin“ und betonte damit, wie wichtig die psychische und seelische Haltung des Arztes ist. Das Gespräch sei das Wichtigste, das ganzheitliche Verstehen, selbst wenn es notwendig ist, ein Medikament zu verordnen. Die psychosomatische Gesprächsführung, das Erfassen des psychischen Hintergrundes, die Sorgen, Belastungen und Überforderungen des Patienten sowie seine soziale Situation sollten zum medizinischen Basiswissen gehören und bereits im Medizinstudium und in der weiteren Ausbildung vermittelt werden. Auch das gemeinsame Erarbeiten der Wechselwirkungen zwischen seelischer Belastung und körperlicher Befindlichkeit sowie das gemeinsame Erarbeiten eines speziellen Therapieplanes mit Einbeziehen eines psychosomatischen Spezialisten würden dabei zur psychosomatischen Grundversorgung gehören.
Für die in der Psychosomatik spezialisierten Ärzte ergibt sich ein sowohl finanzielles als auch zeitliches Konkurrenzverhältnis. Von befreundeten Ärzten weiß ich, dass ein Arzt in der Praxis mindestens 200 Euro in der Stunde umsetzen muss, damit er seine Ordination mit allen Ausgaben wie Personalkosten und andere Aufwendungen finanziell gut führen kann. Ein psychotherapeutischer Stundensatz in dieser Höhe ist unvorstellbar, das heißt, der Arzt ist gezwungen, sich zu entscheiden: mehr Biologie im Sinne von Technik, Ultraschall, Labor etc. mit Ordinationshilfen oder mehr Psychotherapie mit weniger Techniken und keiner Ordinationshilfe. Eine gute Möglichkeit könnte ich in folgender Lösung sehen: Der Arzt ist Anlaufstelle und Drehscheibe. Er übernimmt für alle Patienten die organische Abklärung und zieht für die psychosomatischen Problemstellungen entsprechende Spezialisten bei. Das bedeutet, er vermittelt eine Behandlung bei Ärztinnen und Ärzten mit Psychotherapieausbildung oder Psychotherapeuten, die sozusagen in seinem Umfeld und Energiekreis arbeiten und mit denen er auch einen regen fachlichen Austausch hat.
Um diesen Prozess besser strukturieren zu können und sowohl den betroffenen Patienten als auch den zuweisenden Ärzten eine Orientierungsmöglichkeit zu geben, haben wir in Österreich das „Netzwerk Psychosomatik“ gegründet und installiert. Über die Homepage (www.netzwerk-psychosomatik.at) stellen sich viele Kollegen mit ihren Spezialausbildungen vor, sodass einerseits die richtige Arztwahl, andererseits die richtige Zuweisung erleichtert wird.
Ich bin überzeugt, dass der Psychosomatik nur so zum Durchbruch verholfen werden kann, dass sich Ärzte und Psychotherapeuten auf die Behandlung der verschiedenen Krankheitsbilder spezialisieren. Nehmen wir zum Beispiel ein Krankheitsbild, das in den Industrieländern immer mehr an Bedeutung gewinnt: die Fettsucht. Durch das zunehmende Übergewicht entstehen eine Reihe von Folgeerkrankungen: Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Gefäßveränderungen, Neigung zu Herzinfarkt und Hirnschlag etc. Die Behandlung der Fettsucht ist jedoch eine eigene Wissenschaft. Die diversen Magazine und Frauenzeitschriften sind voll von Diätvorschlägen und guten Tipps, wie man möglichst rasch mit möglichst wenig Aufwand möglichst viele Kilos verlieren kann. Dass es so nicht funktioniert, sondern dass wesentlich kompliziertere Mechanismen eine Rolle spielen, davon kann jeder Übergewichtige ein Lied singen.
Um mit den Betroffenen gemeinsam dieses Krankheitsbild in den Griff zu bekommen, braucht man Spezialisten. Das heißt jedoch nicht, dass diese Spezialisten andere Krankheitsbilder, wie zum Beispiel Asthma, genauso effizient behandeln können. Eindeutig ist die Situation beim Zahnarzt. Ich bin mit einem Dentisten befreundet, der meint, dass er anhand der Zähne einen Einblick in die seelische Befindlichkeit des Patienten hat, der vor ihm im Stuhl sitzt. Zahnabrieb, Zahnstellung und Zustand der Pflege der Zähne lassen Rückschlüsse auf Stress, unterdrückte Aggression oder Überforderung zu. Was tut ein Zahnarzt, der die seelische Situation seiner Patienten erkennt? Er kann auf die psychosomatischen Zusammenhänge hinweisen, er kann sagen, dass Belastungen, Stress und Aggressionen an den Zähnen sichtbar werden. Er kann motivieren, indem er betont, dass Gespräche zur Entlastung führen können. Er kann darauf hinweisen, dass er eng mit Psychotherapeuten zusammenarbeitet und dass gemeinsam große Erfolge erzielt werden konnten. Er kann die Angst lindern und betonen, dass keiner dem Patienten zu nahe treten möchte, sondern dass es sich um ein Angebot handelt, das zum Medizinischen und Menschlichen selbstverständlich dazugehören sollte. Er kann eine erweiterte Form der Medizin anbieten und vermitteln, die Psychotherapie wird er aber nicht selbst durchführen.
Die Abwehr der Betroffenen
Ein wesentlicher Grund, warum die Wahrnehmung des seelischen Anteils an körperlichen Erkrankungen so langsam Eingang in das medizinische System findet, ist das schon beschriebene unbewusste Zusammenspiel von Patienten- und Arzt-Interessen. Aufseiten der Patienten ist es zwar durchaus erlaubt, seelische Belastungen zu haben, unter Konflikten zu leiden und einem Übermaß an Stress ausgesetzt zu sein. Es ist jedoch nicht erlaubt, so zu leiden, dass eine körperliche Erkrankung daraus resultieren könnte.