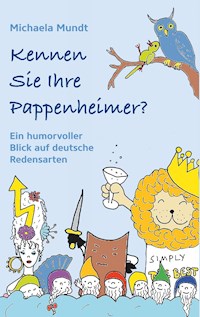
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kennen Sie Ihre Pappenheimer schon aus dem Effeff? Oder fragen Sie sich immer noch, warum die Leberwurst eigentlich beleidigt ist? Dann hält dieses Buch viele unterhaltsame Aha-Erlebnisse für Sie bereit. Bis heute gebräuchliche oder auch etwas altertümliche Sprichwörter und Redewendungen werden hier in ihrem thematischen Zusammenhang vorgestellt, statt sie (wie sonst meist üblich) alphabetisch nacheinander 'abzuarbeiten'. Und dadurch eröffnen sich viele interessante Querverbindungen. Von der oft sehr anschaulichen 'Körpersprache' bis hin zum Kerbholz und der Kuhhaut, auf die nichts mehr passt, können Sie sich ganz entspannt Schritt für Schritt durch die bunte Welt der Redensarten lesen. 65 amüsante Illustrationen begleiten Sie dabei. Sie wollen aber lieber gezielt mehr zu einer ganz bestimmten Redewendung wissen? Der umfangreiche Index geleitet Sie direkt zu der Bedeutungserklärung, für die Sie sich gerade interessieren. Dieser erheiternde Blick auf die Ursprünge populärer deutscher Idiome ist ein Must-have für alle, die sprachlichen Bilderreichtum nicht nur gebrauchen, sondern auch verstehen wollen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Elmar, der mich seit 2008 zu diesem Buch ermutigt hat.
Inhalt
Appetithäppchen
Intro
Ehrlich gesagt
Glückssachen
Genug Kleingeld dabei?
Goldrichtig
Da klappert’s im Handwerk
Einfach mal blau machen
Körpersprache
Haarsträubend!
Augenweiden
Kopfnüsse
Die inneren Wortwerte
Das schöne Händchen und der falsche Fuß
Völlig vernagelt!
Naturgewaltiges
Feuer und Flamme
Wasser in aller Munde
Potzblitz und aufgedonnert!
Tollpatschig in Bredouille
Das freut den Schneekönig!
Grün ist die Hoffnung
Unkraut vergeht nicht
Holz vor die Hütte!
Die Weisheiten der Steine
Mond und Sterne
Namhafte Namen
Kennen Sie Ihre Pappenheimer?
Heroen und Hungerleider
Wer vom Teufel spricht
Tierisch treffsicher
Schräge Vögel
Gut gebrüllt, Löwe?
Alles für die Katz!
So ein Hundeleben!
Schwein gehabt!
Null Bock auf Bockmist
Sein Name ist Hase
So eine Maulaffenschande!
Das bunte Leben
Bei aller Liebe!
Essen hält Laib und Seele zusammen
In vino veritas
Sich regen bringt nicht immer Segen
Hempels Sofa, mit Tisch
Unter einen Hut gebracht
Kamerad Schnürschuh, der Pantoffelheld
Howgh, liebe Bleichgesichter
Was für ein Theater!
Hornbergs Schützenfest
Mit Pauken und Trompeten vergeigt
Höchste Eisenbahn!
Seemannsgarn
Fadenscheinige Argumente
Zeit für eine Zeitreise!
Wort und Zahl
So ein Kauderwelsch!
Die fiesen Matenten
Doppelt gemoppelt
Buchstabensalat
Selbst schuld!
Lieben Sie Sieben?
Anhang
Index
Bilder
Quellen
Appetithäppchen
Intro
Schön, dass Sie da sind, liebe Leserinnen und Leser!
Legen Sie Ihre Worte immer »auf die Goldwaage«? Oder schimpfen Sie lieber munter drauflos, wenn Ihnen »eine Laus über die Leber gelaufen« ist? Malen Sie nicht gleich »den Teufel an die Wand«, nur weil »der Haussegen schief hängt«! Sicher werden Sie bald wieder »Oberwasser haben« und vor lauter Glück vielleicht sogar »auf Wolke sieben schweben« ...
Tag für Tag liegen sie uns auf der Zunge: kluge Redensarten und Sprichwörter für alle Lebenslagen. Manchmal kommen sie uns ganz unbewusst über die Lippen. Doch was steckt eigentlich hinter dem, was wir da so alles sagen?
Naturbeobachtungen, Bibelweisheiten, antike Mythologie, traditionelles Handwerk, mittelalterliche Gebräuche, Brett- und Kartenspiele, Verballhornungen fremder Sprachen und vieles mehr sind in der Welt der Redensarten untrennbar miteinander verwoben. Oft gibt es auch mehr als nur eine einzige Erklärung zur Herkunft einer Wendung. Die Sprache macht halt so ihre »Fisimatenten«; und gerade darin liegt ihr ganz spezieller Reiz.
Seien Sie also auf allerlei Gedankensprünge gefasst! Wir werden hier »vom Hündchen aufs Stöckchen« und »vom Bismarck zum Hering« kommen. Wenn wir eigentlich mitten in der Tierwelt sind und Redewendungen rund um den Hund beleuchten, landen wir urplötzlich in der Kohlegrube. Die Suche nach dem Wohnsitz der Seele führt uns in den Metzgerladen, und das Schuhzeug des ungarischen Heeres hilft uns aus der schlammigen Patsche, in der wir gerade sitzen.
Doch keine Sorge: der umfangreiche Index im Anhang weist Ihnen bei Bedarf den direkten Weg zur Erklärung der Redensart, für die Sie sich gerade interessieren.
Der Geschichte, den Geschichtchen und den oft wirklich sehr elementaren menschlichen Erfahrungen, die sich hinter unseren allgemein bekannten Redewendungen verbergen, widmete ich mich von Anfang 2008 bis Ende 2014 im Rahmen einer regelmäßigen Rubrik für ein norddeutsches Kundenmagazin. Für dieses Buch habe ich die damals Monat für Monat als ›Einzelstücke‹ erschienenen Beiträge komplett überarbeitet und ergänzt, nach verwandten Themen neu arrangiert und mit eigenen Zeichnungen illustriert.
Zu den Hintergründen der hier vorgestellten Idiome hat die Sprachwissenschaftlerin und Volkskundlerin in mir zwar schon sehr akribisch recherchiert – doch der Anspruch, eine wissenschaftliche Arbeit zum Thema Redensarten zu liefern, besteht nicht. In erster Linie will ich Sie einfach nur unterhalten und Ihnen dabei vielleicht das eine oder andere amüsante Aha-Erlebnis bereiten. Das ist doch auch in Ihrem Sinne, oder? Gut. Beginnen wir mit ein paar Appetithäppchen!
Ehrlich gesagt ...
Der Ursprung vieler Redewendungen liegt nur scheinbar auf der Hand; hier kann es durchaus sehr kuriose Überraschungen geben. Was etwa haben Klöße, Fett oder Blumen mit unserem Reden und Begreifen zu tun?
Die Sprache der Rose
Wer »etwas durch die Blume sagt«, der versucht, jemandem in bildhaft-symbolischen Andeutungen eine unerfreuliche Wahrheit möglichst schonend beizubringen oder behutsam und freundlich Kritik zu üben.
Wenn der Angesprochene daraufhin aber mit »Vielen Dank für die Blumen!« kontert, dann ist er nicht zwingend ein Udo-Jürgens-Fan, sondern will wahrscheinlich deutlich machen, dass er die Krittelei sehr wohl erkannt hat – auch wenn sie noch so hübsch verpackt und versteckt war.
Schon in der antiken Rhetorik war das Blümlein (lateinisch flosculus) ein Gewächs der schönen und verhüllenden Rede, dessen Ableger unsere heutige »Floskel« ist. Und in gebildeten Kreisen sprach man dann bis ins 19. Jahrhundert hinein gern »sub rosa«, man versteckte seine kritischen Aussagen also wortwörtlich »unter einer Rose«.
Doch auch ganz konkret – und völlig stillschweigend! – lassen wir noch heute die Blumen für uns sprechen: Wer eine rote Rose verschenkt, der offenbart damit seine Liebe, ohne die drei Worte aussprechen zu müssen, die manchem so schwer über die Lippen kommen. Gelbe Rosen dagegen verteilt man eher unter Freunden. Und was könnte wohl mit einem Kaktus oder einer Distel gemeint sein? Sagt da vielleicht jemand ganz unverblümt – also ganz direkt und rücksichtslos –, dass er den anderen nicht so recht leiden kann?
Die Goldwaage und das Fettnäpfchen
Wer nicht ins Fettnäpfchen treten will, sollte seine Worte (und auch seine Kakteen!) also lieber auf die Goldwaage legen. Dieses empfindliche Gerät prüft nämlich nicht nur das Gewicht von Edelmetallen sehr genau, sondern es warnt uns sinnbildlich auch dann, wenn unsere Bemerkungen andere verletzen oder uns selbst schaden könnten. Eine entsprechende Empfehlung dazu steht schon in der Bibel: »Dein Silber und Gold verwahrst du abgewogen, mach auch für deine Worte Waage und Gewicht!« (Buch Jesus Sirach, 28.25)
Das Fettnäpfchen dagegen stammt sehr wahrscheinlich aus dem Erzgebirge. Hier nämlich standen in den Bauernhäusern früher tatsächlich echte Näpfe mit Fett zwischen Haustür und Ofen, damit die draußen vielleicht nass gewordenen Stiefel der Bewohner oder der Besucher gefettet, geschützt und gepflegt und damit vor feuchten Rändern bewahrt werden konnten. Doch wer versehentlich in dieses Näpfchen trat oder es umkippte, der verteilte anschließend überall schmierige Fettflecken auf dem Dielenboden – und zog sich dadurch den Zorn der Hausfrau zu, die das ja alles wieder wegputzen musste.
Alles klar wie Klosterbrühe!?
Auch wenn jemand sagt »Das ist doch klar wie Kloßbrühe!«, kann man schon etwas ins Grübeln kommen. Gemeint ist zwar: »Das versteht sich von selbst, ist doch gar nicht kompliziert!« Doch war das vielleicht ironisch gemeint?
Ist Kloßbrühe nicht eher eine trübe Flüssigkeit? Na ja, aber Erbseneintopf oder Spargelcremesuppe sind eindeutig noch schwerer zu durchschauen als Brühe ... Es sind die Klöße, die die Sache eben doch verkomplizieren. Sie haben sich nämlich erst im Laufe der Zeit in diese Redewendung eingeschlichen, um uns in Verwirrung zu stürzen.
Laut Lexikon der populären Sprachirrtümer jedenfalls müsste es korrekterweise eigentlich heißen: »Das ist doch klar wie Klosterbrühe!« Denn diese Nahrung der asketischen Mönche (die übrigens ganz ohne Fleischklöße zubereitet wird) hatte früher tatsächlich ganz dünn und vollkommen klar zu sein, um der Völlerei vorzubeugen. Ganz durchsichtig also – und damit zweifelsfrei.
Tabula Rasa – die römische Reinlichkeit
Die »Tabula rasa« dagegen, die wir machen, wenn wir »reinen Tisch machen«, Klartext reden und rigoros das Alte verbannen, um dem Neuen Raum zu schaffen, bedeutet wörtlich übersetzt schlicht: »glatt geschabte Schreibtafel«.
Dieses Sprachbild geht auf eine im alten Rom gebräuchliche Notizzettelwirtschaft zurück: Damals ritzte man seine To-Do-Liste in kleine Wachstäfelchen, die nach erledigter Aufgabe einfach wieder glattgestrichen wurden.
(Un)Höflichkeiten
Romantiker machen ihrer Liebsten derweil lieber »den Hof«. Warum denn das? Haben sie nichts Besseres zu tun als zu fegen und die Mülltonnen in Reih und Glied aufzustellen?
Nein, Hinterhofidyllen sind mit dieser Redewendung nicht gemeint. Hier geht es vielmehr um den Hof eines Fürsten, als den man früher nicht nur dessen gesamtes Anwesen, sondern auch die Menschen in seiner Umgebung bezeichnete – also auch die Schar der Höflinge, die ihren Herrscher stets höflich buckelnd umschmeichelten.
Passend dazu steckt hinter dem heute auf Baby-Format verniedlichten »Bäuerchen machen« das alte Vorurteil der Oberschicht, dass sich die Landbevölkerung nicht zu benehmen wüsste und – unter anderem – hemmungslos drauflos rülpste.
Dumme Kühe und Kleinkriminelle
Sehr reich ist die deutsche Sprache an Redensarten, in denen wir das geistige Unvermögen anderer Menschen bildhaft ausschmücken. Der nervige Nachbar etwa ist »so dumm, wie er lang ist«, die zickige Kollegin eine »saudumme Kuh« – und alle beide sind auf jeden Fall »dümmer als die Polizei erlaubt«!
Die Vorstellung, dass Dummheit die öffentliche Sicherheit so sehr gefährdet, dass die Ordnungshüter eingreifen sollten, ist bereits seit 1870 überliefert. Gemeint war ursprünglich jedoch, dass Unwissenheit im Sinne von fehlenden Informationen kein Argument ist, um sich bei Gesetzesverstößen herauszureden.
Bei Wendungen wie »Das Glück is mit die Doofen« oder »Der hat mehr Glück als Verstand gehabt!« aber liegt der Verdacht nahe, dass diese Weisheiten von wenig erfolgreichen, dafür aber umso neidischeren Intellektuellen kreiert wurden …
Glückssachen
Die meisten Redensarten rund ums Glück braucht man nicht lange zu erklären. Wenn wir reimen »Glück und Glas – wie leicht bricht das!« oder finden, dass »jeder seines Glückes Schmied« ist, dann haben wir dabei sehr anschauliche Vorstellungen im Kopf: Wir sehen zarte Scherben auf dem Boden liegen oder hören förmlich das energische Einhämmern auf das Hufeisen Zukunft …
Das schon ab dem 12. Jahrhundert als »(ge)lucke« bekannte Glück bedeutete ursprünglich jedoch ganz neutral »Zufall« oder »Schicksal«, es war also nicht zwingend positiv gemeint: Entweder »glückt« (= »gelingt«) uns etwas »auf gut Glück« – oder eben nicht.
Warum aber schießen ausgerechnet »Glückspilze« aus den Böden dieser Welt, während die »Unglücksraben« auf den eher kargen Ästen des Lebens sitzen?
Raben und andere Pechvögel
Bei den Germanen und in anderen alten Kulturen galten die in der Tat hochintelligenten Raben noch als Vögel der Weisheit. Odins Begleiter etwa, die beiden Raben Hugin und Munin, informierten den Götterkönig der nordischen Mythologie sachkundig über das aktuelle Weltgeschehen.
Im Zuge der Christianisierung aber wurden die Schwarzgefiederten dann als böse, teuflische Tiere interpretiert – und als Unglücksboten, deren Flug Tod oder Krieg ankündigte. Zu diesem schlechten Image trugen die Raben selbst sicher auch ein Stück weit bei, da sie sich als Aasfresser gern an Hinrichtungsstätten aufhielten, an denen man die Gehenkten früher einfach offen baumeln ließ. Die »Unglücksraben« waren zugleich also auch »Galgenvögel«; und da Rabenvögel sehr gesellige Tiere sind, kommt »ein Unglück selten allein«.
Der »Pechvogel« dagegen muss nicht unbedingt ein Rabe sein. Sein gattungsübergreifendes Merkmal ist vielmehr, dass er den Menschen »auf den Leim geht«, sich also von ihnen austricksen lässt. Wie noch heute in manchen Kulturen, so bestrich man früher auch bei uns Äste mit Leim oder klebrigem Pech, um die Vögel, die sich hier niedersetzten, zu fangen – und dann zu verspeisen.
Pilze, die gut bei Kasse sind
Die »Glückspilze« sind demgegenüber eine recht moderne Erfindung. Sie entstanden im 18. Jahrhundert, als die beginnende industrielle Revolution die Neureichen geradezu wie Pilze aus dem Boden schießen ließ.
Entsprechend war der Begriff ursprünglich im Sinne von »Emporkömmling« beziehungsweise »Parvenü« gemeint – oder im Englischen eben etwas bilderreicher: mushroom.
Genug Kleingeld dabei?
Geld stinkt nicht. Aber dafür regiert Geld die Welt. Unter anderem auch die Welt der Redewendungen. Nicht nur, weil das Geld hier – von der »Knete« bis zum »Moos«, von den »Blüten« bis zu den »Kröten« und »Mäusen« – selbst so viele bilderreiche Namen hat. Nein, in unserem Sprachgebrauch ist auch eine ganze historische Münzsammlung versteckt.
Alte Bekannte: Mark, Groschen und Pfennig
Bevor 2002 die »Euronen« kamen, mussten wir ja »jede Mark dreimal umdrehen«, bevor wir sie ausgaben. Sei’s als Reichsmark (ab 1924) oder, ab 1948, als D-Mark beziehungsweise Mark der DDR. Und das schon seit 1871, als diese Währung im Deutschen Kaiserreich eingeführt wurde. Damals löste die Mark übrigens den Taler ab, eine Großsilbermünze, die europaweit verbreitet war. Ah, deshalb sagt man also: »Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert!«
Der Pfennig wurde im 8.-13. Jahrhundert übrigens durchaus sehr geehrt. Denn damals war er noch eine wertvolle Silbermünze von hoher Kaufkraft. Erst Ende des 17. Jahrhunderts sank er zur Billig-Kupfermünze herab. Eine regionale Variante zum Pfennig war der in Schwäbisch Hall geprägte Häller Pfennig oder Heller. Wer also »auf Heller und Pfennig genau« zahlt, der rundet zwar nicht großzügig auf – aber er moppelt doppelt.
Alte Unbekannte: Deut und Scherflein
Oft geht es auch da ums Geld, wo es in modernen Ohren gar nicht danach klingt. Zum Beispiel dann, wenn wir zu etwas »unser Scherflein beitragen« oder uns im Gegenteil »keinen Deut darum scheren«.
»Ik geef er geen‘ koperen duit voor« (= Da gebe ich keinen kupfernen Deut für) sagte man in den Niederlanden, wenn man auf etwas nicht den geringsten Wert legte. Und meinte damit die heimische Variante des Pfennigs, den Deut, der 1573-1816 ebenfalls nur noch aus dem billigsten Metall bestand.
Der Scherf war schon im Mittelalter nur eine kleine Münze im Wert eines halben Pfennigs. Martin Luther prägte die Redewendung, die das »Scherflein« zum Inbegriff der geringfügigen Gabe zu einem größeren Ganzen machte.
Von echtem Schrot und Korn
Manche Redensarten hängen auch mit altem Münzwesen zusammen, obwohl uns zunächst eigentlich ganz andere Bilder in den Kopf kommen. Ein Mensch »von echtem Schrot und Korn« zum Beispiel hat einen gradlinigen, aufrichtigen Charakter. Doch er hat weder mit Schießpulver noch mit Getreide oder Schnaps zu tun. Schrot bezeichnet vielmehr das sogenannte Rauhgewicht, das Gesamtgewicht einer Münze einschließlich der beilegierten unedlen Metalle, Korn dagegen ihr Feingewicht, das dem Anteil an Edelmetallen entspricht. Je näher beide Werte beieinander liegen, desto echter ist das Schrot und desto unverfälschter und wertvoller die Münze.
Goldrichtig
»Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles … Ach wir Armen!« Das wusste schon das Gretchen in Goethes Faust (Der Tragödie erster Teil, Abend). Gold ist für uns Inbegriff sowohl materieller wie auch menschlicher Werte.
Auch unter kommunikativen Aspekten ist Gold durchaus Gold wert! Ihm verdanken wir wertvolle Einsichten wie »Reden ist Silber, Schweigen ist Gold«, und um unkontrolliertes Herumgeplapper mit unbeabsichtigten Wirkungen zu vermeiden, legen wir im Idealfall jedes dennoch gesprochene Wort akribisch auf oben ja schon vorgestellte Goldwaage.
»Morgenstund‘ hat Gold im Mund!«
Die Meinung, dass frühes Aufstehen lohnt, weil man morgens am besten arbeiten und so mehr erreichen kann, geht auf die lateinische Weisheit »aurora habet aurum in ore« zurück. Diese besagt eigentlich aber einfach nur, dass man sich Aurora, die Göttin der Morgenröte, im alten Rom mit Gold im Haar und im Mund vorstellte.
Goldnasen und -kehlen
Wer stattdessen jedoch »Gold in der Kehle« hat, tritt besser abends im Opernhaus auf, denn bei Tenören ist ein metallischer Klang in der Stimme sehr gefragt; und das rechnet sich!
Eine »goldene Nase« kann man sich – ähnlich wie König Midas, der alles zu Gold machte, was er anfasste – natürlich auch verdienen, indem man einen Laden oder Onlineshop aufmacht, der sich als wahre »Goldgrube« erweist.
Fische, Löffel und Käfige
Oder haben Sie vielleicht einen »Goldfisch an der Angel«? Also einen Partner, der als Kind reicher Eltern »mit einem goldenen Löffel im Mund geboren« wurde, nun aber froh ist, dass Sie ihn endlich aus seinem »goldenen Käfig« befreien?
Aber: »Es ist nicht alles Gold, was glänzt«
Das auch als »Katzengold« bekannte Mineral Pyrit zum Beispiel schimmert zwar goldfarben, doch es setzt sich lediglich aus Eisen und Schwefel zusammen und ist daher als Geldanlage wirklich »für die Katz«. Lukrativer wäre da der »Goldesel« aus dem Märchenland, bei dem echtes Edelmetall am Ende des Verdauungsvorgangs steht.
Da klappert’s im Handwerk
Das Schneiderhandwerk jedenfalls hatte in früherer Zeit keinen »goldenen Boden«. Es reichte also kaum als Existenzgrundlage aus und ernährte nur sehr schlecht.
Das arme Schneiderlein
Man sagte sogar, dass ein Schneider nicht mehr als 30 Lot (also nur rund ein halbes Kilo!) wiegen würde. Diese Idee wurde dann auf Kartenspiele wie Skat übertragen, bei denen verliert, wer nur 30 oder weniger Punkte einspielt. Wer aber über dieser Punktzahl lag, der war »aus dem Schneider«, also nicht auf der Verlierer-, sondern auf der Gewinnerseite.
»Das kannst du halten wie ein Dachdecker!«
Dass ausgerechnet Dachdecker zum Inbegriff des »Mach es einfach, wie du willst« geworden sind, liegt am Berufsrisiko: Ob sie in schwindelnder Höhe korrekt arbeiteten oder hemmungslos pfuschten, wagten nämlich weder der Architekt noch der Bauherr zu kontrollieren – schlicht aus Angst, herunterzufallen.
Freie Wahl hatten die Dachdecker des Mittelalters zudem auch bei der Handwerksgilde, der sie beitreten wollten. Sie konnten sich sowohl zu den Maurern als auch zu den Zimmerleuten rechnen.
»Schuster, bleib bei deinen Leisten!«
Auch Schuhmacher konnten sich allerlei herausnehmen, berichtet eine Anekdote über den griechischen Maler Apelles, der im vierten Jahrhundert v. Chr. lebte. Der Künstler belauschte einst, wie ein Schuster an den Schuhen auf einem Gemälde bemängelte, dass ihnen eine Öse fehle. Derart fachkundige Kritik nahm sich Apelles zu Herzen und korrigierte das Bild.
Doch der Schuhmacher war immer noch nicht zufrieden und krittelte nun an der Darstellung der Beine und der Kleidung herum. Da wurde es Apelles zu bunt, und er konterte mit den Worten: »Was über dem Schuh ist, kann der Schuster nicht beurteilen!«
Später gab die Anspielung auf die Leisten, also auf die hölzernen Fußmodelle des Schusters, dieser Schutzformel gegen Einmischung ohne echte Sachkenntnis den letzten Schliff.
»Der säuft wie ein Bürstenbinder!«
Ein heute fast ausgestorbener Handwerkszweig dagegen scheint für hemmungslosen Alkoholkonsum besonders anfällig gewesen zu sein. Tatsächlich waren Bürstenbinder, die zur Desinfektion der Schweineborsten mit staubigem Kalk hantierten, sicher oft sehr durstig.
Einfach mal blau machen
Wer am Wochenende ziemlich »blau«, also reichlich betrunken war, der legt besonders gern einen »blauen Montag« ein und kommt lieber gar nicht erst zur Arbeit. Kurz: Er »macht blau«. Warum nicht grün, schwarz oder gelb?





























