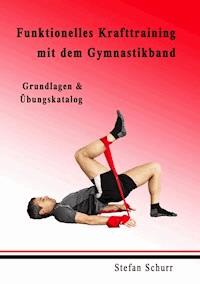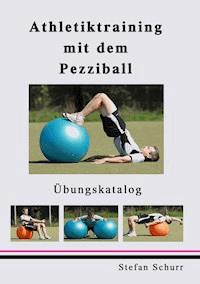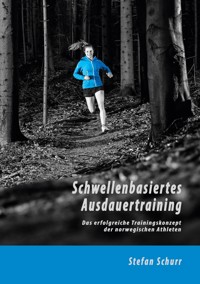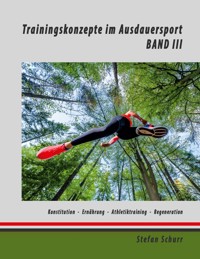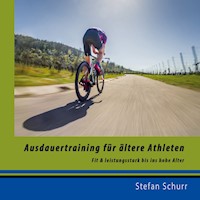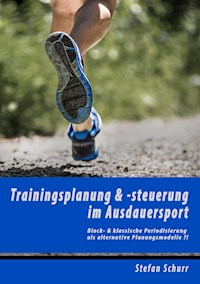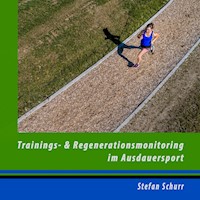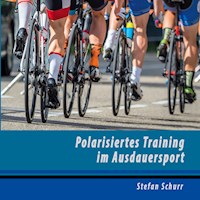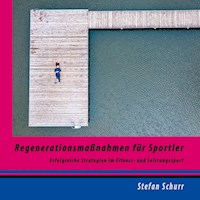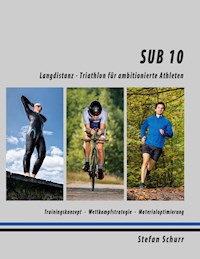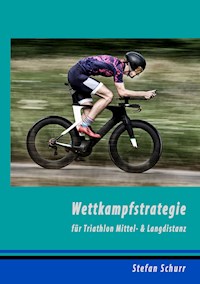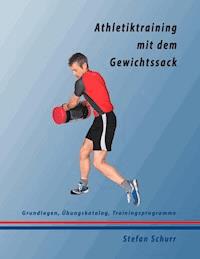Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Künstliche Intelligenz hält Einzug in den Sport: Wo früher starre Trainingspläne und allgemeine Empfehlungen dominierten, entstehen heute dynamische Systeme, die Training, Ernährung und Regeneration individuell und in Echtzeit steuern. Dieses Buch zeigt, wie Plattformen bereits erfolgreich im Profisport eingesetzt werden und welche Chancen sich für ambitionierte Amateursportler mit frei verfügbaren Tools eröffnen. Es beleuchtet die Herausforderungen wie Datenqualität, Transparenz und Akzeptanz; und diskutiert die neue Rolle des Trainers im Zusammenspiel mit der Technologie. Mit zahlreichen Praxisbeispielen wird deutlich, wie KI nicht nur Leistung steigert, sondern auch die Gesundheit bewahrt. Ein Buch für Athleten, Trainer und alle Sportinteressierten, die einen Blick in die Zukunft werfen wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Einleitung
Was ist Künstliche Intelligenz?
Relevanz für den Sportkontext
Fazit - KI im Sport – mehr als nur ein Hype
Status Quo von Trainingsplanung und -steuerung
Grundprinzipien traditioneller Trainingsplanung
Datengrundlage
Die Rolle des Trainers
Limitierungen bisheriger Ansätze
Wie KI das Training verändert
Datenerfassung -die neue Währung
Der personalisierte Trainingsplan
Von der Leistungsdiagnostik zur Stoffwechselsimulation
Die INSCYD Leistungsdiagnostik
INSCYD Testprotokolle
Belastungssteuerung und Regenerationsüberwachung
Biomarker der Erholung -Frühwarnsystem des Köpers
Tools und Plattformen
Regenerationsüberwachung
WHOOP 5.0: Smarte Regenerationssteuerung
Oura Ring – Der stille Regenerationscoach
Garmin Smartwatches – Leistungsdiagnose
Polar Wearables – Präzision in der Regenerationsanalyse
Apple Watch – Vielseitige Gesundheitsplattform
Supersapiens (mit CGM-Sensoren) – Echtzeit-Metabolik
CORE Body Temperature– Körperkerntemperatur in Echtzeit
Trainingsplanung mit KI-Plattformen
TrainingPeaks – eine kurze Bestandsaufnahme
TrainAsONE – Der Pionier für adaptive Laufpläne
AI Endurance – Maximale Kontrolle für Technik-Fans
TrainerRoad – Adaptive Power im Radsport
Athletica.ai – Wissenschaft trifft KI-Coach
Vergleich der KI-gestützten Trainingsplattformen
Menschlicher Coach vs. KI-System vs. Hybrides Modell
Pradigmenwechsel – Wie KI den Sport transformiert
KI im Trainingsalltag
Fallbeispiel 1: Marathonläuferin nutzt AI Endurance zur Wettkampfvorbereitung
Fallbeispiel 2: Radsportler nutzt TrainerRoad und Whoop zur individuellen Trainingsoptimierung
Fallbeispiel 3: Triathlet nutzt Hybrid-Coaching mit Athletica.ai und Personal Coach
Tipps zur Integration von KI-gestütztem Training
KI im Profisport
Vekta / Jayco AlUla
Praxisablauf – Wie Team Jayco AlUla Vekta einsetzt
Die öffentliche Version von Vekta
Grenzen, Risiken und ethische Fragen
Datensicherheit und Datenschutz
Die Black Box: Warum tut die KI, was sie tut?
Verlust der Körperintuition?
Ein Blick in die Zukunft
Vom Trainingsplan zur Lebensbegleitung
Integration von Umweltbedingungen in Echtzeit
Der „Digital Twin“
Verschmelzung mit Wearables & Sensorik
Hybride Coaching-Modelle als Standard
Ethik, Regulierung & digitale Bildung
Technologie als Chance – nicht als Ersatz
Literatur- und Quellenverzeichnis
Fachliteratur & Wissenschaftliche Studien
Tools & Systeme (Praxisquellen und Websites)
Pilotprojekte & Praxisbeispiele
Einleitung
„Wir trainieren nicht mehr im Blindflug“
wie Künstliche Intelligenz den Leistungssport verändert.
Die digitale Revolution hat nahezu alle Bereiche des modernen Lebens durchdrungen. Auch der Sport bildet keine Ausnahme. Es zählen längst nicht mehr nur Muskelkraft, Talent und Disziplin. Die entscheidende Frage ist heute viel mehr: Wie gelingt es, aus einer Flut von Daten kluge Entscheidungen für Training, Ernährung und Wettkampf zu treffen?
Trainingsdaten, Herzfrequenzverläufe, Schlafphasen, Glukosekurven, GPS-Tracks, Wattzahlen, Laktatwerte – all das kann man heute in Echtzeit erfassen, speichern und auswerten. Die Datenerhebung hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt, aber die Nutzung dieser Informationen hinkt oft noch hinterher. Die zentrale Frage lautet daher nicht mehr: Was können wir messen? – sondern: Was können wir sinnvoll mit den Daten machen?
Intelligente Trainingssteuerung, die auf Datenanalyse, Lernalgorithmen und adaptiven Systemen basiert, ist nicht mehr bloße Zukunftsvision, sondern dringt mit zunehmender Geschwindigkeit in den professionellen und ambitionierten Sport ein. Und sie ist wichtiger denn je.
Belastungen im Leistungssport steigen stetig – physisch, psychisch und strukturell. Profisportler stehen ständig unter hohem Druck. Für kontinuierliche Leistungssteigerungen müssen sie ihre Trainingsbelastungen genau dosieren, aber auch auf sich ändernde Umweltbedingungen (z. B. Reisen, Höhenlage, Hitze, Ernährung) situativ angemessen reagieren. Athlet und Trainer sehen sich, auch aufgrund der Vielzahl der erhobenen Trainings-, Regenerations- und Belastungsdaten, mit einer kaum mehr zu überblickenden Komplexität konfrontiert: Unterschiedliche Athletentypen, individuelle Regenerationsverläufe, periodisierte Saisonplanung, Wettkampfdichte, verletzungsbedingte Trainingspausen, …....und so weiter. Die Liste escheint fast endlos. Und trotz moderner Testverfahren und vieler Daten bleibt eben doch vieles eine Mischung aus Erfahrung, Bauchgefühl und grober Orientierung. Künstliche Intelligenz (KI) bietet hier einen neuen, dringend benötigten Zugang. Sie erkennt Muster in großen, mehrdimensionalen Datenmengen, kann in Echtzeit Prognosen abgeben, Entwicklungen antizipieren und Entscheidungsprozesse unterstützen. Sie ist schn-eller als der Mensch, vergisst nicht und lernt kontinuierlich dazu.
Wie KI bereits heute erfolgreich im Hochleistungssport eingesetzt wird, liefert das Beispiel des australisch-saudische UCI-WorldTour-Team Jayco AlUla. Das Profiradsportteam hat frühzeitig erkannt, welches Potenzial KI-gestützte Systeme bieten können – insbesondere in den drei Schlüsselbereichen Training, Ernährung und Wettkampfsteuerung. Wir wollen im weiteren Verlauf des Buches vor allem auf diese Punkte eingehen.
Wie sieht das bei Jayco AlUla aus? Das Team nutzt die Plattform Vekta, ein KI-basiertes Coaching-Tool, das Leistungsdaten in Echtzeit auswertet. Es analysiert Wattzahlen, Herzfrequenzverläufe, Trainingseffizienz, Erholungskennzahlen und schlägt darauf basierend tagesaktuelle Trainingsanpassungen vor. Die Software erkennt Muster, Trends und Abweichungen im individuellen Responseverhalten eines Fahrers – und kann so potenzielle Überbelastung oder ineffiziente Trainingsphasen frühzeitig identifizieren. Die Trainer behalten die Kontrolle, aber sie erhalten eine datenbasierte „zweite Meinung“ – eine, die rund um die Uhr rechnet, lernt und neue Zusammenhänge aufdeckt.
Auch im Bereich Ernährung setzt Jayco AlUla auf adaptive, KI-gestützte Empfehlungen. Die berücksichtigen nicht nur Belastungsprofile und Energieverbrauch der Athleten, sondern auch klimatische Bedingungen, Höhenlage, individuelle Verdauungskapazitäten und die Zeit bis zum nächsten Belastungsfenster. Besonders innovativ ist der Einsatz der KI während der Rennen: Sie analysiert Rennverläufe in Echtzeit, ebenso Leistungskurven, Terrainprofile und Wetterbedingungen – und passt dazu passend gleich noch die Energiezufuhr dynamisch an. So können Hypoglykämiephasen vermieden und die Leistung über mehrere Etappen optimiert werden.
Und zu guter letzt kommt Vekta auch bei der taktischen Planung und Steuerung von Wettkämpfen zum Einsatz. Die Plattform simuliert anhand historischer Daten mögliche Rennverläufe, abhängig von Fahrerprofilen, Wetterdaten und Streckencharakteristika. Sie hilft, Rennstrategien zu entwickeln, taktische Optionen durchzuspielen und gibt Live-Feedback während der Etappen. Entscheidungen wie: Wann attackieren? Wie reagieren? Wer führt auf welchem Abschnitt? – werden auf einer datenbasierten Grundlage getroffen, nicht mehr nur aus dem Bauch heraus.
Die Entwicklungen, die im Profisport vorangetrieben werden, bleiben nicht mehr exklusiv. Zahlreiche Unternehmen haben begonnen, KI-basierte Systeme auch für ambitionierte Amateursportler zugänglich zu machen – mit Anwendungen, die sich an die individuellen Trainingsziele, Leistungsdaten und Alltagsbedingungen der Sportler anpassen.
Zu den bekanntesten Beispielen zählen etwa:
Whoop: Ein Wearable, das Erholungsstatus, Schlafqualität und Belastungsniveau analysiert und auf dieser Basis tagesaktuelle Trainingsempfehlungen gibt. Das System nutzt maschinelles Lernen, um über Zeit besser zu verstehen, wie der Körper auf verschiedene Reize reagiert.
Garmin Firstbeat Analytics: Viele Garmin-Geräte integrieren KI-basierte Trainings- und Erholungsanalysen, darunter die Training Readiness, VO2max-Trends, Empfohlene Workouts und präzise Schlafanalysen. Firstbeat war ursprünglich ein System für Elitesport, ist heute aber auch für die breite Masse verfügbar.
TrainAsONE: Ein KI-gestützter Laufcoach, der automatisch Trainingspläne gen-eriert, die sich täglich anpassen – basierend auf Fortschritt, Rückmeldungen, Belastung und Zielen.
AI-Endurance: Eine Plattform, die basierend auf Trainingsdaten (z. B. aus Strava oder Garmin Connect) automatisch personalisierte Trainingspläne erstellt. Die KI passt diese Pläne laufend an das individuelle Regenerations- und Leistungsniveau an und orientiert sich dabei an wissenschaftlich fundierten Prinzipien.
Diese Tools zeigen: Künstliche Intelligenz im Sport ist längst nicht mehr nur den Profis vorbehalten. Sie hilft zunehmend auch Hobbysportlern, smarter zu trainieren, besser zu regenerieren, Verletzungen zu vermeiden und ihren individuellen Leistungsfortschritt effizienter zu gestalten. Damit eröffnet sich ein völlig neues Feld – und es stellt sich die spannende Frage:
Wie verändert KI unser Verständnis von Training – nicht nur im Hochleistungssport, sondern auch im Alltag?
In diesem Buch möchten wir beide Perspektiven abbilden: den professionellen Spitzensport mit seinem Innovationspotenzial, aber auch die konkreten Möglichkeiten für ambitionierte Athleten im Breitensport. Die Fallstudie von Jayco AlUla zeigt, was technologisch heute schon möglich ist – und die Entwicklung der Tools für den Alltagsgebrauch, wie KI-Trainingssysteme für Amateure, dem-onstriert, wie greifbar diese Zukunft bereits geworden ist.
Aber trotz allem Hype und Begeisterung rund um die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz gibt es auch kritische Aspekte zu beachten: Vor allem ethische Fragen spielen zunehmend eine Rolle:
Wem gehören die erhobenen Daten?
Wer haftet bei Fehlprognosen oder Überbelastung?
Und wie lässt sich sicherstellen, dass KI-Systeme nicht bestehende Vorurteile – etwa hinsichtlich Geschlecht, Alter oder ethnischer Herkunft – unbewusst reproduzieren?
Ein weiteres Problemfeld ist die mangelnde Transparenz algorithmischer Entscheidungen. Die Funktionsweise der KI-Systeme ist für die Anwender kaum nachvollziehbar ist. Es entstehen sogenannte „Black Boxes“: Die KI schlägt vor, eine Einheit ausfallen zu lassen – doch warum genau, bleibt unklar. Warum tut die KI was sie tut?
Ein nicht zu unterschätzender psychophysiologischer Aspekt betrifft den Verlust der eigenen Körperwahrnehmung. Je mehr Entscheidungen an ein externes System ausgelagert werden, desto weniger Raum bleibt für das eigene Spüren: „Bin ich heute wirklich müde – oder sagt das nur mein Wearable?“ „Tut mir das Training gut – oder erfüllt es nur die Vorgabe?“ Diese Entwicklung ist besonders kritisch im Ausdauersport zu betrachten, wo das subjektive Empfinden eine zentrale Rolle spielt. Wer langfristig erfolgreich und gesund trainieren will, muss lernen, den eigenen Körper zu lesen – nicht nur Daten zu interpretieren. Eine übermäßige Abhängigkeit von KI-Systemen kann dazu führen, dass Sportler sich von ihrer Intuition entfremden.
Deshalb gilt: Die KI ist ein Werkzeug, keine Wahrheit. Die Kombination aus Datenanalyse und Selbstreflexion bleibt essenziell, um die eigene Leistungsentwicklung sinnvoll und ganzheitlich zu gestalten.
Künstliche Intelligenz im Sport -ein spannendens Feld. Lasst uns tiefer in die Thematik eintauchen!
Status Quo von Trainingsplanung und -steuerung
Bevor wir uns intensiver mit dem Potenzial und der Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) im sportlichen Kontext beschäftigen, lohnt sich zunächst ein Blick auf den Status Quo der Trainingssteuerung. Die Methoden, die heute im Leistungs- und ambitionierten Amateursport verwendet werden, haben sich über Jahrzehnte entwickelt, basieren auf sportwissenschaftlicher Forschung und Praxiserfahrung – und haben unbestreitbare Verdienste. Gleichzeitig stößt die traditionelle Trainingsplanung aber auch zunehmend an ihre Grenzen.
Die traditionelle Trainingsplanung beruht auf einem Set bewährter Prinzipien, die über Jahrzehnte durch Erfahrung, wissenschaftliche Beobachtung und die Trainingspraxis entwickelt wurden. Dabei geht es in erster Linie darum, die sportliche Leistung eines Athleten oder einer Athletin durch gezielte Reizsetzung systematisch zu steigern. Die Planung erfolgt entlang grundlegender Trainingsprinzipien wie der Periodisierung, dem Prinzip der Superkompensation, der Progression der Belastung sowie dem bewussten Wechsel von Belastung und Erholung.
Grundprinzipien traditioneller Trainingsplanung
Ein zentrales Konzept im sportlichen Training ist die Periodisierung, also die strukturierte Gliederung des Trainingsjahres in unterschiedliche Zyklen, um den Trainingsprozess systematisch und zielgerichtet zu steuern. Im klassischen Modell unterscheidet man zwischen Makrozyklen, Mesozyklen und Mikrozyklen. Der Makrozyklus umfasst meist ein ganzes Jahr und stellt den langfristigen Rahmen dar, in dem die wichtigsten Wettkampfziele festgelegt werden. Darin werden die Phasen der Vorbereitung, Wettkampf sowie Regeneration geplant. Mesozyklen sind kürzere Trainingsabschnitte von etwa vier bis sechs Wochen, in denen spezifische Trainingsschwerpunkte gesetzt werden, wie etwa der Aufbau von Ausdauer oder Kraft. Mikrozyklen bilden schließlich die kleinste Einheit mit meist einer Woche, in der die einzelnen Trainingseinheiten detailliert gestaltet und die Belastung feinjustiert wird.
Die Periodisierung verfolgt das Ziel, die Trainingsbelastung phasenweise zu steigern, anschließend aber auch wieder zu reduzieren, um Übertraining zu vermeiden und eine optimale Leistungsentwicklung zu gewährleisten. Dabei werden unterschiedliche Trainingsziele verfolgt, die sich je nach Saisonphase verändern: Zu Beginn steht häufig der Aufbau der Grundlagenausdauer im Fokus, gefolgt von der Verbesserung der anaeroben Schwelle sowie der Entwicklung der spezifischen Wettkampfhärte. Dies ermöglicht es Athleten, sich gezielt auf die Anforderungen ihrer Sportart und die Höhepunkte der Saison vorzubereiten. Es gibt verschiedene Planmodelle, die je nach Sportart, Trainingsziel und individuellen Bedürfnissen eingesetzt werden können:
1. Lineare Periodisierung
Kontinuierliche Steigerung der
Trainingsintensität
über mehrere Wochen oder Monate.
Gleichzeitig nimmt das
Trainingsvolumen
(Gesamtdauer/-umfang) schrittweise ab.
Klassisch im Leistungssport etabliert, besonders für Saisonhöhepunkte mit festem Termin geeignet.
2. Wellenförmige (undulierende) Periodisierung
Wechsel zwischen höheren und niedrigeren Intensitäten sowie Volumina in
kürzeren Zyklen
(z. B. wöchentlich oder innerhalb einer Woche).
Ziel:
bessere Anpassung
durch variierende Reize und Vermeidung von Monotonie.
Gut geeignet, um das ganze Jahr über relativ hohe Leistungsbereitschaft zu erhalten.
3. Blockperiodisierung
Fokussiert auf aufeinanderfolgende
Trainingsblöcke
, in denen spezifische Fähigkeiten wie Kraft oder Ausdauer intensiv trainiert werden.
Ermöglicht
maximale Reizsetzung
in einem Bereich, bevor der nächste Schwerpunkt folgt.
Besonders effektiv in Sportarten mit klaren Teildisziplinen (z. B. Radsport: Sprint, Zeitfahren, Bergfahren).
Abb.: unterschiedliche Modelle der Trainingsperiodisierung
In der Praxis werden diese Modelle oft kombiniert, um die Vorteile der unterschiedlichen Ansätze zu nutzen. Ein Trainer kann beispielsweise eine blockweise Schwerpunktsetzung innerhalb einer wellenförmigen Struktur planen, um gleichzeitig Spezifität und Abwechslung zu gewährleisten.
Die Modelle sind sowohl theoretisch fundiert als auch in der Praxis vielfach erprobt. Dennoch beruhen sie vor allem auf Erfahrungswerten, historischen Durchschnittswerten und standardisierten biologischen Annahmen. Deshalb ist eine individuelle Anpassung der Periodisierung an den jeweiligen Athleten, dessen Leistungsniveau, Lebensumstände und spezifische Ziele besonders wichtig. Die Periodisierung bleibt somit ein flexibles und dynamisches Instrument im modernen Trainingsprozess.
Ein weiteres zentrales Grundprinzip im Training ist die Superkompensation. Dieses Modell beschreibt die Fähigkeit des Körpers, sich nach einem Belastungsreiz nicht nur zu regenerieren, sondern über das ursprüngliche Leistungsniveau hinaus anzupassen. Durch gezielte Reize soll genau dieser Effekt hervorgerufen werden. Der Ablauf lässt sich in vier Phasen einteilen:
1. Belastung
Ein Trainingsreiz (z. B. Intervalltraining, Krafttraining) führt zunächst zu einer
temporären Leistungsminderung
, weil Energiereserven verbraucht und Strukturen belastet werden.
2. Erholung
Der Körper beginnt, beschädigte Strukturen zu reparieren, Glykogenspeicher aufzufüllen und das Gleichgewicht (Homöostase) wiederherzustellen.
3. Superkompensation
Die Anpassung geht
über das ursprüngliche Niveau hinaus
, um für künftige Belastungen besser gewappnet zu sein. In dieser Phase ist das Leistungsniveau vorübergehend
höher als zuvor
.
4. Rückkehr zum Ausgangsniveau
Wird in der Phase der Superkompensation kein neuer Trainingsreiz gesetzt, fällt die Leistung langsam wieder auf das Ausgangsniveau zurück.
Abb.: Prinzip der Superkompensation
Bei der Superkompensation ist das Timing entscheidend:
Zu früh
das nächste Training → Körper ist noch in der Erholungsphase → Gefahr von Übertraining.
Zu spät
das nächste Training → Anpassungsvorteil ist wieder verloren.
Optimal
trainieren → in der Superkompensationsphase → Leistungssteigerung über mehrere Zyklen.
In der Praxis bedeutet das: Trainingsreize sollten individuell auf Erholungszeit, Trainingsalter und Belastungsart abgestimmt werden.