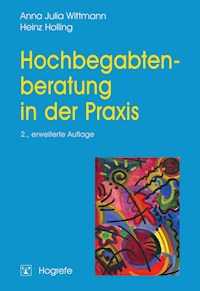28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Pädagogische Fachkräfte wie auch Angehörige weiterer Berufe haben in ihrer Tätigkeit immer wieder mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die sexuellen Missbrauch erfahren haben. Dieses Buch informiert praxisorientiert, wie pädagogische Fachkräfte und andere professionelle Bezugspersonen betroffene Kinder im Alter von drei Jahren bis ins Teenageralter in ihrem Alltag begleiten, stabilisieren und bei der Verarbeitung des Erlebten unterstützen können. Darüber hinaus werden auch präventive Maßnahmen dargestellt, die Fachkräfte ergreifen können, um Kinder zu stärken und zu schützen. Neben der Vermittlung des nötigen Grundlagenwissens werden konkrete Methoden und Vorgehensweisen beschrieben und Anregungen zur Selbstreflexion gegeben. Zahlreiche Fallbeispiele und Übungen führen Schritt für Schritt hin zu einer intensiven fachlichen Auseinandersetzung mit dem Thema und zeigen Möglichkeiten des helfenden Handelns auf. Zusätzlich online: eine Anleitung zur kollegialen Fallbesprechung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anna Julia Wittmann
Kinder mit sexuellen Missbrauchserfahrungen stabilisieren
Handlungssicherheit für den pädagogischen Alltag
Mit einer Abbildung und 3 Tabellen2., überarbeitete Auflage
Ernst Reinhardt Verlag München
Prof. Dr. Anna Julia Wittmann, Dipl.-Psych., Ausbildung in Personzentrierter Psychotherapie, hat mehrere Jahre mit Kindern, Jugendlichen und ihren Bezugspersonen in einer Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt gearbeitet und lehrt Psychologie und Beratung an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-497-03308-9 (Print)
ISBN 978-3-497-61972-6 (PDF-E-Book | barrierefrei nach PDF/UA-Standard))
ISBN 978-3-497-61973-3 (EPUB | barrierefrei nach WCAG-Standard))
2., überarbeitete Auflage
© 2025 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Verlag Ernst Reinhardt GmbH & Co KG behält sich eine Nutzung seiner Inhalte für Text- und Data-Mining i.S.v. § 44b UrhG einschließlich Einspeisung/Nutzung in KI-Systemen ausdrücklich vor.
Dieses Werk kann Hinweise/Links zu externen Websites Dritter enthalten, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Ohne konkrete Hinweise auf eine Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch entsprechende Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich entfernt.
Printed in EU
Cover unter Verwendung eines Fotos von © Dmitry Naumov –fotolia.com (Agenturfoto. Mit Models gestellt)
Satz: ew print & medien service gmbh
Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
Einleitung
Grundlagen
1Unterstützungsbedürfnisse von Kindern mit Missbrauchserfahrungen
1.1Stärkung des Selbstbewusstseins
1.2Hilfen zum Selbstverstehen und zur Selbstkontrolle
1.3Sicherheit und Orientierung in der Beziehung
2Notwendige Handlungskompetenzen pädagogischer Fachkräfte
2.1Fachkompetenzen (FK)
Basiswissen zu sexualisierter Gewalt an Kindern
Folgen von sexuellem Missbrauch und wichtige Einflussfaktoren
Abgrenzung altersangemessener Äußerungen kindlicher Sexualität von Übergriffen
Die Entstehung eines Traumas nach sexuellen Missbrauchserfahrungen
Grundlagen der Traumapädagogik
2.2Methodenkompetenzen (MK)
Sexualaufklärung
Förderung der Wahrnehmung von Gefühlen und Körperempfindungen
Förderung der sozialen Kompetenz
Psychoedukation
Hilfen zur Selbstregulation
2.3Sozial- und Selbstkompetenzen (SSK)
Leitlinien der Gesprächsführung
Stärkung der eigenen wertschätzenden und empathischen Haltung
Eigene Entlastung
Selbstreflexion
Professionelles Handeln in der Interaktion
3Voraussetzungen gelingender Tertiärprävention
Praktische Hilfen zum Umgang mit betroffenen Kindern
Modul 1: Über sexuellen Missbrauch sprechen
FK 1:Basiswissen zu sexualisierter Gewalt an Kindern
Definition
Rechtliche Regelungen
Das Ausmaß von sexuellem Missbrauch
Die Täter:innen und ihre Strategien
MK 1:Sexualaufklärung
Begriffsbestimmungen
Wichtige Erfahrungen und Botschaften für Kinder
Themen sinnvoller Sexualerziehung
Didaktisches Material
SSK 1:Leitlinien der Gesprächsführung
Ängste betroffener Kinder vor einem Gespräch
Hilfreiche Reaktionen im Gespräch
Handlungsschritte nach einem ersten Gespräch
Modul 2: Belastungsfolgen erkennen und lindern
FK 2:Folgen von sexuellem Missbrauch und wichtige Einflussfaktoren
Sonstige Lebensbedingungen des Kindes
Tatumstände
Auswirkungen in unterschiedlichen Lebensphasen
Geschlechtsunterschiede
MK 2:Förderung der Wahrnehmung von Gefühlen und Körperempfindungen
Die Bedeutung der Wahrnehmung von Gefühlen und Empfindungen
Eingehen auf Befindlichkeitsäußerungen von Kindern
Angebote zur Stärkung der Selbstwahrnehmung von Kindern
Didaktisches Material
SSK 2:Stärkung der eigenen wertschätzenden und empathischen Haltung
Grundlegende Merkmale der Haltung
Verwirklichung von Wertschätzung
Verwirklichung von Empathie
Der Blick auf die Einzigartigkeit und die Vielfältigkeit betroffener Kinder
Modul 3: Ein förderliches Miteinander gestalten
FK 3:Abgrenzung altersangemessener Äußerungen kindlicher Sexualität von Übergriffen
Verlauf der sexuellen Entwicklung von Kindern
Sexuelle Übergriffe unter Kindern und Jugendlichen
Fachlicher Umgang mit sexuellen Übergriffen
MK 3:Förderung der sozialen Kompetenz
Regeln für grenzwahrende Interaktionen in Kinder- und Jugendgruppen
Die Förderung des Setzens und Achtens von Grenzen
Didaktisches Material
Weitere Unterstützung zur Prävention von digitaler sexualisierter Gewalt
SSK 3:Eigene Entlastung
Selbstfürsorge
Kollegiale Fallbesprechung
Kooperation und Vernetzung
Modul 4: Traumata erkennen und verstehen
FK 4:Die Entstehung eines Traumas nach sexuellen Missbrauchserfahrungen
Begriffsklärungen
Psychobiologische Prozesse während traumatischer Ereignisse
Die traumatische Reaktion
Mögliche Langzeitfolgen traumatischer Erlebnisse bei Kindern
Schlussfolgerungen für den pädagogischen Umgang mit traumatisierten Kindern
MK 4:Psychoedukation
Unterstützung von Selbstverstehen und Selbstakzeptanz traumatisierter Kinder
Erarbeitung eines traumaspezifischen Symptomverstehens mit Bezugspersonen
Beispiele psychoedukativer Erläuterungen für Kinder
SSK 4:Selbstreflexion
Definition und Ziele von Selbstreflexion
Überprüfung der Übereinstimmung von explizit und implizit vermittelten Botschaften
Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen und dem Thema „Sexualität“
Umgang mit dem eigenen Schrecken und mit eigenen Grenzen
Reflexion kritischer Interaktionssituationen
Modul 5: Mit Trauma-Symptomen umgehen
FK 5:Grundlagen der Traumapädagogik
Entstehung und Bezüge der Traumapädagogik
Herstellen von Sicherheit
Förderung der Bindungs- und Beziehungsfähigkeit
Ressourcenorientierung
MK 5:Hilfen zur Selbstregulation
Begriffsbestimmung und Voraussetzungen
Reduzieren der hohen Erregung
Vermeiden von Flashbacks
Stoppen von Dissoziationen
SSK 5:Professionelles Handeln in der Interaktion
Allgemeine Hinweise zur Vermittlung korrigierender Erfahrungen
Stärkung des Selbstwertgefühls
Ermöglichen von Partizipation
Überwinden destruktiver Interaktionsmuster
Anhang: Ergänzende Informationen zur empirischen Fundierung des Buches
Literatur
Sachregister
Hinweise zur Verwendung der Icons
Online-Zusatzmaterial
Online-Zusatzmaterial Die „Anleitung zur kollegialen Fallbesprechung“ können Leser:innen dieses Praxisbuchs auf der Homepage des Ernst Reinhardt Verlags unter http://www.reinhardt-verlag.de herunterladen. Die Anleitung ist so gestaltet, dass sie als Broschüre (doppelseitig) gedruckt und dann so geknickt werden kann, dass man ein vierseitiges Heft erhält. Wir empfehlen den Ausdruck auf A3-Papier.
Einleitung
Bedeutsamkeit des Themas
Seit dem Missbrauchsskandal im Jahr 2010, als zahlreiche Betroffene über die von ihnen in ihrer Kindheit und Jugend erlebte sexualisierte Gewalt berichteten, hat das Thema „sexueller Missbrauch“ die Aufmerksamkeit der Medien und der Öffentlichkeit geweckt (Bergmann 2024). Von der Politik wurde das Thema damals aufgegriffen und anerkannt, dass es sich um ein weitaus größeres Problem handelt, als lange angenommen. Kinder, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, benötigen fachgerechte Hilfe, um ihre belastenden oder gar traumatischen Erfahrungen bewältigen zu können. Diese Hilfe wird Tertiärprävention oder Intervention genannt. Primärprävention indessen bezeichnet den Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt und Sekundärprävention die (möglichst frühe) Aufdeckung von sexuellem Missbrauch (Amann, 2023).
notwendige Qualifizierung
Damit pädagogische Fachkräfte auf allen drei Ebenen der Prävention tätig werden können, müssen sie dafür geschult sein. Deshalb mahnt die Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs in Interviews immer wieder eine entsprechende Qualifizierung an. Lehrer:innen und pädagogische Fachkräfte wie auch andere Berufsgruppen bräuchten „Handwerkszeug im Erkennen sexualisierter Gewalt und bei der Frage: Was tue ich dann?“, was in Aus- und Weiterbildung vermittelt werden müsse (von Bebenburg 2022). Befragt von der Vorsitzenden der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs formulierte Kerstin Claus diese Forderung noch deutlicher:
„Guter und professioneller Kinderschutz braucht sehr gut qualifizierte Fachkräfte […]. Wissen zum Kinderschutz und die Vermittlung von Handlungskompetenz bei Kinderschutzfällen, insbesondere bei sexueller Gewalt, muss deswegen Pflichtbestandteil aller für den Kinderschutz relevanten Studiengänge und Ausbildungen werden. Dazu gehört das Studium der Sozialen Arbeit, dazu gehören aber auch die juristischen, medizinischen und pädagogischen Studiengänge" (Gebrande/Claus 2024, 97).
Zielgruppen des Buches
Mit dem vorliegenden Buch soll zu dieser Qualifizierung beigetragen werden. Es wendet sich in erster Linie an alle (in Ausbildung und bereits in der Praxis tätigen) Fachkräfte, die im pädagogischen Kontext mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Sie erhalten durch das Buch die Möglichkeit, sich intensiver mit dem Thema des sexuellen Missbrauchs sowie mit Möglichkeiten der Unterstützung betroffener Kinder und Jugendlicher auseinanderzusetzen. Auch (zukünftige) therapeutische Fachkräfte, Lehrer:innen und Ehrenamtliche, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, werden hier Anregungen finden, die sie auf ihren Arbeitskontext übertragen können.
Analyse des Qualifizierungsbedarfs
Wie pädagogische Fachkräfte für den Umgang mit Kindern, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, so qualifiziert werden können, dass sie zu hilfreichen Unterstützungspersonen werden, war Gegenstand einer Bedarfsanalyse, die innerhalb des Forschungsprojekts KiMsta (Kinder mit Missbrauchserfahrungen stabilisieren) an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Hildesheim durchgeführt wurde. Der Qualifizierungsbedarf wurde durch zwei aufeinander aufbauende Studien ermittelt:
1.Zunächst wurden 18 Interviews u. a. zu Unterstützungsbedürfnissen der Kinder und notwendigen Handlungskompetenzen der Fachkräfte durchgeführt. Interviewpartner:innen waren Expert:innen des Kinderschutzes in Deutschland, die in Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt, in Kinderschutz-Zentren, als Psychotherapeut:innen mit traumatherapeutischem Schwerpunkt und als hauptberufliche Referent:innen im Bereich der Traumapädagogik arbeiten (ausführliche Darstellung von Methodik und Ergebnissen: Gebrande 2014).
2.Anschließend erfolgte eine schriftliche Befragung von über 700 pädagogischen Fachkräften (insbesondere Erzieher:innen und Sozialpädagog:innen), die in der Stadt und im Landkreis Hildesheim in Kindertagesstätten (Gebrande 2014) sowie in (teil-)stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen (Wittmann 2014a) tätig waren. Das Ziel der schriftlichen Befragung bestand darin, ein Bild bereits vorhandener und noch fehlender Handlungskompetenzen pädagogischer Fachkräfte zu gewinnen.
forschungsgestütztes Konzept
Auf Basis dieser Informationen wurden an der HAWK in Hildesheim eine Weiterbildung sowie eine Studienvertiefung zur Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention von sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen entwickelt (Wittmann 2015, 2017, 2022a, 2022b). In das Lehrkonzept flossen außerdem die Erkenntnisse einer dritten Studie ein, die sich noch einmal gesondert mit der Didaktik der Lehrinhalte beschäftigte (Wittmann 2016, 2017). Die Programme wurden in den Folgejahren anhand von Evaluationsergebnissen inhaltlich ergänzt und angepasst. Da die Ergebnisse des Forschungsprojekts und der Anwendung des Qualifizierungskonzepts an der Hochschule Grundlage dieses Buches sind, sei an dieser Stelle allen gedankt, die daran mitgewirkt haben, u. a. Julia Gebrande für ihre engagierte Arbeit im Forschungsprojekt sowie den interviewten Fachkräften des Kinderschutzes, die ihre Expertise zur Verfügung gestellt haben. Wertvolle Beiträge lieferten außerdem die Proband:innen der schriftlichen Befragung und die Studierenden, weil sie dafür Sorge getragen haben, dass Praxishilfen geschaffen und weiterentwickelt werden konnten, die auf den bestehenden Bedarf zugeschnitten sind. Für ihre hilfreichen Anregungen zum Manuskript danke ich besonders Rosa Berger-Keller, Svenja Hessing, Finn Werner, Eva Nau, Conny Leinemann und Ruth Swienty. Mein Dank richtet sich außerdem an alle Kolleg:innen und Menschen meines Umfelds, die das Projekt in sonstiger Form unterstützt haben.
Aufbau des Buches
Das Buch gliedert sich in einen knappen Grundlagen- und einen umfassenden Praxisteil. Innerhalb der Grundlagen wird anhand zentraler Studienergebnisse aus den Interviews und der Befragung dargestellt, worin der Qualifizierungsbedarf pädagogischer Fachkräfte inhaltlich besteht. Der Hauptteil des Buches vermittelt die relevanten Kompetenzen in Form von praxisorientierten Hilfestellungen. Dazu werden die elementaren Herausforderungen zur Unterstützung von Kindern mit sexuellen Missbrauchserfahrungen im pädagogischen Alltag beschrieben und konkrete Wege dazu aufgezeigt, um pädagogische Fachkräfte in ihrer Handlungssicherheit zu stärken.
Abkürzungen: FK, MK, SSK
Die in diesem Buch betrachteten Handlungskompetenzen werden in Fach-, Methoden- sowie Sozial- und Selbstkompetenzen unterteilt. Die dafür verwendeten Abkürzungen FK, MK und SSK dienen der Kennzeichnung der jeweils drei Unterkapitel (im Folgenden Lerneinheiten genannt), aus denen die fünf Oberkapitel (im Folgenden Module genannt) im Praxisteil des Buches bestehen. Da es nicht möglich ist, die Kompetenzbereiche komplett voneinander zu trennen, gibt es Überlappungen. Die vorgenommene Einteilung ist so zu verstehen, dass in den Unterkapiteln jeweils schwerpunktmäßig Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen vermittelt, die anderen Kompetenzbereiche aber immer auch mit berührt werden.
Wortwahl
Dem inhaltlichen Einstieg auf den nächsten Seiten sei eine Anmerkung zur Wortwahl vorangestellt. Neben dem Begriff „sexueller Missbrauch“ gibt es auch andere Bezeichnungen zur Beschreibung des gleichen Sachverhalts, z. B. sexualisierte oder sexuelle Gewalt an Kindern, sexuelle Ausbeutung von Kindern oder sexuelle Misshandlung von Kindern. Die unterschiedlichen Formulierungen heben unterschiedliche Aspekte hervor. Die Begriffe „sexuelle Gewalt“ oder „sexualisierte Gewalt“ werden häufiger in Wissenschaft und Fachpraxis verwendet und beschreiben nicht allein den sexuellen Kindesmissbrauch, sondern ebenso nicht einvernehmliche sexuelle Kontakte zwischen Erwachsenen (Gahleitner/Gebrande 2024; UBSKM 2024a). Sie verdeutlichen die Schwere der Taten und stellen heraus, dass die Ausübung der Gewalt mit sexuellen Mitteln geschieht. Hierbei wird jedoch weniger deutlich, dass es sich auch dann um sexualisierte Gewalt handeln kann, wenn keine körperliche Gewalt zum Einsatz kommt (UBSKM 2024a). An dem Ausdruck „sexueller Missbrauch“ wird kritisiert, dass er impliziert, es gebe auch einen gerechtfertigten „sexuellen Gebrauch“ von Kindern, was jedoch niemals der Fall ist. Auf der anderen Seite löst das Wort „Missbrauch“ Assoziationen von Macht- und Vertrauensmissbrauch aus, die zutreffend sind, weil sie zentrale Aspekte sexueller Übergriffe an Kindern darstellen (Amann 2023; Gahleitner/Gebrande 2024). In deutschen Versionen offizieller Dokumente wie der Kinderrechtskonvention und auch bei der Benennung der „Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs“ hat sich der Begriff „sexueller Missbrauch“ durchgesetzt (Schlicher 2020). Da er auch im allgemeinen Sprachgebrauch am weitesten verbreitet ist und außerdem Eingang ins Strafgesetzbuch gefunden hat, wird er in diesem Buch im Wechsel mit den Begriffen „sexualisierte Gewalt" und „sexuelle Gewalt" verwendet.
Grundlagen
Wie einleitend dargestellt, dient das vorliegende Arbeitsbuch u. a. der Sensibilisierung pädagogischer Fachkräfte für den Hilfebedarf von Kindern mit sexuellen Missbrauchserfahrungen. Kapitel 1 stellt die erfassten Unterstützungsbedürfnisse im Überblick dar. Im zweiten Kapitel werden die Kompetenzen aufgeführt, die Fachkräfte benötigen, um adäquat darauf eingehen zu können. Die Inhalte der beiden Kapitel basieren, soweit keine anderen Quellen genannt werden, auf den Befunden der KiMsta-Studien (→ Einleitung und Anhang).
1Unterstützungsbedürfnisse von Kindern mit Missbrauchserfahrungen
Unterstützungsbereiche
Kinder mit sexuellen Missbrauchserfahrungen bedürfen im pädagogischen Alltag in drei Bereichen besonderer Unterstützung (Wittmann 2014a, 2015, 2017):
1.Stärkung des Selbstbewusstseins,
2.Hilfen zum Selbstverstehen und zur Selbstkontrolle,
3.Sicherheit und Orientierung in der Beziehung.
1.1Stärkung des Selbstbewusstseins
Überschneidung von Primär- und Tertiärprävention
Kinder benötigen nach sexuellem Missbrauch Unterstützung, um achtsam mit sich selbst umzugehen, Vertrauen in die eigenen Kompetenzen zu gewinnen und sich eigener Empfindungen, Gefühle und Bedürfnisse bewusst zu werden. Die Stärkung dieser Fähigkeiten ist auch Ziel der Primärprävention (z. B. Blattmann/Mebes 2024; Braun/Keller 2023; Strohhalm e.V. 2020). Während es dort jedoch um den Schutz von Kindern vor bislang nicht erlebter sexualisierter Gewalt geht, hat die Tertiärprävention die Stabilisierung von Kindern, die bereits sexuell missbraucht wurden, sowie die Verhinderung von Reviktimisierungen, d. h. erneuten Gewalterfahrungen, zum Ziel. Dazu tragen Sexualaufklärung, die Förderung der Wahrnehmung von Körperempfindungen und Gefühlen sowie der Aufbau sozialer Kompetenzen bei.
1.2Hilfen zum Selbstverstehen und zur Selbstkontrolle
Selbstakzeptanz und Selbstregulation
Kinder haben nach sexuellem Missbrauch häufig das Bedürfnis, sich selbst in den eigenen Reaktionen auf den Missbrauch zu verstehen, um sich damit auch akzeptieren zu können. Zu ihren Reaktionen können beispielsweise Flashbacks gehören, bei denen es sich um unwillkürlich auftretende Erinnerungen bzw. Erinnerungsfragmente mit starken emotionalen und körperlichen Begleitsymptomen wie Panik und Zittern handelt (Scherwath / Friedrich 2020; → FK 4). Hilfreich für Kinder sind altersentsprechende Erklärungen, wie es zu solchen Folgeerscheinungen sexueller Gewalterfahrungen kommen kann. Außerdem müssen die Kinder darin unterstützt werden, mit den Auswirkungen des Missbrauchs, wie Flashbacks, Ängsten oder Wut, umzugehen und selbst- oder fremdschädigendes Verhalten durch Verhalten mit weniger schädlichen Nebenwirkungen zu ersetzen. Geeignete Hilfen zur Selbstregulation und damit zur Selbstkontrolle wurden z. B. in der Traumapädagogik entwickelt (→ Grundlagen, Kap. 2.1).
1.3Sicherheit und Orientierung in der Beziehung
korrigierende Beziehungserfahrungen
Sexueller Missbrauch führt häufig zu einem Verlust an Vertrauen in sich und andere Menschen. Die Erfahrung von Sicherheit und Orientierung ist für betroffene Kinder deshalb besonders wichtig. Ihnen muss Wertschätzung und Empathie entgegengebracht und ein geschützter Raum zum Erzählen geboten werden. Es ist von großer Bedeutung, dass sie in ihrer Individualität und mit ihren Stärken gesehen werden und positive Vorbilder erleben. Außerdem profitieren die Kinder von der Erfahrung, an der Gestaltung des Zusammenlebens partizipieren zu dürfen. Entscheidend ist für sie zu erleben, dass abweisendes Verhalten ihrerseits von ihren Bezugspersonen nicht ebenfalls mit Abweisung beantwortet wird. Im Kern geht es darum, dass die Kinder korrigierende Beziehungserfahrungen machen können.
2Notwendige Handlungskompetenzen pädagogischer Fachkräfte
Kompetenzbereiche
Die Handlungskompetenzen, über die pädagogische Fachkräfte verfügen müssen, um den in Kapitel 1 skizzierten Unterstützungsbedarf von Kindern mit Missbrauchserfahrungen beantworten zu können, werden im Folgenden beschrieben und den Bereichen Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen (FK, MK, SSK) zugeordnet (ausführliche Darstellung: Gebrande 2014; Gebrande / Wittmann 2013; Wittmann, 2015, 2017). Zur Illustration einzelner Kompetenzen werden in diesem Kapitel Auszüge aus den Expert:innen-Interviews sowie ergänzend ausgewählte Ergebnisse der schriftlichen Befragung des KiMsta-Projekts (→ Einleitung und Anhang) zitiert.
2.1Fachkompetenzen (FK)
Relevanz von Fachwissen
Fachkompetenzen sind auf allen Ebenen der Prävention von sexuellem Missbrauch wichtig, weil sie zum einen die Voraussetzung dafür darstellen, adäquate Schutzmaßnahmen zu entwickeln und zu ergreifen und zum anderen notwendig sind, um betroffene Kinder in ihrem Erleben und Verhalten zu verstehen. Reaktionen von Kindern, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, nachvollziehen zu können, reduziert die Unsicherheit im Umgang mit ihnen und erleichtert einen wertschätzenden Kontakt.
Basiswissen zu sexualisierter Gewalt an Kindern
Dynamik des Missbrauchs
Grundlegendes Wissen über sexualisierte Gewalt an Kindern umfasst die Definition und das Ausmaß von sexuellem Missbrauch, die Strategien von Täter:innen sowie die Dynamik des Missbrauchsgeschehens. Pädagogische Fachkräfte sollten ein Verständnis für die Situation betroffener Kinder entwickeln, die häufig von Ohnmacht, Angst, Geheimhaltungsdruck, Schuld- und Schamgefühlen, aber auch von Ambivalenzen den Täter:innen gegenüber geprägt ist. Das Grundlagenwissen beinhaltet außerdem Kenntnisse der relevanten Regelungen des Strafrechts.
Vorwissen
Im KiMsta-Projekt wurde deutlich, dass pädagogischen Fachkräften einige grundlegende Aspekte, die sexuellen Missbrauch betreffen, bekannt sind. Ihr Wissen bezogen viele jedoch offenbar stärker über die Medien als über Ausbildung, Fortbildung oder Fachliteratur. So konnte die Mehrheit der pädagogischen Fachkräfte anhand von Beschreibungen kritischer Situationen sexuellen Missbrauch adäquat als solchen einschätzen und zeigte in den meisten der beschriebenen Situationen weder eine Tendenz zur Bagatellisierung noch Dramatisierung. Ihnen war außerdem bekannt, dass sexueller Missbrauch häufig vorkommt, dass es sowohl männliche als auch weibliche Täter:innen gibt und es sich bei den Täter:innen zumeist um Menschen handelt, die mit dem Kind bekannt oder verwandt sind (Gebrande 2014).
Kluft zwischen Theorie und Praxis
Dass trotz der vorhandenen Vorkenntnisse eine tiefere fachliche Auseinandersetzung mit dem Thema dringend notwendig ist, zeigten weitere Befunde. So hatte sich ungefähr die Hälfte aller pädagogischen Fachkräfte laut eigenen Angaben bislang noch gar nicht oder nur in geringem Umfang fachlich mit dem Thema der sexualisierten Gewalt an Kindern beschäftigt. Während der größte Teil der Befragten (84 %) in den Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen wusste, dass es in der eigenen Institution schon mindestens einmal ein Kind gab, das von sexuellem Missbrauch betroffen war, belief sich der Anteil bei den Befragten aus den Kindertagesstätten auf lediglich 20 %. Tatsächlich ist der Anteil missbrauchter Kinder in stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, in denen misshandelte und missbrauchte Kinder im Vergleich zur Gesamtbevölkerung überrepräsentiert sind (Andreae de Hair et al. 2022), höher als in Kindertagesstätten. Die derart geringe Anzahl wahrgenommener Fälle in den zuletzt genannten Einrichtungen erstaunte jedoch, da deren Mitarbeiter:innen im Durchschnitt 16 Jahre Berufserfahrung hatten und das Ausmaß von sexuellem Missbrauch bei Kindern in der Bevölkerung insgesamt – im Vergleich mit repräsentativen Studien (→FK 1: Das Ausmaß von sexuellem Missbrauch) – sogar eher überschätzt wurde. So nahmen die im Rahmen des KiMsta-Projekts Befragten im Schnitt an, dass mehr als 27 % aller Mädchen und mehr als 20 % aller Jungen von sexuellem Missbrauch betroffen seien. Trotz der eigenen Überzeugung, dass eine ganz erhebliche Zahl an Kindern sexuell missbraucht wird, besteht in der Praxis also offenbar die Schwierigkeit, die Betroffenheit von Kindern im eigenen Umfeld zu bemerken bzw. betroffenen Kindern die Möglichkeit zu eröffnen, sich zu erkennen zu geben. Eine zusätzliche Schwierigkeit stellt dar, dass sexualisierte Gewalt mittlerweile zunehmend in mediatisierter Form stattfindet (UBSKM 2023), weshalb es für eine ausreichende Sensibilisierung notwendig ist, Fachkräfte nicht nur bezüglich „traditioneller“ Formen sexuellen Missbrauchs, sondern auch hinsichtlich digitaler Risiken sexualisierter Gewalt weiterzubilden.
Folgen von sexuellem Missbrauch und wichtige Einflussfaktoren
häufige Auswirkungen kennen und verstehen
Pädagogische Fachkräfte sollten typische Auswirkungen von sexuellem Missbrauch kennen, die geschlechtsspezifische Folgen einschließen. Sie können dann Symptome, die sie an Kindern beobachten, besser verstehen und im pädagogischen Alltag auf hilfreichere Weise damit umgehen.
„Was heißt überhaupt sexualisierte Gewalt gegen Kinder und welche möglichen Folgen gibt es? […] Das Ziel ist es, ein Verständnis dafür zu bekommen, dass bestimmte Verhaltensweisen wie selbstverletzendes Verhalten von Kindern und Jugendlichen oder bestimmte Formen von sonstigen Verhaltensauffälligkeiten in diesem Kontext gesehen werden können. Und wenn es besser eingeordnet werden kann, dann kann auch wertschätzender damit umgegangen werden“ (Expertin aus einer Fachberatungsstelle).
Einflussfaktoren
In seinen Auswirkungen ist sexualisierte Gewalt an Kindern nicht nur durch die Tatumstände des Missbrauchs beeinflusst, sondern auch dadurch, unter welchen sonstigen Lebensbedingungen die Kinder aufwachsen. Neben sexuellem Missbrauch sind sie manchmal gleichzeitig von weiteren Formen der Kindeswohlgefährdung betroffen (Amann 2023). Durch die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Arten von Kindesmisshandlung und anderen potenziellen Risikofaktoren der Entwicklung wird der größere Rahmen deutlich, in den sich sexueller Missbrauch einordnen lässt.
Abgrenzung altersangemessener Äußerungen kindlicher Sexualität von Übergriffen
sexuelle Entwicklung
Um alterstypisches und abweichendes sexuelles Verhalten von Kindern unterscheiden zu können, ist es sinnvoll, dass pädagogische Fachkräfte Wissen über die sexuelle Entwicklung von Kindern erwerben. Ihnen sollte bekannt sein, wie sich kindliche Sexualität in verschiedenen Altersstufen äußert, bei welchen Verhaltensweisen es sich um zur Entwicklung gehörende Doktor- oder Körpererkundungsspiele handelt und wo sexuelle Übergriffe von Kindern und Jugendlichen an anderen Kindern und Jugendlichen anfangen. Außerdem sollten pädagogische Fachkräfte in der Lage sein, fachlich mit sexuellen Übergriffen umzugehen, was für sie oftmals jedoch sehr schwer ist.
„Also die größte Unsicherheit ist definitiv eigentlich immer die, die auftaucht, wenn Grenzüberschreitungen stattfinden in Kindertagesstätten und die finden natürlich auch von Jungs mit Missbrauchserfahrung in Reinszenierungen statt. Erst Opfer, dann Täter. […] Da stellen sich folgende Fragen: Wie gehen wir damit um? Wie weit können wir das zulassen? Wo müssen wir intervenieren? […] Wie kann ich klare Grenzen setzen? Wie kann ich verhindern, dass ich das übergriffige Kind durch meine Intervention beispielsweise erneut traumatisiere oder verletze? Oder dass ich nicht betroffene Kinder dadurch verunsichere, dass ich sehr rigide Grenzen setze und dann die Frage nach der Sexualität offen bleibt, zu der Kinder doch ein Recht haben?“ (Experte aus einer Fachberatungsstelle).
Die Entstehung eines Traumas nach sexuellen Missbrauchserfahrungen
Symptome eines Traumas kennen und verstehen
Amann (2023) konstatiert, dass Kinder in vielfältiger Hinsicht in ihrer Entwicklung beeinträchtigt sein können, den größten zerstörerischen Effekt jedoch Traumata ausüben. Pädagogische Fachkräfte müssen sich in Grundzügen damit auseinandersetzen, was ein Trauma ist und unter welchen Umständen sexueller Missbrauch zu einem Trauma führt. Trauma-Symptome sind pädagogischen Fachkräften oftmals noch fremder als Symptome, die Kinder zeigen, wenn der sexuelle Missbrauch für sie „nur“ ein belastendes Lebensereignis war und deshalb nicht mit den hirnphysiologischen Veränderungen einhergeht, die ein Trauma charakterisieren (→ FK 4).
„Wenn ich keine Traumakenntnisse habe, dann bewerte ich das Verhalten eines Kindes natürlich ganz anders. Das geht dann oft in die Richtung: ‚Ja, die will mich provozieren‘ oder ‚Das weiß sie ganz genau, dass sie es nicht soll und macht es trotzdem‘. Das Kind wird als ein Feind wahrgenommen. Ich merke dann immer, wenn ich erklären kann: ‚Das macht sie aus den und den Gründen. Das ist ihre Vorerfahrung. Damals hat sie keine Kontrolle gehabt, daher versucht sie jetzt, Kontrolle zu bekommen und dominant zu sein. Aus diesem Grund setzt sie sich jetzt über alle Grenzen hinweg. Oder: Sie hat dissoziieren gelernt und deswegen wirkt sie so abwesend, sie träumt nicht. […]‘ Wenn man das erklären kann, warum bestimmte Phänomene im Alltag auftauchen, dann merke ich ein großes Aha-Erlebnis. Dann wird im Alltag vieles auch anders bewertet und mit einer größeren Gelassenheit damit umgegangen“ (Expertin aus einer Fachberatungsstelle).
Dissoziation als Trauma-Symptom
Bei dem im Zitat angesprochenen Trauma-Symptom des Dissoziierens handelt es sich um ein Abtrennen von Wahrnehmungs- und Gedächtnisinhalten, die üblicherweise miteinander verbunden (assoziiert) sind (Spitzer/Freyberger 2019). Ausführliche Erläuterungen zu Dissoziationen wie auch zu allen anderen Fachbegriffen, die im Grundlagen-Teil des Buches genannt werden, finden sich im Praxisteil (→ Praktische Hilfen zum Umgang mit betroffenen Kindern).
Grundlagen der Traumapädagogik
Traumasensibilität erwerben
Traumasensibilität zu schaffen und in alle Bereiche des (öffentlichen) Lebens zu integrieren, ist die erklärte Absicht des traumainformierten Ansatzes (vom Hoff 2023). Auch das KiMsta-Projekt zeigte, wie wichtig es ist, dass pädagogische Fachkräfte Traumata nicht nur erkennen können, sondern außerdem sensibel für den Unterstützungsbedarf traumatisierter Kinder und Jugendlicher sind und darauf achten, Retraumatisierungen zu vermeiden. Um dies leisten zu können, sollten sie sich mit den Grundlagen der Traumapädagogik beschäftigen. Ein wichtiges Ziel traumapädagogischer Arbeit ist das Herstellen von Sicherheit, z. B. durch das Gewähren von klaren Strukturen in den Einrichtungen. Ereignisse in ihrem Eintreten nicht länger als willkürlich zu erleben, ist eine Voraussetzung, um sexualisierte Gewalterfahrungen bewältigen zu können, da betroffene Kinder oft die Erfahrung gemacht haben, übergriffigen Situationen ohnmächtig ausgeliefert gewesen zu sein.
„Es geht um so einfache Sachen, dass Dienstpläne draußen an der Wand hängen und nicht im Bürozimmer, dass die Kinder wissen, wann die Kolleginnen, Kollegen kommen und dass Regeln erklärt werden – dass möglichst alles transparent ist, was transparent zu machen ist, weil es die Sicherheit erhöht“ (Expertin aus dem Bereich der Traumapädagogik).
Rituale
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch ein sich in bestimmten Aspekten stets wiederholender Tagesablauf. Dabei bieten Rituale Kindern die Möglichkeit, Verlässlichkeit zu erfahren. Sie helfen, Schwellensituationen, die mit Angst verbunden sind, besser zu bewältigen. In Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen kann es z. B. Rituale geben, die mit dem abendlichen Schlafengehen oder dem morgendlichen Wecken verbunden sind. Wenn die Kinder am Wochenende nach Hause fahren, spielen Begrüßungs- und Abschiedsrituale eine wichtige Rolle. Auch in Kindertagesstätten sind für Kinder mit großem Sicherheitsbedürfnis klare Regeln und Strukturen hilfreich. In diesem Zusammenhang wird gelegentlich die Entwicklung der Kindertagesbetreuung hin zu offenen Formen kritisiert, da diese zwar Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der Kinder fördern, aber manchen Kindern zu wenig Sicherheit bieten.
Sicherheit in der Beziehung
Ein weiterer traumapädagogischer Grundsatz, der ebenfalls zum Erleben von Sicherheit beiträgt, stellt die Förderung von Bindungs- und Beziehungsfähigkeit dar. Kinder mit Missbrauchserfahrungen benötigen ein hohes Maß an Sicherheit im Kontakt mit ihren Bezugspersonen (Weiß 2024). Den pädagogischen Fachkräften muss bewusst sein, wie wichtig ihre Verlässlichkeit und die Kontinuität der Beziehungen sind, die sie mit betroffenen Kindern eingehen. Deshalb sollten z. B. Anerkennungspraktikant:innen nicht zu Bezugsbetreuer:innen von Kindern werden, was in der Praxis jedoch häufig der Fall ist.
Würdigung
Einen zentralen Aspekt der traumapädagogischen Grundhaltung stellt außerdem die Würdigung der Sinnhaftigkeit der kindlichen Reaktionen auf die Missbrauchserfahrungen dar (vom Hoff 2023).
„Ich glaube, das Wesentlichste ist zu vermitteln, dass Störungen, Verhaltensauffälligkeiten, Symptome […], dass man das schätzen lernt als Überlebensstrategie und es entsprechend nicht pathologisiert, sondern damit arbeitet und die Kinder bestärkt, damit sie unter Umständen andere, weniger destruktive Strategien entwickeln können, aber ernst nimmt, dass es wichtig war, diese Strategien zu entwickeln“ (Expertin aus einer Fachberatungsstelle).
Ressourcenorientierung
Ein solcher Blick auf das Erleben und Verhalten betroffener Kinder ist Teil einer ressourcenorientierten Haltung, die pädagogische Fachkräfte ausbilden sollten, damit sie die Kinder nicht nur in ihrem Leid, sondern auch in ihren Stärken sehen. Zur Ressourcenorientierung gehört die Suche nach und das gezielte Herstellen von Möglichkeiten, Freude, Genuss und die eigene Kraft zu erleben.
„[…] und sie wollen mit Sicherheit nicht reduziert werden darauf, dass sie missbrauchte Mädchen, missbrauchte Jungen sind, sondern sie wollen natürlich schon von allen, ob das die Eltern, Therapeutinnen oder auch die Lehrerin oder Erzieherin ist, dass sie nach wie vor in dem gesehen werden, was sie gut können“ (Expertin aus einer Fachberatungsstelle).
2.2Methodenkompetenzen (MK)
Relevanz methodischen Wissens
Durch den Einsatz spezifischer Methoden können pädagogische Fachkräfte dazu beitragen, dass sich Kinder mit Missbrauchserfahrungen stabilisieren und bei ihnen günstige Verarbeitungsstrategien aktiviert werden. Von Bedeutung sind dabei zum einen Methoden, die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein stärken, z. B. Sexualaufklärung oder Förderung der sozialen Kompetenz, und zum anderen Methoden, die zur Verbesserung des Selbstverstehens und der Selbstkontrolle beitragen, z. B. Psychoedukation und Hilfen zur Selbstregulation.
Sexualaufklärung
wichtige Botschaften und Informationen
Neuere Ansätze zur primären Präventionsarbeit, die sich gegen sexuellen Missbrauch richtet und mit Kindern als potenziellen Opfern durchgeführt wird, beziehen Sexualaufklärung und -erziehung mit ein (Amann 2023; Schlicher 2020). Auch in der Tertiärprävention, also in der Arbeit mit Kindern, die bereits sexuellen Missbrauch erlebt haben, sind Sexualaufklärung und -erziehung aus mehreren Gründen wichtig. Erstens können die Kinder darüber einen positiven Zugang zu Sexualität finden. Zweitens hilft es ihnen beim Einordnen der eigenen Erfahrungen, wenn sie in diesem Rahmen auch Informationen über sexuellen Missbrauch erhalten. Drittens werden durch Sexualaufklärung korrekte Begrifflichkeiten für sexuelle Handlungen und die Genitalien vermittelt, die Kinder benötigen, um über das, was ihnen widerfahren ist, sprechen zu können. Sexualaufklärung und -erziehung lassen sich durch den Einsatz diverser didaktischer Materialien gut unterstützen.
sexualpädagogische Konzepte
Neben der individuellen Kenntnis sexualpädagogischer Arbeitsweisen ist es außerdem von großer Bedeutung, dass die Einrichtung über ein sexualpädagogisches Konzept verfügt. Dieses Konzept sollte thematisieren, wie Kinder vor sexualisierter Gewalt geschützt werden, wie mit Sexualität und Körpererkundungsspielen, aber auch mit sexuellen Übergriffen von Kindern an Kindern und mit sexualisierter Gewalt, die Kindern und Jugendlichen durch ältere Personen widerfahren ist, umgegangen wird. Nach den Bestimmungen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes ist die Betriebserlaubnis von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe u. a. von einem Konzept zum Schutz vor Gewalt abhängig (Thürnau 2023; →FK 1: Rechtliche Regelungen). Sexualpädagogische Konzepte stellen einen Bestandteil davon dar (UBSKM 2024b).
Förderung der Wahrnehmung von Gefühlen und Körperempfindungen
besondere Schwierigkeit für Jungen
Professionelle Bezugspersonen müssen Kindern mit Missbrauchserfahrungen helfen, ihre Opfererfahrung anzuerkennen und den damit verbundenen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, damit sie das Erlebte verarbeiten können. Da in unserer Gesellschaft teilweise nach wie vor ein Männerbild existiert, das im Widerspruch zu Gefühlen von Traurigkeit, Schmerz und Ohnmacht steht, fällt es manchen Jungen, die sexuell missbraucht wurden, besonders schwer, ihre Gefühle zu äußern. Ihnen muss verdeutlicht werden, dass alle Gefühle gestattet sind.
„[…] sie [die Jungen] brauchen Informationen, die Message […]: ‚Du darfst als Junge auch weinen […]! Da sind Sachen passiert, die man gar nicht aushalten kann. […]'. Wer so eine Message bekommt, kann es sich auch erlauben, Gefühle zu zeigen" (Experte aus einer Fachberatungsstelle).
Funktion von Gefühlen
Da „Emotionen […] die Prüfsteine menschlicher Erfahrung [sind]“ (Gerrig 2018, 436), ist die Fähigkeit, eigene Emotionen wahrzunehmen, von großer Bedeutung. Sie helfen, Handlungen anderer, die die eigenen Grenzen überschreiten, als solche identifizieren zu können. Nur, wer Grenzüberschreitungen bemerkt, kann sich auch dagegen zur Wehr setzen.
auf Gefühle eingehen
Kinder, die sexuell missbraucht wurden, haben häufig die Erfahrung gemacht, dass über ihre Gefühle hinweggegangen wurde oder dass sie bezüglich ihrer Gefühle verwirrt wurden. Hilfen in der Sensibilisierung für eigene Gefühle und im Umgang damit können darin bestehen, dass Fachkräfte einfühlsam darauf eingehen, was ein Kind von sich zeigt, indem sie seine emotionalen Erlebnisinhalte verbalisieren. Auch Gefühle wie Wut sind zu würdigen, müssen jedoch so reguliert werden, dass sie keinen selbst- oder fremdverletzenden Ausdruck finden. Zur Reduzierung von Schuld- und Schamgefühlen ist es wichtig, dass sich pädagogische Fachkräfte klar zur Frage der Verantwortung für den sexuellen Missbrauch positionieren.
„[…] was schon mal einen riesengroßen Teil der Belastung wegnimmt, ist, wenn man einem Kind versucht, die Schuldgefühle zu nehmen. Jedes Kind fühlt sich schuldig und wenn man das thematisiert, dann […] sagen einige, dass sie es nicht glauben: ‚Ich bin doch schuld daran!‘ Aber irgendwo nehmen sie es als riesengroße Erleichterung mit“ (Experte aus einer Fachberatungsstelle).
unterstützende Maßnahmen
Neben der Thematisierung von Gefühlen im Gespräch sind auch spezielle Angebotezur Stärkung der Selbstwahrnehmung von Kindern sinnvoll. Solche Übungen können durch didaktisches Material wie Bücher und Spiele unterstützt werden.
ein Körpergefühl entwickeln
Zusätzlich zur Förderung der Wahrnehmung von Gefühlen ist auch die Förderung der Körperwahrnehmung ein zentrales Element zur Unterstützung des Bewältigungsprozesses. Durch die sexualisierten Gewalterfahrungen erleben viele Kinder ihren Körper als beschmutzt, manche sogar als Feind. Einige Kinder mussten erleben, dass ihr Körper erregt auf die sexuellen Übergriffe reagiert hat. Diese Erfahrungen ebenso wie eine Abspaltung von Körperempfindungen oder Gefühlen, wie sie bei einer traumatischen Verarbeitung des Missbrauchs typisch sind (→ FK 4), führen häufig zu einer Entfremdung vom eigenen Körper. Pädagogische Fachkräfte können den Kindern dabei helfen, ihren Körper wieder spüren zu lernen.
„Wir unterstützen sie dabei, ein Körpergefühl zu entwickeln. Wir helfen ihnen, sich insgesamt mehr wahrzunehmen, den Körper wahrzunehmen, die Sinne wahrzunehmen und zu unterscheiden zwischen Gefühlen und Empfindungen. Zum Beispiel: Angst. Wenn ich anfange zu schwitzen (Empfindung), zeigt mir das, dass ich Angst (Gefühl) habe. Wo sitzt die Angst? Und wie kann ich die Angst beruhigen? Das kann man üben, das kann man überall üben. Das kann man in der Kita machen, das kann man in Schulen machen, das kann man in themenspezifischen Gruppen in der Jugendhilfe machen, damit sie mehr das Gefühl bekommen, dass sie sie selbst sind […]. Und da geht unglaublich viel. […] Wir schauen, dass sie sich selbst regulieren können, dass wir sie unterstützen bei einem Körpergefühl und dass sie sich ihrer selbst bemächtigen“ (Expertin aus dem Bereich der Traumapädagogik).
Förderung der sozialen Kompetenz
Definition
Soziale Kompetenz wird als die Fähigkeit definiert, „eigene Interessen in sozialen Interaktionen zu verwirklichen, ohne dabei die Interessen der anderen zu verletzen“ (Sendera/Sendera 2016, 94).
Von sexuellem Missbrauch betroffene Kinder müssen lernen, sich gegenüber Grenzüberschreitungen zu wehren, aber auch selbst die Grenzen anderer zu wahren.
Grenzen
„Das andere heikle Thema, das immer wieder auch im pädagogischen Alltag eine Rolle spielt, ist der Umgang mit Nähe und Distanz. Auch da haben Kinder Grenzverletzungen erlebt, die sie in unterschiedlicher Weise zeigen. Die einen neigen dazu, das distanzlos zu verarbeiten, die anderen eher dadurch, dass sie sich ganz und gar zurückziehen. Auch da brauchen sie Unterstützung durch ein Gegenüber von den pädagogischen Fachkräften. Die sogenannten Schmusekinder brauchen klarere Grenzen. Sie sollten vermittelt bekommen, dass es auch andere Möglichkeiten als in sexualisierter Form gibt, jemandem zu zeigen, dass man ihn mag. Und umgekehrt im anderen Extrem sollten die Kinder natürlich lernen, dass Berührung auch etwas Schönes sein kann, dass es unterschiedliche Formen gibt und dass man selber bestimmen kann, was man möchte. Das sind Erfahrungen, die Kinder wahrscheinlich erst in diesem Rahmen machen können: a) mit den pädagogischen Bezugspersonen und b) natürlich im Gruppengefüge. Deshalb ist es wichtig, mit den Kindern gemeinsam Regeln aufzustellen und auch so etwas wie ein Beschwerdemanagement in der Institution zu erarbeiten“ (Expertin aus einer Fachberatungsstelle).
Pädagogische Fachkräfte müssen mit den Kindern an folgenden Fragen arbeiten: Wo liegen meine Grenzen und wie kann ich sie spüren? Wie kann ich mich selbst behaupten, d. h. meine Grenzen auf angemessene Weise zeigen?
Psychoedukation
Definition
Psychoedukation umfasst alle Maßnahmen, die Betroffene und ihre Angehörigen über eine Krankheit und ihre Behandlung informieren, um das Verständnis dafür und die Bewältigung zu unterstützen (Gebrande 2021).
altersentsprechende Erklärung
Auch für die Bewältigung von traumatischen Erfahrungen und daraus resultierenden Traumata wird Psychoedukation als hilfreich erachtet (Gebrande 2021; Peichl 2017; Reddemann et al. 2023). Psychoedukation für sexuell traumatisierte Kinder bedeutet, ihnen altersangemessen zu erklären, welche psychischen Folgen traumatische Erfahrungen haben können. Wenn pädagogische Fachkräfte solche Erklärungen geben, können Kinder
„[…] den Sinn von [ihren] Verhaltensauffälligkeiten […] verstehen. Wilma Weiß (2024, 120) nennt es das ‚Konzept des guten Grundes‘, das heißt: Jedes Symptom und jede Verhaltensauffälligkeit hat einen guten Grund, um zu entstehen. […] Das müssen wir den Kindern vermitteln können, um ihnen das Gefühl zu nehmen, dass sie verrückt, komisch oder nicht liebenswürdig sind“ (Expertin aus dem Bereich der Traumapädagogik).
Entlastung
Psychoedukation hat, wie deutlich wird, eine entlastende Funktion. Zudem schafft die aus besserem Selbstverstehen resultierende größere Selbstakzeptanz die Basis für Veränderungen (Rogers 1985; Weinberger 2015).
„Am hilfreichsten ist, dass […] wir ihnen sagen: ‚Völlig normal, wie du tickst. Du tickst normal, reagierst normal auf eine alte Stresssituation. […]‘ Und dass wir mit ihnen immer gucken, dass sie ihre Verhaltensweisen auch als normal, auch als guten Grund, dass sie das einfach akzeptieren können“ (Expertin aus dem Bereich der Traumapädagogik).
Hilfen zur Selbstregulation
Umgang mit Trauma-Symptomen
Für die Bewältigung traumatischer Erfahrungen ist es außerdem wichtig, Kindern Strategien zur Selbstregulation zu vermitteln. Sie müssen lernen, mit Verhaltensweisen, die aus ihrer Übererregung resultieren, z. B. Wutanfällen, umzugehen und die hohe Anspannung zu verringern. Zur Reduzierung von Übererregung sind z. B. Imaginationsübungen wie der „innere Ort der Geborgenheit" (Reddemann 2022, 57 f.), die eine Form von Fantasiereisen darstellen, geeignet. Des Weiteren sind Methoden zur Flashback-Kontrolle und zum Stoppen von Dissoziationen hilfreich.
2.3Sozial- und Selbstkompetenzen (SSK)
Interaktion
Sozialkompetenzen stellen diejenigen Fähigkeiten dar, die zur situationsadäquaten Interaktion mit anderen Menschen notwendig sind (Sendera/Sendera 2016). Bezogen auf die im Fokus stehenden Anforderungen in der Arbeit mit Kindern, die sexuell missbraucht wurden, sind Sozialkompetenzen sowohl im Kontakt mit den zu betreuenden Kindern und ihren Eltern als auch mit Kolleg:innen des eigenen Teams sowie des weiteren Umfelds notwendig.
Reflexion
Selbstkompetenzen ermöglichen pädagogischen Fachkräften, ihre eigenen Fähigkeiten adäquat einzuschätzen und ihr berufliches Handeln kritisch zu reflektieren und zu steuern. Sie tun dies auf der Grundlage eines beruflichen Selbstbildes, das sich an Zielen und Standards professionellen Handelns orientiert. Dadurch können Konfliktpotenziale erkannt und situationsangemessene Lösungsprozesse initiiert werden (KMK 2017).
Leitlinien der Gesprächsführung
hilfreiche Reaktionen
Um mit Kindern, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, auf adäquate Weise zu sprechen, benötigen pädagogische Fachkräfte Kenntnisse hilfreicher Reaktionen auf die Äußerungen eines Kindes zu seinen Gewalterfahrungen. Von großer Bedeutung ist es u. a., ruhig zu reagieren und dem Kind einen geschützten Raum zum Erzählen zur Verfügung zu stellen, es jedoch nicht zu bedrängen und keine suggestiven Fragen zu stellen. Pädagogische Fachkräfte müssen außerdem wissen, wie sie mit dem Wunsch der Kinder umgehen sollen, nichts von dem weiterzuerzählen, was sie ihnen mitteilen. Da Kinder feine Antennen dafür haben, wem sie sich mit ihren Erfahrungen „zumuten“ können, ist es sehr wichtig, dass pädagogische Fachkräfte die persönlichen Erfahrungsberichte der Kinder aushalten können.
„Wenn sie [von sexuellem Missbrauch betroffene Kinder und Jugendliche] erleben, mein Gegenüber kann damit umgehen und kann offen damit umgehen und nimmt diese Information als einen Bestandteil dessen, was ich erlebt habe, neben vielen anderen Dingen, dann ist auch das wieder möglich, ich nenne das Landeplatz. Was kann landen und so fragen Kinder und Jugendliche auch und testen auch aus, was kann bei dir landen?“ (Expertin aus einem Kinderschutz-Zentrum).
Wer als pädagogische Fachkraft einen „Landeplatz“ bieten kann, eröffnet Kindern, die mit ihrer Not bislang allein gewesen sind, die Möglichkeit, sich anzuvertrauen.
Elterngespräche
Wie die Ausführungen verdeutlichen, gilt es im Kontakt mit den Kindern zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen. Pädagogische Fachkräfte müssen jedoch nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit den Eltern sprechen, wenn diese nicht selbst die Täter:innen sind.
„Eine Mutterberatung ist zwar keine Aufgabe, die eine Erzieherin unbedingt hat, aber sie muss gegebenenfalls dem familiären Umfeld vermitteln, dass es mitbetroffen ist, wenn das Kind traumatisiert ist von sexueller Gewalt und dass das auch eine Dynamik auslöst. Der Verrat des besten Freundes beispielsweise macht auch Eltern betroffen und daher müssen diese und sonstige Verantwortliche angeregt werden, sich auch um sich selber zu kümmern. Damit wird auch eine Entlastung des Kindes erreicht“ (Expertin aus einer Fachberatungsstelle).
weitere Schritte
Handelt es sich bislang erst um die Vermutung eines sexuellen Missbrauchs, weil das Kind im Gespräch nur Andeutungen gemacht hat oder Signale sendet, die darauf hindeuten, werden neben Gesprächen mit dem Kind weitere Handlungsschritte notwendig. Hierbei ist für pädagogische Fachkräfte ein klarer Ablauf für das Vorgehen hilfreich, der im Vorfeld im Team gemeinsam erarbeitet wurde und Bestandteil des Schutzkonzeptes der Einrichtung ist (UBSKM 2024b). Dieser Ablauf legt fest, wie mit der Vermutung eines sexuellen Missbrauchs umgegangen und wer innerhalb des Netzes professioneller Helfer:innen in den Prozess einbezogen wird.
Stärkung der eigenen wertschätzenden und empathischen Haltung
Gestaltung der Begegnung
Die im letzten Punkt benannten „Regeln“ der Gesprächsführung mit Kindern, die sexuellen Missbrauch erlebt haben oder bei denen dies vermutet wird, lassen sich nur dann auf hilfreiche Weise umsetzen, wenn sie von einer Haltung getragen werden, die den Kindern gegenüber Wertschätzung erkennen lässt. Außerdem sollten pädagogische Fachkräfte Empathie zeigen. Durch empathische Reaktionen, die auf Selbstaussagen von Kindern folgen, werden ihre Selbstempathie und Selbstakzeptanz gestärkt (Weinberger 2015; Weiß 2023). Mit der Zeit gelingt es ihnen dadurch, immer größere Anteile ihrer Erfahrungen in ihr Selbstbild zu integrieren (Wittmann 2014b). Ein dritter wichtiger Aspekt stellt Kongruenz dar, d. h. die Übereinstimmung von Botschaften, die über verschiedene Ebenen gesendet werden. Pädagogische Fachkräfte sollten für die Kinder ein Vorbild sein, indem sie vorleben, was sie den Kindern vermitteln möchten. Dabei geht es u. a. darum, dass die pädagogischen Fachkräfte zu positiven Modellen für Selbstfürsorge, das Ausfüllen ihrer Geschlechtsrolle sowie das Setzen und Achten von Grenzen werden.
„Das heißt, ich muss selbst auch meine Grenzen verteidigen können. Und ich muss da selber ein Stück weit eine gesunde, ‚starke‘ Persönlichkeit sein, die auf beiden Füßen steht. […] Ich will damit nicht sagen, dass ich nicht auch mal irgendwelche Einbrüche habe oder auch Probleme habe […]. Aber dann muss ich in der Lage sein zu sagen: ‚Wie komme ich mit denen klar? Wo kann ich selbst Unterstützung bekommen?‘ Gar kein Thema, wenn ich selbst Unterstützung brauche, dann hole ich mir die“ (Expertin aus einer Fachberatungsstelle).
professionelle Distanz
Die Fähigkeit pädagogischer Fachkräfte, Kindern auf der Basis einer wertschätzenden, empathischen und kongruenten Haltung zuhören zu können, sie ernst zu nehmen und ihnen zu glauben, stellt eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen gelingenden Bewältigungsprozess dar. Um die Berichte der Kinder aushalten zu können, müssen Fachkräfte in der Lage sein, eine professionelle Distanz einzunehmen.
„Es passiert oft, wenn sich bei Kindern dieses Drama wiederholt oder wenn eine Situation geprägt ist von Verzweiflung oder ständigen Schreianfällen, dass dann diese Hilflosigkeit deutlich wird. Dann müssen ein klares Distanziert-Bleiben und die Fähigkeit, draußen bleiben zu können, aufgrund der Einfühlung möglich sein. Das mag sich für viele paradox anfühlen, aber tatsächlich ist es das, was dann Halt gibt“ (Expertin aus dem Bereich der Traumatherapie).
Konzept des guten Grundes
Empathie und professionelle Distanz ermöglichen, den „guten Grund“ (Weiß 2024, 141) des kindlichen Verhaltens, das evtl. zunächst destruktiv wirkt, zu erkennen oder aufzuspüren. Auch wenn die Ursache des Verhaltens nicht sofort verstanden werden kann, führt die Annahme eines guten Grundes zu einer freundlicheren und positiveren Einstellung gegenüber dem Kind.
„[…] grundsätzlich kann man immer die Frage stellen: Wozu dient ein bestimmtes Verhalten subjektiv, z. B. Lügen? Lügen halte ich für Schwerstarbeit. Und das ist ein anderer Zugang, als zu sagen, es ist vor allen Dingen verboten und ich bin persönlich gekränkt, wenn ich angelogen werde“ (Expertin aus dem Bereich der Traumapädagogik).
Individualität beachten
Zudem ist ein individueller Blick auf das Kind wichtig. Jedes Kind, das Missbrauch erlebt hat, benötigt eine eigene und besondere Unterstützung, die sehr unterschiedlich sein kann. Daher ist es wichtig, die individuelle Situation wie das Alter, das Geschlecht des Kindes, die Herkunft aus Familien unterschiedlicher Kulturen und religiöser Wertvorstellungen zu berücksichtigen und das Kind in seiner Vielfältigkeit wahrzunehmen. Wenn es auch notwendig ist zu wissen, was traumatische Ereignisse allgemein bei Kindern auslösen können, so ist es doch unverzichtbar zu prüfen, auf welche spezifische Weise jedes einzelne Kind seine Erfahrungen verarbeitet.
„Es ist immer eine Einzelfallgeschichte. Es ist immer wichtig, mit den Eltern oder mit der Familienhilfe im Austausch darüber zu sein, ob irgendetwas beachtet werden muss, ob es spezifische Ängste gibt, ob es spezifische Orte gibt, an denen etwas passiert ist, wo man dann ein besonderes Augenmerk auf das Kind richtet. […] Es geht nicht darum, dass man dramatisiert, aber dass man ein Auge hat auf die Schwierigkeiten, die sich für das Kind in dem Moment ergeben. Es kommt immer auf den Einzelfall an. Es gibt nicht das Missbrauchssyndrom schlechthin“ (Experte aus einem Kinderschutz-Zentrum).
gleiche Grundbedürfnisse
Häufig wird betroffenen Kindern eine Sonderrolle zugestanden, die ihnen jedoch nicht gut tut. Pädagogische Fachkräfte sollten sich darüber klar werden, dass von Missbrauch betroffene Kinder die gleichen Grundbedürfnisse haben wie andere Kinder. Auf ihre Bedürfnisse ist bislang nur viel zu wenig eingegangen worden.
„Die einen glauben, dass Kinder, die Missbrauchserfahrungen haben, ganz besonders geschont werden müssen, was dann darin ausufert, dass sie denen weniger abverlangen, dass sie milder beurteilt werden, wenn sie sich nicht an Grenzen halten und dass alles, was sie an Verhalten zeigen, damit erklärt wird, dass sie so arm sind und Missbrauchserfahrungen gemacht haben und nichts dafür können. Viele sind einfach verunsichert, ob sie ganz normal mit den Kindern umgehen können oder ob es da etwas Besonderes braucht. […] Und ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, dass es da wenig Wissen gibt: Was brauchen denn Missbrauchskinder? […] In welchen Bereichen brauchen sie denn wirklich Unterstützung? Und was können wir da tun? In welchen Bereichen sind sie aber ganz normal wie alle anderen Kinder auch?“ (Expertin aus einer Fachberatungsstelle).
keine Sonder- und Opferrolle
Für Kinder, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, sollte es nicht nur keine Sonder-, sondern auch keine Opferrolle geben, da diese mit der Zuschreibung von Ohnmacht verbunden ist und einen gelingenden Verarbeitungs- und Bewältigungsprozess blockiert.