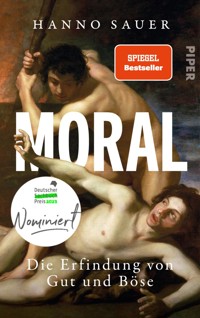25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Kampf um Prestige, Status und Ansehen Was ist Klasse? Wie entsteht Ungleichheit? Was sind die Quellen von Statushierarchien und Prestige? Sind reiche Menschen bessere Menschen? Oder schlechtere? Hanno Sauer zeigt in diesem brillanten Buch, was Klassenunterschiede sind, wie sie funktionieren und warum sie so schwer loszuwerden sind. Und wie wir die »Logik sozialer Signale« entschlüsseln können, von denen wir umgeben sind. Dabei wird klar: Soziale Klassenunterschiede und Statushierarchien haben einen viel fundamentaleren Einfluss auf unser Denken, unser Handeln und unsere gesamte Gesellschaft, als wir glauben. Sie durchdringen unsere Kultur und unsere Werte und formen unser ganzes Leben. Wenn wir unsere Gesellschaft verbessern wollen, müssen wir verstehen, wie sie funktioniert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
© 2025 Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, www.piper.de
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an: [email protected]
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: Slim Aarons / Getty Images
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Geschichten
Schwarze Witwe
Ausblick
Schwarze Witwe (Fortsetzung)
Aufbau des Buches
Schwarze Witwe (nächste Fortsetzung)
Rousseau 2.0
Klassismus, der
Privilegien
Schlechte Nachrichten
Epistemologie der Eindringlinge
Klasse und Ressentiment
Schwarze Witwe (Schluss)
Gesellschaft
Was stimmt nicht mit deinen Augen?
Ausblick
Fälschungssichere Signale
Soziale Signale: die Fundamente
Ein Markt für Zitronen: das Problem asymmetrischer Information
Demonstrativer Konsum: Thorstein Veblens Theorie der feinen Leute
Schibboleth und MAGA: soziale Signale als Kooperation
Teure Signale: eine spieltheoretische Analyse
Die Logik sozialer Signale
Kontersignale
Stigmaprahlerei und die Gentrifizierung von Benachteiligung
Vergrabene Signale
Transformative Signale: verbrannte Brücken
Soziale Paradoxien und die Fragilität von Statuswettbewerben
Selbsttäuschung
Signale, Status, Klasse
Geschmack
Auffahrt
Ausblick
Veblens Löffel
Der schönste Autounfall aller Zeiten: Geschmack als soziale Distinktion
Kulturelles Kapital: interesseloses Wohlgefallen als teures Signal
Ästhetik des Sperrigen: die Metaisierung der Kultur
Der Eigensinn des Ästhetischen
Wie Trends entstehen: die Diffusion von Innovation
Die Ständeklausel und der Proletendrift
Von Hummern lernen
Strukturwandel des Geschmacks: high brow, low brow, nobrow, omnibrow
Das Kunstsystem als reaktionäre Institution
Die Beschleunigung der Kultur
Klasse und Sprache: Gestatten, Frau Stöhr
Erotisches Kapital: der Status von Sex
Über allen Gipfeln
Transklasse: Grenzgänger, Hochstapler, Parvenus
Gewissen
Metropolitan: Klasse, Moral und die neue Aretokratie
Ausblick
Alles Heuchler
Luxusmeinungen?
Moralische Haltungen als teure Signale
Falsches Bewusstsein, Ideologiekritik und demonstrativer Moralkonsum: von Marx zu Veblen und zurück
Moralische Effekthascherei
Empörungspornografie
Virtue signalling und die neue Aretokratie
Moralische Selbstdarstellung als Statuswettbewerb
Moralphilosophie als Signalling: das Beispiel des Longtermism
Aretokratischer Wettbewerb
Elitenüberproduktion: Die Revolution frisst ihre Kinder
Die Straße des Unbehagens
Schurken oder Heilige?
Sind soziale Eliten immer konservativ?
Die diskrete Scham der Bourgeoisie
Geld
Alla Fiorentina/China
Ausblick
Wer ist reich?
Chancenhortung
Altes Geld, neues Geld
Subtiler Konsum: Frugalität als Ideologie
Von Indien über Fidschi nach Delaware
Tutto passa: der Buddenbrooks-Effekt
Linke Brahmanen, rechte Händler
Caviar cope
Keynes’ Traum
Statusangst: Keeping up with the Joneses
Die gehetzte Klasse: das Linder-Theorem
Work hard, play hard: der neue Geist des Kapitalismus
HENRYs: die Unbegeldeten
Welche Klassen gibt es? Und wie viele?
Klassen zählen: zur Anatomie von Statushierarchien
Die Klassendecke: Kasten, soziale Immobilität und die Erblichkeit von Status
Gerechtigkeit
Der Gefangene und der Kaiser
Ausblick
Was ist Gerechtigkeit?
Klasse in der Philosophie
Die bürgerliche Gesellschaft und ihr Anderes
Natur vs. Kultur: Ist Status sozial konstruiert?
Ist Status kulturell universell?
Stigma und Ruhm
Die Evolution von Prestige
Die Reproduktion von Statushierarchien
Die Ökonomie samtener Seile
Politische Hebel: die Umverteilung von Status
Der Status der Zukunft
Gemeinschaft
Klassenlose Gesellschaft
Ausblick
Klassenkampf
Unter null: Statuswettbewerbe als Negativsummenspiel
Fraktale Ungleichheit: von positionalen Gütern zu relativer Entbehrung
TINA
(Zu)Spätkapitalismus, oder: Das Ende der Geschichte
Die Ausgrabung des Paradieses
Klassenbewusstsein
Ohne mich
Wir sind alle Sozialisten
Cohens Zeltlager, oder: Was ist Sozialismus?
Autobiografie eines Bleistifts
Partizipatorische Ökonomie
Bruchstücke einer großen Konzession: Marktsozialismus
Emporiophobie
Genug
Träumen
Dank
Literatur
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Geschichten
In diesem Buch werden die folgenden Fragen beantwortet:
Was ist Klasse? Was ist Status? Wie entsteht soziale Ungleichheit? Was sind die Quellen von Hierarchien und Prestige? Wieso gibt es soziale Klassen, und was hält sie zusammen? Wie funktionieren Statussymbole? Was ist der Ursprung sozialer Ungerechtigkeiten, und wie kann man sie bekämpfen? Was ist Solidarität? Kann es eine klassenlose Gesellschaft geben? Woher kommen Statusängste? Und wer leidet am meisten darunter? Gibt es noch echte Gemeinschaft? Sind reiche Menschen bessere Menschen? Oder schlechtere? Sind arme Menschen bessere Menschen? Oder schlechtere? Welche Rolle spielen ökonomische Faktoren für die Bildung sozialer Klassen? Welche Rolle spielen nicht-ökonomische Faktoren? Haben soziale Eliten andere Werte? Welche Rolle spielen Statuswettbewerbe für den sozialen Wandel? Was ist Klassismus? Funktioniert Klassismus genauso wie Rassismus oder Sexismus? Und ist er ein größeres Übel? Oder ein kleineres? Gibt es einen Klassismus von unten? Oder nur von oben? Was sind die kulturellen und ästhetischen Vorlieben der Oberschicht? Zu welcher Klasse gehören Sie? Zu welcher Ihre Nachbarn? Kann man die soziale Klasse wechseln? Oder ist Klasse erblich? Was ist die Logik von Statuswettbewerben? Wie viele Klassen gibt es eigentlich? Und welche? Was ist Klasse?
Aber der Reihe nach. Ist die schwarze Witwe schon da?
Schwarze Witwe
Tock! ... Tock, tock!
»Niemand antwortet.«
Tock, tock!
»Das geht jetzt schon seit Wochen so.«
Ausblick
Dieses Buch handelt von Klassenunterschieden – was sie sind, worin sie bestehen, warum es sie gibt, wie sie funktionieren und warum sie so schwer loszuwerden sind.
Klasse ist sozial konstruierte Knappheit. Durch diese Knappheit entsteht eine Rangfolge – ein Oben und Unten. Die Position einer Person auf dieser Rangfolge entscheidet darüber, wie viel Prestige, Macht und Ressourcen sie erhält; sie wird durch den Besitz von verschiedenen Formen ökonomischen, kulturellen, symbolischen, sozialen, ästhetischen oder moralischen Kapitals bestimmt.
Die bedeutendsten Klassentheoretiker der Moderne sind der deutsche Philosoph Karl Marx, der US-amerikanische Ökonom Thorstein Veblen und der französische Soziologe Pierre Bourdieu. Diese drei Klassiker – und viele weitere – werden in diesem Buch im Licht der besten empirischen Studien und aktuellen Daten neu gelesen und bewertet. In den letzten Jahren hat es bahnbrechende Entwicklungen in der Theorie sozialer Signale (signalling theory) gegeben, die es uns erlauben, die wichtigsten Einsichten jener Klassentheoretiker auf einem höheren Niveau und mit noch größerer Präzision zu reformulieren. Diese Entwicklungen werde ich in diesem Buch erklären und dabei zeigen, dass soziale Klassenunterschiede und Statushierarchien einen noch viel fundamentaleren Einfluss auf unser Denken, unser Handeln und unsere gesamte Gesellschaft haben, als wir ohnehin schon glauben. Klassenunterschiede formen unsere Kultur, unsere Werte, unser Zusammenleben, unsere Sprache, unsere Politik, unser Leben. Klasse ist alles, alles ist Klasse.
Oder jedenfalls fast.
Oft wird behauptet, dass soziale Klassenunterschiede heute noch wichtiger seien als jemals zuvor.[1] Aber das ist nicht wahr. Klasse und Status sind heute nicht wichtiger als früher, sie waren immer schon gleich wichtig, nämlich maximal. Wir sollten den Versuchungen von Verfallstheorien und Kulturpessimismus, die stets alles im Niedergang sehen, widerstehen und uns unserer Neigung bewusst sein, die Vergangenheit zu romantisieren. Die Makel der Gegenwart erscheinen uns immer am größten. Aber es stimmt, dass sich die Landschaft von Klasse und Status aktuell – mal wieder – verändert und dass es gegenwärtig subtile, leicht zu übersehende Wandlungen darin gibt, wie Klassen, Status und Ungleichheit unsere moderne Gesellschaft formen. Diesen Strukturwandel moderner Statushierarchien werde ich in diesem Buch erklären. Wenn wir unsere Gesellschaft verbessern wollen, müssen wir verstehen, wie sie funktioniert.
Schwarze Witwe (Fortsetzung)
»Und sie will nicht ihr Zimmer verlassen?«
»Kein bisschen.«
»Weigert sich?«
»Ganz und gar.«
»Aufstehen?«
»Aufstehen, essen. Nicht einmal trinken will sie.«
»Himmel! Wie man einen Menschen so lieben kann. Werd ich nie verstehen, wie die Herrschaften denken.«
»Ich verstehe es. Verstehe sie.«
»Verzeihen Sie bitte, Miss. Es ist nur … es dauert schon so lang. So schrecklich lang.«
Aufbau des Buches
Es gibt sieben Kapitel, die das Phänomen von Klassenhierarchien aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Mit Ausnahme des ersten Kapitels, das das begriffliche Herzstück des Buches bildet, lassen sich diese Kapitel auch getrennt voneinander lesen oder überspringen.
Gesellschaft
. In diesem Kapitel werden die theoretischen Fundamente für den Rest des Buches gelegt. Ich erkläre die Logik sozialer Signale und führe die theoretischen Begriffe ein, die für das Verständnis von Statuswettbewerben zentral sind. Eine im ganzen Rest des Buches immer wiederkehrende Idee wird der Begriff
teurer Signale
sein, der hier detailliert ausbuchstabiert wird. Die Theorie teurer Signale hat in den letzten Jahren faszinierende Fortschritte gemacht, sodass sich deren enormes und lange unterschätztes Potenzial jetzt abzuzeichnen beginnt. Wenn man das Konzept sozialer Signale einmal wirklich verstanden hat, sieht man die Welt noch einmal ganz neu.
Geschmack
. Dieses Kapitel handelt davon, wie ästhetische Präferenzen, Lebensstile und kulturelle Gewohnheiten Klassenunterschiede hervorbringen und stabilisieren. Es wird immer wieder (zu Recht) betont, dass Klassenzugehörigkeit nicht primär – und schon gar nicht ausschließlich – davon abhängt, wie reich (oder arm) jemand ist. Das sogenannte
kulturelle Kapital
einer Person ist mindestens genauso wichtig und vielleicht sogar noch entscheidender. Aber worin besteht dieses Kapital? In diesem Kapitel zeige ich, wie uns die Theorie sozialer Signale dabei helfen kann, Thorstein Veblens Begriff demonstrativen Konsums mit Pierre Bourdieus Theorie sozialer Distinktion zu verbinden. Ich werde erklären, warum Kants Begriff des interesselosen Wohlgefallens ebenfalls die Logik teurer Signale zugrunde liegt, welche aktuellen ästhetischen Entwicklungen stattfinden und was deren Dynamik antreibt.
Gewissen
. In diesem Kapitel wird das moralische Kapital sozialer Eliten untersucht. Statuswettbewerbe werden nicht nur mit ästhetischen Präferenzen und kulturellem Kapital ausgetragen, sondern auch mit normativen Werten und ethischen Haltungen. In modernen Gesellschaften kommt es zu einem
demonstrativen Konsum
moralischer Werte
, der die normative Infrastruktur unserer Gesellschaft formt. Auch dieser Strukturwandel lässt sich durch die Logik teurer Signale erklären. In diesem Kapitel werde ich zudem illustrieren, wie sich eine Eskalationsdynamik entwickelt, die dafür sorgt, dass die moralischen Haltungen sozialer Gruppen tendenziell immer extremer und spezieller werden. Es entsteht eine soziale Schicht, die ich als
neue Aretokratie
bezeichne und die ihre Statuswettbewerbe primär über den Zugang zu einer moralischen Avantgarde austrägt.
Geld
. Dieses Kapitel beleuchtet die ökonomische Seite sozialer Statushierarchien. Ich erkläre, welche Rolle wirtschaftliche Faktoren für soziale Stratifikation (die Ausbildung sozialer Schichten) spielen, wie der Unterschied zwischen altem und neuem Geld zustande kommt, wie Statusängste entstehen und was die ideologischen Hauptmerkmale des modernen Kapitalismus sind. Außerdem diskutiere ich die Frage, wie viele Klassen es gibt, welche dies sein könnten und welche Kriterien dafür geeignet sind, diese Frage zu beantworten. Die Antwort, die ich vorschlagen werde, lautet: vier.
Gerechtigkeit
. In diesem Kapitel widme ich mich der Frage, ob Statusungleichheiten
ungerecht
sind, und wenn ja, was man politisch dagegen tun kann. Ich skizziere kurz, was Gerechtigkeit bedeutet, inwiefern Klassenunterschiede eine Ungerechtigkeit darstellen, wie Statushierarchien in der Philosophiegeschichte diskutiert wurden (nämlich kaum) und warum die üblichen politischen Mittel gegen soziale Ungleichheiten wie Redistribution gegen Klassenunterschiede nicht eingesetzt werden können. Mit zunehmendem Wirtschaftswachstum verschärft sich dieses Problem wahrscheinlich sogar noch. Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir Ungleichheiten und Statusunterschiede nie ganz abschaffen können, sondern lernen müssen, mit ihnen zu leben.
Gemeinschaft
. Dieses Kapitel stellt die Frage, ob es eine klassenlose Gesellschaft geben kann und wie diese aussehen könnte. Wenn Statuswettbewerbe und Klassenhierarchien ubiquitär sind – Klasse ist alles, alles ist Klasse –, kann es dann echte Gemeinschaft geben?
Genug
. In diesem kurzen Schlusskapitel werde ich einige Vorschläge dafür skizzieren, wie moderne Gesellschaften mit dem Problem von Statusungleichheiten umgehen sollten.
Schwarze Witwe (nächste Fortsetzung)
Skerrett – wie üblich wurde Marianne Skerrett ihrer Rolle wegen meist nur mit dem Nachnamen angesprochen – hatte ihrer Hilfe einen scharfen Blick zugeworfen, der aber bald einem verständnisvolleren gewichen war.
Denn mit Salmonella Typhi war es so eine Sache: In leidenschaftsloser Vermehrungswut machte der Typhus auch vor den höheren und höchsten Häusern nicht halt. Wie ein unsichtbarer Sturm war er durch den Körper des Prinzgemahls geweht; aber Albert von Sachsen-Coburg und Gotha hatte ohnehin nie besonders am Leben gehangen, und so zog die größere Spur der Verwüstung durch das Leben seiner Frau, der Königin. Albert starb am 14. Dezember 1861, und Skerrett würde Alexandrina Victoria von Kent für den Rest ihres langen Lebens nur noch in schwarze Kleider helfen.
Das Zeitalter, das ihren zweiten Vornamen trägt, ist zum Synonym für exzessive Prüderie geworden. Den neurotischsten Übertreibungen viktorianischer Leibfeindlichkeit wurde entweder mit beengenden Korsagen zum Ausdruck verholfen, die, mit Walbarten in ihrer Unerbittlichkeit verstärkt, den oberen Teil des weiblichen Körpers schmerzhaft verformten; oder mit sperrigen Krinolinen, die den unteren Teil beinah jedem Blick entzogen und selbst alltägliche Verrichtungen, wie sich zu setzen oder eine Tür zu durchschreiten, zum Hindernis machten.
Victoria selbst dagegen war eine leidenschaftliche Frau gewesen, die in ihren Tagebüchern hymnisch-beseelt Alberts privateste Talente lobte und ihrem »geliebten« Gatten in Wort und Tat sehr zugewandt war. Nach seinem Tod blieb sie noch jahrelang gelähmt und niedergeschmettert. War es nicht alles nur ein böser Traum? War nicht ihr Glück zerstört? Ihr Leben sogar?[2]
Rousseau 2.0
Stellen Sie sich vor, Sie lebten in einer Gesellschaft, in der niemand Ihnen vertraut, niemand etwas mit Ihnen zu tun haben will, niemand Ihr Freund sein möchte, niemand mit Ihnen sprechen, Sie zu einer Feier einladen, Geschäfte mit Ihnen machen, Sie lieben und für Sie sorgen möchte. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie könnten einen Gegenstand erwerben – vielleicht ein Abzeichen oder eine App oder eine bestimmte Art von Hut oder ein mit magischen Kräften ausgestattetes Artefakt –, durch den andere Leute auf einmal alle diese Dinge mit Ihnen und für Sie tun möchten. Auf einmal möchte jeder Ihren Rat, Zeit mit Ihnen verbringen, mit Ihnen essen gehen, Ihnen Geld leihen, mit Ihnen Sex haben und Sie einstellen.
Es gibt einen solchen Gegenstand: Er heißt Status. Würden Sie ihn haben wollen? Selbstverständlich würden Sie das. Er ist die begehrteste Ressource der modernen Welt.
Es gibt noch einen weiteren Klassiker der philosophischen Moderne, in dessen Tradition dieses Buch steht. In meinem letzten Buch Moral. Die Erfindung von Gut und Böse aus dem Jahr 2023 habe ich versucht, Nietzsches Genealogie der Moral ein zeitgenössisches Update zu geben. »Nietzsche, aber wahr«, habe ich seitdem manchmal scherzhaft-ernst gesagt. Das vorliegende Buch dagegen lässt sich als eine Art Update zu Rousseau lesen, dessen Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen – wenn ich mich richtig erinnere – das erste Buch war, zu dem ich in meinem Studium im ersten Semester an der Philipps-Universität Marburg 2002 ein Seminar belegt habe. Rousseaus Erzählung vom noblen Wilden, der vom Leben in Gesellschaft kontaminiert wird, ist natürlich – so wie Nietzsches Ballade vom Sklavenaufstand in der Moral – inzwischen veraltet. Es lohnt sich deshalb, einen weiteren Anlauf zu nehmen und die Dynamik von Klassenunterschieden und Statuswettbewerben mit den besten aktuell verfügbaren begrifflichen Mitteln aus Philosophie, Psychologie, Ökonomie, Evolutionstheorie und Geschichte noch einmal ganz neu auszubuchstabieren. Sie denken vielleicht, dass Sie zumindest ein ungefähres Verständnis der Ursprünge sozialer Ungleichheit haben und der Mechanismen, die diese aufrechterhalten. Aber Sie irren sich: Die Lage ist in Wahrheit noch viel komplexer, als Sie ahnen; es trennen Sie mehr als 300 Seiten davon, wieder klar zu sehen.
Klassismus, der
In den letzten Jahren waren soziale Ungleichheiten, die Hierarchien von Privilegien und Marginalisierung, Diskriminierung und Exklusion erzeugen, eines der wichtigsten Themen in dem Diskurs, den moderne Gesellschaften über sich selbst führen.[3] Rassismus und Sexismus waren die Hauptverwerfungslinien, auf die sich dieser Diskurs konzentrierte, nicht zuletzt weil Hautfarbe und Geschlecht zu den auffälligsten Merkmalen einer Person gehören. Gleichzeitig wurde immer wieder der Verdacht geäußert, dass die exzessive Beschäftigung mit ethnischer oder sexistischer Diskriminierung von den eigentlich wichtigen Formen sozialer Ungerechtigkeit ablenkt und die ursprünglichen Anliegen progressiver Politik zu verdrängen droht: Klassismus sollte wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt werden, sozioökonomische Ungleichheiten als Priorität rehabilitiert werden. Dieses Buch löst diese Forderung ein.
Durch Klassenungleichheiten entsteht eine soziale Rangfolge in der Menge an Respekt, Achtung, Ehre, Anerkennung oder Prestige, die einer Person zukommen. Eine solche Rangfolge war früher offiziell anerkannt und ging mit greifbaren politisch-ökonomischen Privilegien einher, die eine aristokratische Elite für sich reklamierte; in Artikel 109 der Weimarer Verfassung hieß es dann: »Öffentlich-rechtliche Vorrechte oder Nachteile der Geburt oder des Standes sind aufzuheben.« In vielen europäischen Ländern ist diese formelle Form der Klassenstratifikation heute verschwunden und durch ein informelles Ranking der sozialen Position von Individuen und Familien ersetzt worden.
Eines der größten Projekte der modernen Aufklärung war es, endlich eine gerechte Gesellschaft zu erschaffen, die sich von den ererbten Sünden vorangegangener Generationen befreit und jedem Menschen gleiche Rechte und Chancen einräumt. »All men are created equal«, heißt es in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika, und viele haben sich seither gefragt, wie sich dieses Bekenntnis zur fundamentalen Gleichheit mit der Realität einer Sklavenhaltergesellschaft vertragen konnte. Aber es ging nie um eine Aussage über die universelle Menschenwürde oder die fundamentale Gleichheit aller Individuen. Dass alle Menschen »gleich« sein sollen hieß einfach nur, dass es unter den weißen Bürgern keine Klassen geben sollte, wie es sie im alten Europa gab. Dass dies alle Menschen einschließen sollte, war nie vorgesehen.
In jüngster Zeit wurde das Projekt der Abschaffung verschiedener Formen sozialer Ungleichheit dann vor allem im Blick auf Ethnie und Geschlecht weiterverfolgt: Rassismus und Sexismus sollten neu benannt, neu verstanden, neu angeprangert und endgültig eliminiert werden, auf dass ungerechtfertigte soziale Ungleichheiten ein für alle Mal der Vergangenheit angehören mögen und die menschliche Geschichte fortan von solchen Makeln unbehaftet weitererzählt werden könne.
Klassenungleichheiten und Klassismus sind wichtiger als Rassismus, Sexismus oder Ableismus. Denn Klasse ist die dominante, fundamentale Form sozialer Ungleichheit. Vorurteile funktionieren manchmal additiv, manchmal multiplikativ, und manchmal so, dass eine einzige Kategorie alle anderen dominiert. In manchen Fällen erfährt eine Person Diskriminierung, weil sie schwarz ist und weil sie schwul ist (additiv); in manchen Fällen summiert sich die erfahrene Benachteiligung nicht nur, sondern die vorurteilsbehafteten Merkmale verstärken einander gegenseitig, sodass ein schwarzer Obdachloser besonders marginalisiert lebt (multiplikativ); und in manchen Fällen dominiert ein einziges Merkmal die Wahrnehmung gleichsam total, sodass jemand – entweder vorübergehend oder dauerhaft – ausschließlich als X wahrgenommen wird.
Klasse ist eine dominante Kategorie, die ethnische oder Geschlechtszugehörigkeit zur Nebensache macht. Klassismus färbt unsere Wahrnehmung noch stärker als andere Formen diskriminierender Einstellungen, ob Rassismus, Sexismus, Ableismus oder Ageismus. Ethnie, Geschlecht oder Alter sind unmittelbarer und auffälliger – man sieht auf den ersten Blick, ob eine Person männlich oder weiblich ist, dunkle oder helle Haut hat; deswegen kommt es uns so vor, als wären rassistische oder sexistische Formen der Exklusion und Marginalisierung auch die wichtigsten. Aber das ist nicht so: Klasse und Statuszugehörigkeit übertrumpfen alle anderen sozialen Privilegien oder Nachteile. Klasse sticht »Rasse«, nicht umgekehrt: eine bestens ausgebildete, mit dem »richtigen« Habitus, Kleidungsstil und Akzent ausgestattete Person mit dunkler Hautfarbe kann ohne Weiteres zur gesellschaftlichen Elite gehören; eine arme, arbeitslose, ungebildete und kulturell nicht versierte Person bleibt Unterschicht, selbst wenn sie weiß und/oder männlich ist.[4]
In einer Studie zu den impliziten (positiven oder negativen) Vorurteilen, die Teilnehmer an einem Experiment anderen Menschen gegenüber hegen, konnte man zeigen, dass Testsubjekte Menschen, die auf Fotos mit variierenden Statusmerkmalen dargestellt sind – also zum Beispiel im gepflegten Anzug oder in schäbiger Kleidung –, unterschiedlich positiv bewerteten. Die Ethnie der jeweiligen Personen hatte keinen Einfluss auf deren Beurteilung; die Tatsache, dass frühere Studien die Existenz unbewusster diskriminierender Reaktionen auf schwarze Menschen zu zeigen schienen, könnte zu einem großen Teil daran liegen, dass den Teilnehmern nur die Gesichter der beurteilten Menschen gezeigt wurden, wodurch deren ethnische Zugehörigkeit die einzige Information war, die überhaupt zu Verfügung stand, was im Alltag natürlich nie der Fall ist.[5]
Und was materielle Konsequenzen angeht, ist klassistische Diskriminierung ohnehin wirkmächtiger als jede andere Form der Bevor- oder Benachteiligung. Die »Class Salary Gap« beträgt nicht selten 25 Prozent oder mehr;[6] und anders als Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern (Gender-Pay-Gap) lässt sich diese nicht durch Unterschiede in geleisteten Arbeitsstunden oder der Berufswahl erklären.[7] Die neuesten Studien zeigen, dass rassistische Benachteiligung von klassistischer Benachteiligung sogar immer stärker abgehängt wird.[8]
Die Prestigewettbewerbe, die Klassenhierarchien erzeugen, sind selbst dann am Werk, wenn sie es gerade nicht zu sein scheinen. »Sind die Rettungsboote nach Klassen unterteilt? Ich hoffe nur, dass sie nicht zu voll sind«, sagt Ruth Dewitt Bukater, die Mutter der Hauptfigur Rose aus dem Film Titanic, im ersten Chaos nach der Kollision mit dem Eisberg. Und tatsächlich: Von den 1513 Todesopfern, die die berühmteste Schiffskatastrophe aller Zeiten forderte, kam die überwältigende Mehrheit aus der dritten Klasse. 203 von 325 Passagieren aus der ersten Klasse überlebten die Schicksalsfahrt, aber nur 178 von 706 Passagieren aus der dritten Klasse erreichten unversehrt das amerikanische Festland. Dennoch schlägt der Statistiker Paul D. Ellis eine andere Interpretation vor: Die meisten Passagiere der dritten Klasse kamen ums Leben, weil die meisten Passagiere der dritten Klasse Männer waren. »Wenn das Geschlecht zur Analyse hinzugefügt wird, wird offenkundig, dass Ritterlichkeit, nicht Klassenkampf, die beste Erklärung für die relativ hohen Todeszahlen der dritten Klasse war«.[9] Sexismus – hier zuungunsten von Männern –, nicht Klassismus löschte die dritte Klasse aus. Aber auch diese Analyse geht nicht tief genug, denn warum eigentlich waren die meisten Passagiere der dritten Klasse männlich, und warum eigentlich opferten diese ihr Leben aus »Ritterlichkeit«? Die Antwort lautet in beiden Fällen: Statuswettbewerbe. Männer haben im Vergleich zu Frauen einen disproportional großen Anreiz, auf der Suche nach einem besseren Leben Risiken einzugehen, weil die Position von Männern in Statushierarchien besonders stark darüber entscheidet, welchen Zugang sie zu sozialen und materiellen Ressourcen erhalten, weswegen es überwiegend Männer waren, die ihr Glück in der neuen Welt versuchen wollten; und Männer haben ein disproportional stärkeres Interesse daran, Charaktereigenschaften wie Willensstärke, Integrität und Mut zu beweisen, weil diese Tugenden eine besonders kostbare Währung im Kampf um soziale Prestigegewinne – und weibliche Gunst – darstellen. Es sind also doch wieder Statuswettbewerbe, die die Todeszahlen auf der Titanic erklären.
Im Juni 2023 entschied der Supreme Court der Vereinigten Staaten von Amerika in den Fällen »Students for Fair Admissions vs. Harvard« und »Students for Fair Admissions vs. University of North Carolina«, dass die Zulassungspraktiken der beiden hochselektiven Eliteuniversitäten das vom 14. Verfassungszusatz allen Bürgern garantierte Recht auf Gleichbehandlung vor dem Gesetz unabhängig von deren ethnischer Herkunft verletze. Harvard hatte – so wie viele andere renommierte Universitäten auch – nach Meinung des Verfassungsgerichts seine ehrgeizigen Diversitätsziele durch sogenannte affirmative action zu erreichen versucht, also den aktiven Versuch, Mitgliedern der schwarzen Bevölkerung die Aufnahme zu erleichtern, etwa durch niedrigere Standards für die Mindestpunktzahl beim SAT-Test, der die akademischen Fähigkeiten zukünftiger Studenten einschätzen helfen soll.[10] In vielen Fällen führte dies dazu, dass die dunkelhäutigen Kinder jüngst in die USA eingewanderter wohlhabender Familien aus Nigeria oder der Karibik von diesen Praktiken profitierten, obwohl diese eigentlich der durch das Erbe von Sklaverei und Segregation benachteiligten afroamerikanischen Bevölkerung zugutekommen sollten. Ein irregeleiteter Fokus auf die Ethnie von Bewerbern – wir wollen eine angemessene Zahl schwarzer Studenten vorweisen können – lenkte vom eigentlichen Ziel jener Zulassungsbemühungen ab, das darin bestanden hatte, die historisch marginalisierten Mitglieder der schwarzen Gemeinschaft aktiv beim sozialen Aufstieg zu unterstützen. Derweil lässt das Fortbestehen sogenannter Legacy-Admissions, also niedrigerer Zulassungshürden für Studenten, deren Eltern schon in Harvard waren, den nackten Klassismus in krassester Weise hervortreten.
Im Unterschied zu anderen diskriminierenden Haltungen ist Klassismus weiterhin sozial akzeptabel. Welche Mitschüler der eigenen Kinder aus »guten« Familien stammen und welche – so die Implikation – aus »schlechten«, ist eine Einschätzung, die nach meiner Erfahrung freimütig und mit großer Selbstverständlichkeit geteilt wird. Selbst in Fantasy-Filmen, die in völlig fremden Welten spielen sollen, bedienen sich die Macher der wahrnehmungssteuernden Kraft sozialer Statussignale: Im Herr der Ringe sprechen die weisen Zauberer, die edlen Elben und die gutmütigen Hobbits mit Akzenten der englischen Upper und Upper Middle Class, die brutalen Orks und Uruk-hai, die wie Ungeziefer in schlammigen Schleimbeuteln herangezüchtet werden, mit der für die Arbeiterklasse typischen Inflexion derer, die im östlichen London oder gar – horribile dictu – im Norden Englands aufgewachsen sind.
»White Trash« ist zwar erkennbar kein sehr wohlwollender Ausdruck, wird aber unironisch und unverblümt ausgesprochen, ohne Scham benutzt und selten problematisiert, und die Darstellung eines stereotypen Redneck-Paars wie Cletus und Brandine aus den Simpsons als halb verblödetes, Waschbär jagendes Inzuchtpaar mit schiefen Zähnen wäre mit vertauschten ethnischen Vorzeichen völlig undenkbar.
Auch die retroaktiven Wärmesuchsysteme, die cancelbare Vergehen längst schon verstorbener Künstler oder Autoren aufzuspüren versuchen, können es kaum abwarten, Otfried Preußler oder Astrid Lindgren für ihr veraltetes Vokabular zu schurigeln, zucken aber nicht mal mit der Schulter, wenn Konsul Jean Buddenbrook die als einfältig und ungebildet dargestellten Lübecker Arbeiter, die endlich eine Republik fordern, darüber aufklärt, sie hätten ja schon eine – worauf diese antworten, wenn dem so sei, dann wolle man eben noch eine.
Klassismus ist, vielleicht mit Ausnahme von Diskriminierung auf Basis physischer Attraktivität[11] – die wenigsten Menschen schämen sich zuzugeben, einen attraktiven Partner zu bevorzugen –, die einzige Form von Diskriminierung, die als legitim gilt. Die meisten Menschen geben sich größte Mühe, nicht als rassistisch oder sexistisch wahrgenommen zu werden, äußern aber ihre Verachtung gegenüber den ungewaschenen Massen, ohne mit der Wimper zu zucken.[12] Für die Opfer klassistischer Diskriminierung ist dies besonders verletzend. Denn es ist eine Sache, das Ziel von Spott, Hass und Verachtung zu sein, und eine ganz andere, das Ziel von weithin als legitim wahrgenommenem Spott, Hass und Verachtung zu sein.
Klassismus muss nicht immer etwas Schlechtes sein. Tilmann Lahmes Die Manns etwa ist einerseits eine Familienbiografie, andererseits aber ein beeindruckendes Zeugnis dafür, wie Dünkelhaftigkeit und das robuste Gefühl, aus feinerem Holz geschnitzt zu sein, gegen die finstersten Auswüchse der Barbarei inokuliert. Denn der nationalsozialistische Faschismus war ja, neben seinen territorial-imperialistischen Ambitionen und seinem mörderischen Antihumanismus, vor allem eine politische Bewegung, die die Frustrationen und Ressentiments der Abgehängten zu bündeln wusste. Damit konnten sich Erika und Klaus Mann, die Gründer der »Herzogparkbande«, schlechthin nicht gemein machen. Aber es waren nicht feste moralische Prinzipien, die diese Bewegung für die Mann-Kinder verhasst machte, sondern primär der brutale Massencharakter und das antiintellektuelle Hordentum der Nazis, das die überverfeinerten Bogenhausener Literatenkinder gegen die Versuchungen des Faschismus abschottete.
Privilegien
Soziale Ungerechtigkeiten werden aktuell häufig als Privilegiendifferenzial konzeptualisiert. Soziale Privilegien, die mit den in einer jeweiligen Gesellschaft als hegemonial anerkannten Merkmalen einhergehen – also zum Beispiel männlich, hellhäutig, wohlhabend, heterosexuell, gebildet, christlich, konventionell attraktiv und/oder gesund zu sein –, manifestieren sich darin, dass manche Individuen sich ohne nennenswerte Friktion in der Mehrheitsgesellschaft bewegen können: ihnen wird vertraut, zugehört, Kompetenz unterstellt, und ihnen werden aussichtsreiche Chancen geboten. Menschen, denen eines oder mehrere oder alle jener Merkmale fehlen, spielen das gesellschaftliche Spiel auf schwierigerer Stufe, weil ihnen die damit einhergehenden Privilegien fehlen.[13] Aber worin diese Privilegien bestehen, warum sie relevant sind und wie sie funktionieren, bleibt häufig unklar. Um sie besser zu verstehen, müssen wir klären, woher Klasse und Status kommen und wie diese miteinander zusammenhängen.
Sozialen Status- und materiellen Klassenunterschieden mehr Aufmerksamkeit zu schenken ist auch deshalb gerechtfertigt, weil oft übersehen wird, dass soziale Gleichheit und Diversität unabhängig voneinander sind. Stellen Sie sich eine Gesellschaft vor, in der so gut wie die gesamte Macht und alle Ressourcen in den Händen einer winzigen Elite konzentriert sind: Selbst in dieser krass ungleichen Gesellschaft ließe sich den Forderungen der Diversität Genüge tun, wenn nur alle sozialen Gruppen und Minderheiten proportional in jener winzigen Elite vertreten wären. Damit wären zwar bestimmte Formen der Diskriminierung und Marginalisierung abgeschafft – nämlich die, die den Zugang zu sozial herausgehobenen Spitzenpositionen regulieren –, aber soziale Ungerechtigkeit bliebe davon weitestgehend unberührt. Eine bestimmte Form liberalen Diversitätsdenkens, so scheint es, hätte gegen die Institution der Sklaverei nichts mehr einzuwenden, wenn es nur eine hinreichende Menge schwarzer Sklavenhalter gegeben hätte.
Schlechte Nachrichten
Die schlechte Nachricht ist, dass wir nur sehr wenig gegen die Existenz von Statushierarchien tun können. Eine Gesellschaft ohne Rassismus, Sexismus oder Ableismus ist, auch wenn manchmal das Gegenteil behauptet wird,[14] schwierig zu erreichen und leider weit entfernt, aber immerhin möglich. Die Mechanismen aber, die Klassenunterschiede erzeugen, sind kaum zu eliminieren und größtenteils jenseits politischer Interventionsmöglichkeiten. Es ist natürlich – wenn die unsichtbare Hand freien gesellschaftlichen Austauschs dies nicht zu leisten vermag – grundsätzlich möglich, mit dem sichtbaren Fuß politischen Zwangs dafür zu sorgen, dass Statushierarchien und die Kräfte, die diese erzeugen, nach und nach verschwinden. Aber der Eingriff in andere Rechte und Werte, der dafür notwendig wäre, wäre so groß, dass die Kosten eines solches Eingriffs für die überwältigende Mehrheit der Menschen in modernen Gesellschaften wie der unseren prohibitiv hoch wären. Von einer Gesellschaft, deren Mitglieder geschwisterlich-solidarisch miteinander leben, träumen viele: Aber weder die Rückkehr zu ursprünglicheren Vergemeinschaftungsformen wie subsistenzwirtschaftlichen, präneolithischen Kleinstgruppen noch den Übergang in eine mit zentralisierter Verfügungsgewalt in das Privatleben individueller Personen hineinregierende illiberal-autoritäre Herrschaftsform fänden die meisten von uns attraktiv.
Viele Autoren glauben heute, dass sozialer Rassismus das Fundament moderner Ungleichheit sei. In ihrem viel beachteten Buch Kaste. Die Ursprünge unseres Unbehagens behauptet die US-amerikanische Journalistin und Autorin Isabel Wilkerson, »Rasse leistet die Schwerstarbeit in einem Kastensystem, das ein Mittel sozialer Spaltung benötigt«.[15] Aber das Gegenteil ist der Fall. Soziale Segregation kommt zuerst, und die Essentialisierung derer, die die Gruppe der am schlechtesten Gestellten ausmachen, ob als »Rasse« oder sonst irgendwie uniforme Gruppe – Pöbel, Pariah oder Proletariat –, liegt stromabwärts von dieser tiefer liegenden Stratifikation in Statushierarchien. Wenn dann besonders augenfällige Merkmale, wie etwa leicht sichtbare Unterschiede der Hautfarbe, hinzukommen, mit denen sich diese Segregation markieren lässt, entsteht Rassismus. Rassismus ist aber soziostrukturell sekundär, er ist nur die Art und Weise, wie sich Klassenunterschiede in vielen Kontexten manifestieren. Dass dies so sein muss, sieht man daran, dass dem paradigmatischen Kastensystem überhaupt – nämlich dem Indiens – bestimmte Rassenunterschiede wie die zwischen schwarz und weiß ja gar nicht zur Verfügung standen. Jene Hierarchien konnten innerhalb der indischen Gesellschaft trotzdem entstehen.
Es gibt ein gesamtes Buchgenre, das den feinen Unterschied zwischen »Es ist schwieriger als gedacht, Problem X politisch zu bewältigen« und »Wir sollten den Versuch aufgeben, überhaupt irgendetwas gegen X zu unternehmen« ausbeuten. Tatsächlich gehört die Behauptung, eine bestimmte politische Verbesserung oder soziale Reform sei hoffnungslos, vergeblich, zum Scheitern verurteilt und nicht umsetzbar, laut dem Volkswirt und Sozialwissenschaftler Albert O. Hirschman zu den klassischen Strategien der »Rhetorik der Reaktion«, die eine bessere Welt als außer Reichweite darzustellen versucht.[16] Diesen Fehler will ich vermeiden, und die teilweise pessimistische Botschaft dieses Buches deshalb so solide und gründlich wie möglich belegen.
Das Problem sozialer Klassenunterschiede wird uns nicht nur erhalten bleiben. Es wird sogar schlimmer werden, denn Statusängste nehmen mit zunehmendem gesellschaftlichem Wohlstand zu, weil materielle Absicherung die relative Wichtigkeit nicht materieller, symbolischer Statusunterschiede noch intensiviert.[17] In der aktuellen Debatte um soziale Ungleichheit und Gerechtigkeit wird zu optimistisch mit der Frage umgegangen, ob und wie sich bestimmte Probleme strukturell angehen lassen. Aber ich will nicht den Fehler machen, überzukorrigieren, und stattdessen einen vollständigen Skeptizismus in Bezug auf die Lösbarkeit des Problems sozialer Statusungerechtigkeiten vertreten. Mein Versuch, die Komplexität des Problems zu artikulieren, soll einen Beitrag dazu leisten, wie unsere Gesellschaft bessere Lösungsvorschläge für das Problem sozialer Statusgefälle machen kann. Ich will Klassenunterschiede nicht verteidigen oder rechtfertigen; aber wenn wir uns so ehrlich wie möglich damit konfrontieren, warum es sie gibt, müssen wir uns eingestehen, dass wir nicht wirklich wissen, wie wir politisch gegen sie vorgehen können.
Epistemologie der Eindringlinge
Viele Bücher über Klasse und Status wie JD Vance’ Hillbilly Elegy oder Rob Hendersons Troubled, die das Leben von Oberschicht und sozialer Elite zu beschreiben und zu verstehen versuchen, nehmen die distanzierte Außenseiterperspektive des Ethnologen ein, der einen fremden Stamm mit dessen eigentümlichen, manchmal sogar bizarren und nur schwer nachvollziehbaren Ritualen und Praktiken studiert.[18] Thorstein Veblen und Pierre Bourdieu nehmen diese Investigativpose ebenfalls ein, und auch Didier Eribons Rückkehr nach Reims gehört in diesen Kontext. Es ist eine Art Epistemologie des Eindringlings, die verspricht, den fremden Stamm derer »da oben« mit größerer Distanz und dadurch Objektivität beschreiben zu können.
Aber dieser Einsichtsvorsprung durch Elitentourismus ist eine Illusion. Es entsteht kein Objektivitätsvorteil durch das Fremdeln, kein tieferes Verständnis durch die Naivität des Landeis, kein schärferer Blick durch den Schicksalspfad des Pflegekindes. Es ist sogar umgekehrt: Dem Touristen bleibt vieles unverständlich, er versteht und sieht vieles gerade nicht, und es sind in Wahrheit die Einheimischen, die sich in ihrem Städtchen besser auskennen. Weder der Eindringling noch der Einheimische freilich weiß alles über die lokale Kultur. Man bringt nur andere Vorurteile und andere Perspektiven, andere Formen des Unwissens und andere blinde Flecken mit.
Hier sind meine: Ich bin kein Tourist in der sozialen Oberschicht. Meine Position im Blick auf Statushierarchien und soziale Eliten ist nicht die Epistemologie des Eindringlings, sondern die des Einheimischen, des Eingeweihten, wahrscheinlich sogar des Komplizen, vielleicht des Schnösels, sicher des Begünstigten.
Meine Kindheit und Jugend waren geprägt von Besuchen im Frankfurter Städel oder im Goethehaus, Opernabenden in Wiesbadener Privatlogen, Gesprächen zum Abendessen, bei denen sich meine Eltern gelegentlich über säumige Mieter beschwerten oder en passant auf Kafkas Erzählungen anspielten; ich wuchs auf in den eleganten Restaurants Düsseldorfs und Tiroler Fünfsternehotels mit Oberkellner, auch im Ferienhaus an der Nordsee, umgeben von Schweizer Uhrwerken und englischen Motoren und umsorgt von gutmütigen Kinderfrauen, die sich um meine Brüder und mich kümmerten.
In meinem beruflichen Zuhause, der akademischen Welt, gibt es inzwischen eine zunehmende Anzahl von (übrigens sehr löblichen) Initiativen, Studenten oder Doktoranden der »ersten Generation« – das heißt Personen, die in ihrer Familie die Ersten sind, die eine Universität besucht haben – die Navigation jenes fremden Biotops zu erleichtern, damit auch sogenannte »Arbeiterkinder« akademisch reüssieren können. In der akademischen Welt gibt es eine ausgeprägte »Class Gap«, die sich messbar auf die Karrierechancen von Individuen auswirkt.[19] Aber auch hier kann ich nicht wirklich mitreden; meine Eltern sind beide promoviert, und der akademische Habitus ist meine Kinderstube. »Der Mensch fängt erst beim Doktortitel an«, pflegte mein Vater zu sagen, und auch wenn ich diesen Bildungsaristokratismus selbst nicht teile, habe ich von meinen Klassenprivilegien immer profitiert.
Einer der handfestesten Aspekte einer bestimmten Klassenposition ist die Art und Weise, in der diese vor so mancher Unbill des Lebens bewahrt. Die Vorzüge eines privilegierten Hintergrunds manifestieren sich nicht nur in der universellen sozialen Parkettsicherheit, durch die man überall ernst genommen und als dazugehörig wahrgenommen wird, sondern vor allem darin, dass ein solcher Hintergrund seine Begünstigten von allerlei unwillkommenen Konsequenzen isoliert, die ein stiefmütterliches Schicksal oder der Rest der Gesellschaft zu bieten haben. Ein Lockdown lässt sich in einer großzügigen Unterkunft angenehmer verbringen als in einer kleinen Wohnung, und als die meisten Hotels geschlossen hatten, verbrachten wir die Herbstferien eben mit Freunden ziemlich genau auf halbem Weg zwischen Kupferkanne und Klenderhof.
Auch wenn es manches Geheimnis der sozialen Oberschicht ausplaudert, ist dieses Buch keine Benimmfibel. Etikettenhandbücher gibt es schon sehr lange. Bereits Aristoteles’ Nikomachische Ethik enthält Empfehlungen dazu, wie man sich auf Partys zu verhalten habe: Der Possenreißer ist immer nur auf den nächsten Scherz aus; wer weder Humor noch Witz hat, leidet an der Untugend der Steifheit.[20] Das angemessene Verhalten liegt, wie immer in Aristoteles’ Tugendethik, in der Mitte (mesotes). Im 16. Jahrhundert finden wir dann Baldassare Castigliones Libro del Cortegiano und Erasmus von Rotterdams De civilitate; 200 Jahre später Johann Gottfried Gregoriis Curieuser AFFECTen-Spiegel, Oder auserlesene Cautelen und sonderbahre Maximen, Gemüther der Menschen zu erforschen, Und sich darnach vorsichtig und behutsam aufzuführen und Adolph Freiherr von Knigges Über den Umgang mit Menschen; auch im 20. Jahrhundert waren Tiffany’s Table Manners for Teenagers noch sehr populär. Dieses Buch dagegen enthält keine Maximen und Vorschriften, sondern will mit den besten aktuell verfügbaren begrifflichen und empirischen Werkzeugen erklären, wie Klassenhierarchien zustande kommen und warum es sie gibt.
Klasse und Ressentiment
Die Ausbeutung von Klassenhierarchien ist politisch ungeheuer wirksam. Heute wird der sogenannte kulturelle Backlash – in Deutschland meist etwas volkstümelnd als »Rechtsruck« bezeichnet –, also eine wiedererstarkte konservativ-reaktionäre, ethnonationalistische, antiprogressive und teilweise rechtsextreme Politik, ebenfalls primär als Reaktion auf die anscheinend ins Wanken geratenen Statusprivilegien erklärt.[21]
W. E. B. du Bois prägte einst den Begriff des »psychologischen Lohns des Weißseins«[22]. Egal, wie schlecht es der weißen Bevölkerung in den USA auch manchmal gegangen sein mag, wenigstens wusste man, dass man nicht ganz unten steht und auch niemals dort stehen kann, weil der Platz am untersten Ende der Hackordnung für die Mitglieder der schwarzen Minderheit reserviert war. Aber progressive soziale Bewegungen versuchen genau diese alten Statushierarchien zu destabilisieren und neu zu verhandeln, oft mit dem Ergebnis, dass sich die weiße, heterosexuelle Mehrheit, und vor allem der männliche Teil dieser Mehrheit, wie »Fremde im eigenen Land«[23] fühlt: Die symbolische Neubewertung von Klassen- und Statusrangfolgen wird von den vormals Privilegierten als Verlust erfahren, sogar als Bedrohung.
Der vermeintliche »Rechtsruck«, den wir seit spätestens 2015 in der westlichen Welt beobachten, ist also gar kein Zeichen dafür, dass in modernen Gesellschaften das soziokulturelle Pendel in Richtung eines neofaschistischen Autoritarismus zurückschwingt, sondern ein unvermeidliches Symptom der Tatsache, dass progressive soziale Bewegungen zugunsten von Inklusion und Diversität normativ so gut wie alternativlos geworden sind. Die Reklamation einer ethnonational verstandenen Identität war immer schon eine ressentimentgeladene Verliererbewegung, die sich von markigen rechtspopulistischen Sprüchen Trost für diese oder jene nachvollziehbare Sorge oder Empörung erhofft, nicht selten aber an jemanden erinnert, der in der Notaufnahme Pflaster für seine Papierschnittwunden sucht.
Der Markt für solche Berichte aus dem Weltinnenraum des Ressentiments ist groß und wird immer wieder von Autoren bedient, die sich wie JD Vance in seiner Hillbilly-Elegie zu diesem niederträchtigen Genre herablassen. Deren Vertreter gerieren sich als heimgekehrte Ethnologen der Eliten, als diejenigen, die ihre Wurzeln nicht vergessen haben und immer noch »einer von euch« sind – die aber kurze Zeit in den Hinterzimmern der Macht spionieren durften und jetzt, wieder in der Heimat angekommen, davon erzählen dürfen, was der gesunde Menschenverstand schon immer wusste: dass »die da oben«, die Masters of the Universe, auch nur mit Wasser kochen oder, schlimmer noch, in Wirklichkeit armselige und unglückliche Blender sind, die uns hier unten erst auf den Kopf pissen und dann glauben machen wollen, es regne.
Schwarze Witwe (Schluss)
Der Tod ihres Gefährten ließ nicht nur Victorias Leben stillstehen. Zwischen Ostern und August jeden Jahres hatte sonst die London Season stattgefunden, deren Feste und Bälle für den Nachwuchs der adligen Peerage meist die einzige Möglichkeit darstellte, heiratsfähige junge Frauen und Männer geeigneten sozialen Ranges kennenzulernen. Der Zugang zu jener Jahreszeit der Werbung war finanziell anspruchsvoll und sozial exklusiv, wodurch es der englischen Aristokratie gelang, auch für die nachwachsende Generation sicherzustellen, dass man unter sich blieb.
Aber durch Victorias Trauer, die nicht nur Albert, sondern auch ihrer im selben Jahr verstorbenen Mutter galt, war die Ballsaison nun drei Jahre in Folge ausgefallen. Wer in dieser Zeit heiraten wollte – und Warten war keine Option, denn eine Frau, die nicht bald nach dem eigenen sozialen Debüt einen Antrag erhalten hatte, galt schnell als schale alte Jungfer –, musste auf jenes ausgeklügelte System des Miteinander-Anbändelns verzichten und sich näherliegenden Kandidaten zuwenden. Die Wahrscheinlichkeit, einen bürgerlichen Ehemann zu finden, stieg für adlige Frauen in jener Zeit um fast die Hälfte.[24]
Seit menschliche Gesellschaften gelernt haben, Wohlstand zu erwirtschaften, wird dieser Wohlstand ungleich verteilt.[25] Und seit Wohlstand ungleich verteilt wird, gibt es Institutionen, die den von dieser Ungleichheit Begünstigen dabei behilflich sind, ihre herausgehobene soziale Stellung abzusichern und zu beschützen.
Die London Season war eine solche Institution: Indem sie die Transaktionskosten auf dem diskreten Markt aristokratischer Heiratswilliger minimierte, gelang es ihr, der englischen Upper Class das zu gewähren, was ihr am wichtigsten war (und ist): Exklusivität. Wie hätte man ohne Internet und Kontaktanzeigen herausfinden sollen, wer gerade verfügbar ist, wer Interesse hat, wer zu wem passt oder wenigstens ein Mindestmaß an wechselseitiger Sympathie aufbringen kann, um einer Verbindung eine Chance zu geben? Durch eine intensive Phase sorgfältig konzertierten Matchmakings löste die London Season dieses Informationsproblem.
In der populären Imagination war ja, jedenfalls in Europa, immer schon England der Ort, an dem sich Klassenunterschiede besonders vorbildlich und idealtypisch zeigen. Aber warum war es der englischen Oberschicht so wichtig, unter sich zu bleiben? Und: Warum ist es uns so wichtig?
Die Antwort, die ich in diesem Buch skizzieren werde, ist: Klasse. Der Kindertraum von einer Gesellschaft unter Gleichen sollte weitergeträumt werden; aber das heißt nicht, dass er nicht genau das bleibt: ein Traum. Und Träumen ist auch immer ein bisschen riskant: Man muss aufpassen, dass man aus seinen Träumen nicht als Ungeziefer erwacht.
Klasse ist sozial konstruierte Knappheit; ich werde erklären, was der Ursprung von Statushierarchien ist, welche Rolle Vermögen, Lebensstil und Werte bei der Abgrenzung von Klassenunterschieden spielen, warum wir – wahrscheinlich – lernen müssen, mit diesen zu leben, und warum Klasse und Status in modernen Gesellschaften vielleicht noch wichtiger werden, als sie es jemals waren. Klasse ist alles, alles ist Klasse. (Oder jedenfalls fast.)
Gesellschaft
Was stimmt nicht mit deinen Augen?
Als Sarah Connor ihren auf der Rückbank sitzenden Sohn John wütend anfährt, dass dieser als zukünftiger Führer des Widerstands gegen die Maschinen nicht sein Leben hätte riskieren dürfen, um seine Mutter aus der Psychiatrie zu retten, bricht er in Tränen aus.
Der Terminator sitzt am Steuer. Er wurde aus der Zukunft in die Vergangenheit geschickt, um John zu beschützen, und dafür mit allem Wissen ausgestattet, das dafür notwendig ist; nur was Tränen sind, scheint dem von Arnold Schwarzenegger liebenswert-grobschlächtig gespielten Cyborg niemand erklärt zu haben: »Was stimmt nicht mit deinen Augen?«, fragt er, als er Johns benetzte Wangen im Rückspiegel sieht.
Die meisten Körperflüssigkeiten werden als ekelhaft empfunden. Wie angenehm fänden Sie es, einen Tropfen fremden Blutes, Speichels, Urins oder Spermas wegwischen zu müssen? Aber es gibt eine liquide Aussonderung, die fast gar keinen Ekel hervorruft: Tränen. Selbst einem Fremden eine Träne aus dem Gesicht zu wischen stellt kaum eine Überwindung dar.
Warum ist das so? Eine (kontrovers diskutierte) Möglichkeit besteht darin, dass Ekel und Abscheu durch Dinge hervorgerufen werden, die uns an unsere tierische Natur erinnern. (Dies bezeichnet man als »animal reminder disgust«.[1]) Blut und Sperma und Urin haben andere Tiere ebenfalls, und auch wenn manche Tierarten Tränen zur Lubrikation ihrer Augen einsetzen, sind emotionale Tränen tatsächlich spezifisch menschlich: Kein anderes Tier weint, um Gefühle auszudrücken.[27] Als exklusives menschliches Privileg erinnern uns Tränen nicht daran, dass auch wir sterbliche Tiere sind, sie gelten deshalb als harmlos und »rein« und rufen keinen Ekel hervor. Sie sind die einzige Körperflüssigkeit, die unmittelbar der Kommunikation dient. Tränen sollen ein Signal senden.
Die Maschine, die menschlich zu sein nur vorgibt, kann nicht weinen. Als er sich schließlich selbst zerstören will, um der Menschheit das zerstörerische, in ihm verbaute technologische Wissen vorzuenthalten, bricht John Connor, dem der Tötungsroboter inzwischen ans Herz gewachsen ist, erneut in Tränen aus. Der Terminator erklärt: »Ich weiß jetzt, warum ihr weint. Aber das ist etwas, das ich niemals tun kann.«
Was weiß der T-800? Warum weinen wir Menschen? Und warum nur wir Menschen? Und: Was haben Tränen mit sozialer Klasse zu tun?
Ausblick
Dieses Buch handelt von Klassenunterschieden – worin sie bestehen, wie sie entstanden sind, wie sie sich reproduzieren und warum sie sich nur so schwer beseitigen lassen.
In diesem Kapitel wird das theoretische Fundament für das Verständnis dieses Themas gelegt. Meine These ist, dass soziale Klassenhierarchien durch Statuswettbewerbe entstehen, die mit sozialen Signalen ausgetragen werden. Die Logik sozialer Signale zu verstehen ist mein Hauptanliegen in diesem Kapitel. Ich werde erklären, was soziale Signale sind, wie sie funktionieren und wie sich deren Dynamik analysieren lässt. Dabei werde ich eine ganze Reihe technischer Begriffe und ein neues theoretisches Vokabular einführen, das das Fundament der Analyse von Statushierarchien abgibt, die in den späteren Kapiteln entwickelt wird. Die ästhetische, moralische und monetäre Dimension des Klassenbegriffs lassen sich nur im Rahmen einer Theorie sozialer Signale angemessen verstehen. Diesen Rahmen werde ich hier liefern.
Soziale Signale müssen, um ihre Funktion erfüllen zu können, fälschungssicher sein. Sogenannte »teure« oder auch »kostspielige« Signale sind die zentrale Währung von Statuswettbewerben, mit denen sich Gesellschaften in Klassenhierarchien stratifizieren. Aber soziale Signale sind intrinsisch instabil, und ihre Logik ist dynamisch: Um als Zeichen verlässlich zu bleiben, müssen sich kostspielige Signale permanent wandeln, verkehren sich als Kontersignale in ihr Gegenteil, verstecken sich als vergrabene Signale vor dem Entdecktwerden, um als vor dem Entdecktwerden Versteckte entdeckt zu werden, werden zu demonstrativem Konsum, zur Stigmaprahlerei, werden durch Selbsttäuschung vor unserem eigenen Bewusstsein versteckt und sind uns doch im Alltag bewusst wie wenige andere Dinge. Was also sind diese sozialen Signale, die unseren Klassenkämpfen und Statussymbolen zugrunde liegen?
Fälschungssichere Signale
Menschen weinen, weil Tränen fälschungssichere Signale sind.[28]
Wir sind soziale Wesen. Unter den Säugetieren ist unsere Kooperationsfähigkeit unübertroffen, und auch im restlichen Tierreich erreichen nur wenige Arten, wie einige eusoziale Insekten – etwa Bienen, Ameisen oder Termiten –, unseren Grad an Zusammenarbeit und gemeinschaftlichem Leben.
Für soziale Wesen wie uns ist es entscheidend, die mentalen Zustände unserer Mitmenschen zu kennen – was andere um uns herum denken, wollen und fühlen. Und es ist fast genauso wichtig für uns, unsere eigenen mentalen Zustände anderen Menschen zu erkennen zu geben – sichtbar zu machen, was wir denken, wollen und fühlen. Manchmal fühlen wir uns traurig, bekümmert oder verzweifelt, deprimiert, bedrückt, verängstigt oder unglücklich. Dies sind leise und langsame Emotionen, die, anders als rasende Wut oder laute Begeisterung, nicht ohne Weiteres sichtbar werden oder sich in beobachtbarem Verhalten niederschlagen. Aber eine traurige oder verzweifelte Person sucht dennoch Anteilnahme und Mitgefühl, vielleicht sogar Trost und Beistand, und deshalb muss es einen Weg geben, die eigene Not zum Ausdruck zu bringen und zu signalisieren, dass man Hilfe braucht.
Gleichzeitig ist es wichtig, dass man fremde Hilfe nicht übermäßig in Anspruch nimmt oder sogar dann, wenn man sie überhaupt nicht braucht. Potenzielle Helfer müssen erkennen können, dass die Situation ernst ist, die betroffene Person wirklich Hilfe braucht und nicht bloß vorgibt, in Not zu sein. Tränen leisten diese Funktion, indem sie Traurigkeit und Kummer kommunizieren, die nur sehr schwer zu fingieren sind: Tränen sind, wie man im technischen Jargon manchmal sagt, hard to fake – fälschungssicher – und deshalb ein verlässliches Zeichen dafür, dass es dem Weinenden wirklich schlecht geht. Einige gehen sogar noch weiter und interpretieren Hinweise auf Depressionen und Suizidalität als fälschungssichere Signale, die genuine Notsituationen indizieren sollen.[29]
Weil es so schwer ist, willkürlich zu weinen, sind Tränen fast garantiert authentisch. Deswegen finden wir es auch faszinierend – und ein bisschen verstörend –, wenn manche Menschen nach Belieben weinen können, denn wir wissen, wie schwierig und selten das ist. Eine der ersten Fragen, die Schauspielern oft gestellt wird, ist, ob sie auf Kommando weinen können. Die meisten können das nicht, sondern müssen sich erst in einen echten Zustand der Traurigkeit versetzen, um ihren Tränendrüsen beim Vorsprechen den einen oder anderen Tropfen abzuringen. Der Ausdruck Krokodilstränen existiert in fast allen Sprachen und steht für als inauthentisch empfundenes Mitgefühl, das manipulativ eingesetzt wird und deshalb als moralisch anstößig wahrgenommen wird.
Die Idee der Fälschungssicherheit sozialer Signale spielt eine tragende Rolle in diesem Buch. Sie ist der Schlüssel zum Verständnis dafür, wie Klassenunterschiede entstehen, warum sie so beständig sind und wie die Logik von Statuswettbewerben aussieht. Wie funktionieren diese Signale? Und warum gibt es sie überhaupt?
Soziale Signale: die Fundamente
Um uns in Gesellschaft zu bewegen und Entscheidungen zu treffen, benötigen wir Informationen. Soll ich diese Frau an der Bar ansprechen? Diese Frage ließe sich etwas leichter beantworten, wenn es irgendein öffentlich sichtbares Zeichen dafür gäbe, ob sie vergeben ist oder nicht. Und tatsächlich: in vielen Kulturen haben sich visuelle Marker etabliert, die den Familienstand einer (männlichen oder auch weiblichen) Person anzeigen, zum Beispiel indem Ringe an Händen oder Füßen getragen, bestimmte Frisuren oder Kopfbedeckungen gewählt oder markante Kosmetika benutzt werden. Und auch das Gegenstück existiert: Im Spätsommer 2023 traf ich mich mit Freunden und deren Kindern vor der bestsortierten Trinkhalle Düsseldorfs, um ein paar Flaschen Wein für die wenige Meter entfernt im Rheinpark stattfindende Open-Air-Opernaufführung zu besorgen. Einer meiner Freunde trug einen auffälligen türkisfarbenen Ring, der seinen Beitrag dazu leisten soll, unsere Gesellschaft vom Fluch der Dating-Apps zu befreien: Der »pear ring«[30] ist so etwas wie das Gegenteil eines Eherings und zeigt an, dass man erstens Single ist und zweitens offen dafür, »irl« – also in real life – angesprochen zu werden. Öffentlich sichtbare Zeichen können alltägliche Informationsprobleme lösen.
Die Theorie sozialer Signale wurde in den Siebzigerjahren fast zeitgleich und unabhängig voneinander von verschiedenen Forschern in den Wirtschaftswissenschaften und in der Verhaltensbiologie entwickelt. Der US-amerikanische Ökonom Michael Spence wollte verstehen, in welcher Situation sich Unternehmen befinden, die neue Mitarbeiter einstellen wollen.[31] Rekrutierungsverfahren sind eine Art »Investition unter Unsicherheit«, bei der Firmen nicht nur entscheiden müssen, wer eingestellt werden soll, sondern auch zu welchem Gehalt. Aber welche potenziellen Mitarbeiter sind wie produktiv, clever, fleißig oder pünktlich? Diese Information ist ex ante – also bevor der Arbeitsvertrag unterschrieben ist – nur schwer zugänglich. In diesem Fall wäre es hilfreich, wenn dem Unternehmen auf der Suche nach neuem Personal irgendein Merkmal zur Verfügung stünde, an dem sich ablesen ließe, wer wie schlau oder motiviert ist. Spence argumentierte, dass Ausbildungszertifikate wie Universitätsabschlüsse diese Signalfunktion übernehmen. Wer einen Bachelor mit guten Noten in einem schwierigen Fach von einer guten Universität vorweisen kann, der zeigt damit, dass er über die Eigenschaften verfügt, die bei Arbeitgebern besonders begehrt sind: Intelligenz und eine hohe Toleranz für langweilige Aufgaben. Eine überraschende Implikation ist, dass dieses signalling selbst dann funktioniert, wenn der Bewerber auf der Universität rein gar nichts gelernt hat. Das vorhandene Humankapital wird durch den erfolgreichen Abschluss so oder so angezeigt, unabhängig davon, wo oder wie es erworben wurde. Und das Signal ist verlässlich, denn nicht jeder hat die Fähigkeit, ein komplexes Fach zu studieren, weshalb diejenigen, die die entsprechenden Signale senden, im Durchschnitt auch diejenigen sind, die die gesuchten Qualitäten haben.
Der israelische Biologe Amotz Zahavi entwickelte ein ähnliches Modell im Kontext sexueller Selektion, also der Partnerwahl im Tierreich. Die Struktur des Problems ist identisch: Eine Partei A will entscheiden, ob sie eine bestimmte Beziehung mit einer Partei B eingehen möchte. Dies hängt davon ab, ob B über gewisse Merkmale verfügt, die A nicht direkt beobachten kann, also etwa die Produktivität eines Mitarbeiters oder die genetische Fitness eines Geschlechtspartners. Zahavi fiel auf, dass in vielen Spezies die weiblichen Mitglieder eine Präferenz für bestimmte phänotypische Eigenschaften haben, von der nicht auf Anhieb klar ist, wieso sie existiert. Hirschkühe etwa bevorzugen meist die Hirschböcke mit dem größten Geweih, weibliche Pfauen finden Pfauenmännchen mit besonders üppigem Schwanzgefieder am attraktivsten. Aber warum? Diese Vorliebe ist zumindest ein bisschen mysteriös, denn viele dieser Eigenschaften stellen eigentlich einen Nachteil dar. Der prächtige Schweif des Pfaues ist für den Vogel nicht nur schwer zu produzieren, sondern auch extrem beeinträchtigend. Warum sollte man sich mit einem Männchen paaren, das durch seinen Schwanz so beeinträchtigt ist, dass es kaum fliegen kann?
Zahavis Idee war, dass es gerade die Tatsache ist, dass der Pfauenschwanz für den Vogel eher eine Behinderung darstellt, die erklärt, warum die Hennen ihn anziehend finden. Denn als Pfau muss man sich eine solch schwere Behinderung leisten können, wenn man mit dieser überleben können will: Das Weibchen wählt den prächtigsten Pfau, weil er diese Behinderung verkraften kann. Zahavi nennt dies das »Handicap-Prinzip«.[32] Die Behinderung ist kein Konstruktionsfehler; sie ist der Schlussstein des Gebäudes.
In beiden Fällen – der Rekrutierung neuer Mitarbeiter und der Auswahl eines potenziellen Sexualpartners – wird ein Signal gesendet und empfangen, das Auskunft über die unbeobachtbaren internen Qualitäten eines Individuums gibt. Aber woher wissen die Empfänger, dass das Signal auch verlässlich ist, dass es also nicht von in Wahrheit genetisch minderwertigen Pfauenmännchen gesendet wird, um leichtgläubige Pfauendamen zu täuschen? Dies gelingt dadurch, dass die Signale kostspielig sind, weshalb sie nur ein Individuum zu senden imstande ist, das tatsächlich über die inserierten Merkmale verfügt. Solche teuren Signale (costly signals) sind fälschungssicher, weil sich nur ein Pfau, der wirklich genetisch fit ist, einen üppigen Schweif leisten kann.
Ein weiteres berühmtes Beispiel für teure Signale im Tierreich ist das Prellspringen (stotting), bei dem einige afrikanische Gazellenarten teilweise meterhoch in die Luft hüpfen, um sich nähernden Raubtieren klarzumachen, dass sie nicht leicht zu erlegen sein werden.[33] Denn die Interessen von Jägern und Gejagten sind teilweise konvergent: Keiner von beiden möchte unnötig Ressourcen verschwenden, und wenn es einen Weg für das Beutetier gibt, dem Widersacher verlässlich zu kommunizieren, dass dessen Jagdversuch scheitern wird, sind beide besser dran: der Jäger, weil er sich keine vergebliche Mühe geben muss, und die gejagte Gazelle, die sich die ermüdende Flucht sparen kann. Die Gazelle möchte nicht gejagt werden, selbst wenn sie davonkommt, und die Löwin möchte nicht jagen, wenn die Gazelle davonkommt. Das teure Signal des Prellspringens bringt diese Verhandlungsposition zustande.
Ein Markt für Zitronen: das Problem asymmetrischer Information
Sobald man den Begriff teurer Signale einmal verstanden hat, sieht man sie überall.
In den Wirtschaftswissenschaften wurde die Verfügbarkeit von Informationen zu einer der bestimmenden theoretischen Fragestellungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Kenneth Arrow und Gérard Debreu hatten in den frühen Fünfzigerjahren mathematisch beweisen können, dass das Equilibrium eines perfekt kompetitiven Marktes Pareto-optimal ist.[34] (Dies ist das sogenannte »erste Fundamentaltheorem der Wohlfahrtsökonomie«.) Das klingt einschüchternd, heißt aber eigentlich nur, dass Markttransaktionen unter bestimmten Bedingungen so lange weitergehen, bis alle durch weiteren Handel oder Tausch möglichen Verbesserungen ausgeschöpft sind. Wenn ich in einer Gruppe von hundert Menschen fünf Sorten von Schokoladenriegeln zufällig verteile und diese dann beliebig lange tauschen lasse, bis jeder seine Lieblingssorte hat, sind am Ende alle besser dran als vorher. Dieser Zustand nennt sich, nach dem italienischen Ökonom Vilfredo Pareto, »Pareto-optimal«: Ab jetzt kann niemandes Position verbessert werden, ohne die eines anderen zu verschlechtern. (Übrigens gibt es nicht nur ein Equilibrium: Wenn man mit einer anderen Ausgangsverteilung von Ressourcen beginnt, lässt sich jedes andere Equilibrium »erreichen«, das dann ebenfalls Pareto-optimal wäre. Dies ist das zweite Fundamentaltheorem der Wohlfahrtsökonomie.)
Unglücklicherweise gilt dieser mathematische Beweis nur unter höchst anspruchsvollen Bedingungen, die in der realen Welt nie ganz erfüllt sind, und eine dieser Bedingungen ist, dass alle Marktteilnehmer über vollständige Informationen verfügen. Dies ist ganz offensichtlich nie – oder so gut wie nie – der Fall, sodass die Frage entsteht, wie Märkte mit sogenannten asymmetrischen Informationen umgehen, also Situationen, in denen entweder der Käufer oder der Verkäufer eines Produkts mehr über das Produkt weiß als der jeweils andere. Dies kann zu Marktversagen führen, weil die ungünstig verteilte Information die Bereitschaft kollabieren lässt, bestimmte Transaktionen überhaupt einzugehen, selbst wenn diese für alle Beteiligten von Vorteil wären.
Dieses Phänomen nennt sich »ungünstige Selektion« (adverse selection) und ist vor allem in Versicherungsmärkten ein Problem, weil hier in der Regel diejenigen, die eine Versicherung am meisten brauchen, diejenigen sind, die am liebsten eine abschließen möchten. Eine Versicherung muss aber aus Kranken und Gesunden, aggressiven und vorsichtigen Fahrern etc. bestehen und deren Risiken zusammenlegen, weil das Modell sonst finanziell nicht tragbar ist. Deswegen kann es sinnvoll sein, junge und gesunde Menschen pflichtzuversichern, um die richtige Mischung zu garantieren. Dies wird von etwas kurzsichtigeren Liberalen manchmal als illegitimer Zwang oder Paternalismus denunziert, was aber technisch gesehen nicht stimmt: In Wirklichkeit verdankt sich diese Intervention der gleichen Logik, die auch sonst bei Marktversagen Anwendung findet, nämlich der Lösung von Kollektivhandlungsproblemen durch regulative Eingriffe, um effizientere Ergebnisse für alle zu erzielen.
Ein weiteres bekanntes Beispiel für asymmetrische Informationen ist George Akerlofs »Markt für Zitronen«.[35] Ein Gebrauchtwagen kann sich nach dem Kauf als defekt herausstellen; ein solcher »Montagswagen« wird in den USA manchmal als lemon bezeichnet, und es ist fast unmöglich für Kaufinteressenten herauszufinden, welche Autos hoffnungslos sind und welche etwas taugen. Dies kann dazu führen, dass der gesamte Gebrauchtwagenmarkt versagt, weil diese Unsicherheit dazu führt, dass die Käufer selbst für die guten Autos weniger zu zahlen bereit sind, als diese wert sind. Die Verkäufer, die wissen, dass sie einen guten Gebrauchtwagen anbieten, verlassen deshalb ganz den Markt, sodass irgendwann nur noch Zitronen angeboten werden, die überhaupt niemand mehr haben will, obwohl es eigentlich jede Menge Käufer gegeben hätte, die gerne einen guten Gebrauchtwagen gekauft hätten. Aufgrund asymmetrischer Informationen finden diese aber nicht zusammen. Es gibt keine zahlungswilligen Käufer mehr und keine Verkäufer mit soliden Produkten – der Markt kollabiert.
Jetzt wäre es hilfreich, fälschungssichere Signale senden zu können, die dem Handelspartner verlässlich kommunizieren, ob sich die Transaktion lohnt oder nicht. Dies ist im Wesentlichen die Funktion von Garantien: Der Verkäufer verspricht, das Produkt zurückzunehmen, wenn es sich als defekt herausstellen sollte – ein teures Signal, das die Qualität eines Artikels gewährleistet und kaum vorzutäuschen ist, weil sich ein Anbieter minderwertiger Produkte Garantien nicht leisten kann. Teure Signale lösen Kommunikationsprobleme und erlauben dadurch die Entstehung von Kooperation, die sonst an unvollständigen Informationen scheitern würde.