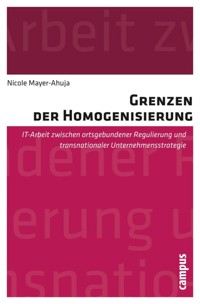22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die da oben, wir hier unten – in dieser griffigen Formel kommt das Grundgefühl einer neuen Klassengesellschaft zum Ausdruck, in der Solidarität ein Fremdwort zu sein scheint. Die Soziologin Nicole Mayer-Ahuja zeigt, wie sich Arbeit im Kapitalismus der Gegenwart verändert, wie Spaltungslinien zwischen Lohnabhängigen vertieft werden – und wo Potentiale liegen, um Unterschiedlichkeit und Konkurrenz zu überwinden und für gemeinsame Interessen einzutreten.
Mayer-Ahuja beschreibt die sich vertiefende Kluft zwischen Arbeit und Kapital, aber auch zwischen verschiedenen Beschäftigtengruppen. Deren Arbeits- und Lebensbedingungen haben sich so polarisiert, dass manche Lohnabhängige auf Kosten anderer abgesichert werden: Stammbelegschaften grenzen sich in Unternehmen von Randbelegschaften ab, prekäre Hausangestellte kompensieren die flexiblen Arbeitszeiten von «Hochqualifizierten», Frauen und migrantische Beschäftigte arbeiten überproportional im Niedriglohnsektor etc. Mit Blick auf prekäre Jobs und qualifizierte Festanstellungen fragt das Buch, welche Erfahrungen verschiedene Gruppen von Arbeitenden verbinden. Die Angst vor Arbeitsplatzverlust, steigender Leistungsdruck, Fremdbestimmung und mangelnder Einfluss auf die eigene Arbeitssituation, aber auch die Konfrontation selbst Festangestellter mit der prekären Lage ihrer Kinder oder Partnerin können Ohnmacht schüren. Oder als Ansatzpunkte für Solidarisierung dienen. Ein Buch, das zum Aufbruch in eine gerechtere Gesellschaft anregt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
NICOLE MAYER-AHUJA
KLASSENGESELLSCHAFT AKUT
Warum Lohnarbeit spaltet – und wie es anders gehen kann
C.H.BECK
Übersicht
Cover
INHALT
Textbeginn
INHALT
Titel
INHALT
1. VON DER VERLEUGNUNG ZUR WIEDERENTDECKUNG DER KLASSENGESELLSCHAFT
1.1 Die Bundesrepublik Deutschland: eine «klassenlose Gesellschaft»?
1.2 Was heißt Klassengesellschaft im 21. Jahrhundert?
1.3 Aufbau des Buches.
Teil I: WIE ARBEIT KLASSE AKTUALISIERT
2. ARBEITENDE KLASSE: PLÄDOYER FÜR EINE ZEITGEMÄSS KLASSISCHE DEFINITION
2.1 Kapital und Arbeit. Warum die Frage, wer Arbeitskraft kauft und wer sie verkaufen muss, die Gesellschaft spaltet
2.2 Lohnarbeit: Vom Zwang, die Miete zu zahlen, fremden Reichtum zu mehren und auf Anweisung zu arbeiten
2.3 Kampf aller gegen alle: Unterschiedlichkeit und Konkurrenz als Stoff, aus dem der Kapitalismus ist
2.4 Arenen der Klassenformierung: Strukturen, Beziehungen und ihre Verarbeitung in den Köpfen
2.5 Facetten sozialer Ungleichheit in der Klassengesellschaft
3. SCHON DA, WENN SIE ENTSTEHT. DIE ARBEITENDE KLASSE ALS ANALYTISCHE HERAUSFORDERUNG
3.1 Klassenformierung als Prozess: Wenn man die Geschichte anhält, sieht man nur Individuen
3.2 Klassenformierung und Ökonomie: kein Automatismus
3.3 «Wir» und unser Gegenüber: Von Interessen, Gegnerbezug und Solidarität
Teil II: ARBEITENDE ZWISCHEN EINHEIT UND SPALTUNG
4. PARADOXIEN DER VERALLGEMEINERUNG VON LOHNARBEIT
4.1 Die Ausweitung kapitalistischer Logiken als Landnahme-Prozess
4.2 Lohnarbeit für alle: Was verbindet, wirkt trennend
5. ARBEITENDE KLASSE: (AUCH) WEIBLICH UND MIGRANTISCH
5.1 Frauen: zwischen Lohnarbeit und Arbeitskraft-Reproduktion
5.2 Migrantische Beschäftigung: zwischen multipler Prekarität und betrieblichem Universalismus
6. ROHSTOFFE FÜR KLASSENFORMIERUNG IM INDUSTRIELLEN GROSSUNTERNEHMEN
6.1 Kooperation und Konkurrenz im Arbeitsprozess
6.2 Die Belegschaft und ihr Gegenüber
6.3 Verlagerung von Verantwortung «nach unten»: ein widersprüchlicher Prozess
6.4 Arbeiterschaft und Angestellte: Rationalisierung quer zur «Kragenlinie»
7. SOLIDARISIERUNG IM ZEICHEN PREKÄRER ARBEIT: HINDERNISSE UND POTENTIALE
7.1 Randbelegschaft zwischen Puffer und kollegialem «Wir»
7.2 Prekarität als Geschäftsmodell: Arbeit in Reinigungs- und Sicherheitsdiensten
7.3 Beschäftigte in Pflege und Einzelhandel zwischen Dienst am Menschen und Organisierung
Teil III: WAS TUN?
8. ANALYSE VON KLASSENFORMIERUNG: DIE ARBEIT GEHT WEITER
9. SCHRITTE ZU EINER BESSEREN GESELLSCHAFT
9.1 Spaltung überwinden durch staatliche Politik
9.2 Solidarische Politik der Arbeit: zur Rolle von Betriebsrat und Gewerkschaft
9.3 Kampf um die Köpfe: von alltäglicher Arbeitserfahrung zu Utopie
ANHANG
ANMERKUNGEN
1. Von der Verleugnung zur Wiederentdeckung der Klassengesellschaft
2. Arbeitende Klasse: Plädoyer für eine zeitgemäß klassische Definition
3. Schon da, wenn sie entsteht. Die arbeitende Klasse als analytische Herausforderung
4. Paradoxien der Verallgemeinerung von Lohnarbeit
5. Arbeitende Klasse: (auch) weiblich und migrantisch
6. Rohstoffe für Klassenformierung im industriellen Großunternehmen
7. Solidarisierung bei prekärer Arbeit: Hindernisse und Potentiale
8. Analyse von Klassenformierung: Die Arbeit geht weiter
9. Schritte zu einer besseren Gesellschaft
LITERATUR
PERSONENREGISTER
Zum Buch
Vita
Impressum
Teil I
WIE ARBEIT KLASSE AKTUALISIERT
2.
ARBEITENDE KLASSE: PLÄDOYER FÜR EINE ZEITGEMÄSS KLASSISCHE DEFINITION
Die Klassengesellschaft, in der wir leben, ist vor mehr als zwei Jahrhunderten entstanden und hat sich im Laufe der Zeit tiefgreifend verändert. Dennoch macht es Sinn, den Blick zunächst einmal auf das zu richten, was sich nicht verändert hat: auf jene weitgehend konstanten Strukturen und immer wiederkehrenden Prozesse, die es gerechtfertigt erscheinen lassen, auch im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts von Klassen zu sprechen und dabei Begrifflichkeiten zu verwenden, die vor sehr langer Zeit entwickelt worden sind. Damals wie heute haben wir es mit der Allgegenwart von Konkurrenz im Kapitalismus, mit einem strukturellen Interessengegensatz zwischen Kapital und Arbeit, mit den daraus folgenden Zwängen der Lohnarbeitsexistenz und dem widersprüchlichen Zusammenwirken verschiedener Facetten von sozialer Ungleichheit zu tun.
2.1 Kapital und Arbeit. Warum die Frage, wer Arbeitskraft kauft und wer sie verkaufen muss, die Gesellschaft spaltet
Bei Karl Marx[1] findet sich der Gedanke, dass immer dann, wenn in einer Gesellschaft mehr produziert wird, als für das nackte Überleben ihrer Mitglieder erforderlich ist, die wichtigsten Ressourcen (Marx spricht hier von Produktionsmitteln) und die Überschüsse ungleich verteilt werden. Die Gesellschaft spaltet sich in Klassen auf. Die sozialen Beziehungen, die sich daraus ergeben, stellen sich allerdings je nach historischer Periode ganz unterschiedlich dar.
Im Kapitalismus, also jener Phase menschlicher Entwicklung, die sich spätestens im 19. Jahrhundert vollständig herausgebildet hat und bis heute unser Leben prägt, werden Überschüsse auf eine besondere Art und Weise erwirtschaftet und genutzt: Es geht (wie der Name schon sagt) vor allem um «Kapital» und um dessen stetige, immer schnellere Vermehrung. Darum ist Kapitalismus ein hochdynamisches, auf permanente Expansion ausgelegtes System.
In früheren Perioden waren Dinge hergestellt und als Waren auf Märkten getauscht worden, um einen konkreten Bedarf zu decken. Dabei ging es vor allem um ihren Gebrauchswert: Ich tausche einen von mir gebauten Stuhl gegen Getreide, das von jemand anderem angebaut und geerntet worden ist, weil ich dieses Getreide für meine Ernährung brauche. Weil ein solcher Tausch aber voraussetzt, dass die Waren ungefähr denselben Tauschwert haben (äquivalent sind), können dabei keine großen Überschüsse entstehen. Ware wird gegen Ware getauscht, erleichtert durch den Einsatz von Geld als anerkanntes Zahlungsmittel. Marx bringt dies auf die kurze Formel «Ware – Geld – Ware» (W-G-W).
Mit Entstehung des Kapitalismus ändert sich das grundlegend: Der eigentliche Zweck des Wirtschaftens besteht nun darin, aus Geld (auf dem Umweg über die Warenproduktion) immer mehr Geld zu machen (kurz: G-W-G’). Geld, das auf diese Art verwertet wird, nennt man Kapital. Doch wie kann aus Geld mehr Geld werden, wenn doch weiterhin Waren mit vergleichbarem Wert ausgetauscht werden müssen, weil sich wohl niemand auf Dauer übers Ohr hauen lässt? Die Antwort liegt darin, dass die Klasse derer, die sich (wie wir in Kapitel 4.1. sehen werden) oft unter Einsatz von Gewalt besonders viele Überschüsse angeeignet hatte und nun Unternehmen gründete, zunehmend in den Kauf einer besonderen Ware investierte: in menschliche Arbeitskraft.
Wie jede Ware wird auch Arbeitskraft entsprechend ihrem Wert getauscht. Doch menschliche Arbeitskraft ist die einzige Ware, die neuen Wert schaffen kann, und zwar «mehr Wert», als zu ihrer eigenen Herstellung und Bewahrung notwendig ist. Der dadurch entstehende Mehrwert wird nicht an diejenigen ausgezahlt, die ihn schaffen, sondern verbleibt bei denen, die ihr Kapital in den Kauf der fremden Arbeitskraft investiert haben. Erst damit wird es möglich, aus Geld immer mehr Geld zu machen, also Kapital zu akkumulieren. Wie dieser Mechanismus, den Marx als Exploitation oder «Ausbeutung» bezeichnet, konkret funktioniert, wird in Kapitel 2.2. beschrieben.
Im Kapitalismus begegnen sich also zwei Klassen, deren Interessen nicht nur verschieden, sondern geradezu gegensätzlich sind. Auf der einen Seite steht das Kapital, das fremde menschliche Arbeitskraft kauft, um damit Wert schaffen zu lassen. Unternehmen sind daran interessiert, dass sich die Investition in Arbeitskraft lohnt; daher sollen Beschäftigte möglichst lang und intensiv für den Lohn arbeiten, den man ihnen zahlt. Auf der anderen Seite stehen die Arbeitenden, die von diesem Lohn abhängig sind. Sie müssen darauf achten, ihre Arbeitskraft möglichst schonend einzusetzen, da sie ein Leben lang von deren Verkauf leben müssen. Die nach wie vor dramatisch kürzere Lebenserwartung von Menschen auf den unteren Etagen der arbeitenden Klasse verweist darauf, wie aktuell das Problem der allzu rücksichtslosen Nutzung (und Vernutzung) menschlicher Arbeitskraft unter Bedingungen kapitalistischen Wirtschaftens ist.
Dieser strukturelle Interessengegensatz zwischen Kapital und Arbeit ist das wichtigste Merkmal der modernen Klassengesellschaft. Zugleich sind die beiden Seiten existenziell aufeinander angewiesen: ohne den Zugriff auf fremde Arbeitskraft keine Anhäufung von Kapital – ohne Zugang zu Lohnarbeit bzw. abhängiger Beschäftigung keine Chance, den eigenen Lebensunterhalt zu sichern, solange man nicht über ausreichendes Vermögen verfügt. Kapital und Arbeit stehen also zueinander in einem direkten, strukturell spannungsgeladenen Verhältnis. Oder präziser formuliert: Als Klassen existieren sie nicht unabhängig voneinander, sondern bedingen sich gegenseitig. «Klasse» bezeichnet also keine in sich abgeschlossene, klar abgrenzbare Menschengruppe, sondern ein soziales Verhältnis. Wie sich Kapital und Arbeit zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten räumlichen Kontext darstellen, entscheidet sich in den Beziehungen zwischen ihnen, die ganz unterschiedliche Gestalt annehmen können. Der englische Fabrikbaron des 19. Jahrhunderts, der Menschen auf Basis eines mageren Tagelohns für 12 oder 14 Stunden pro Tag schuften ließ, scheint wenig Ähnlichkeit mit dem CEO («Chief Executive Officer») in einem internationalen Konzern zu haben, der sich etwa in Deutschland (im Prinzip) an gesetzlich und tariflich festgelegte Arbeitszeiten und Entlohnungsbedingungen halten, Sozialversicherungsbeiträge zahlen, Kündigungsfristen respektieren und vielleicht sogar mit einem Betriebsrat verhandeln muss. Und doch begegnen sich in beiden Fällen Kapital und Arbeit auf Grundlage gegenseitiger Abhängigkeit und gegensätzlicher Interessen.
Gerade weil sich auch die Verhältnisse zwischen den Klassen permanent verändern, betont Marx treffend, dass die moderne bürgerliche Gesellschaft (gemeint ist hier der Kapitalismus) «kein fester Kristall, sondern ein umwandlungsfähiger und beständig im Prozess der Umwandlung begriffener Organismus»[2] sei. Klasse ist kein festgefügter Container, sondern ein dynamisches soziales Verhältnis; die Klassengesellschaft keine ahistorische Struktur; Klassenformierung ein (unter spezifischen ökonomischen, politischen und sozialen Bedingungen) immer wieder neu strukturierter und strukturierender Prozess.
2.2 Lohnarbeit: Vom Zwang, die Miete zu zahlen, fremden Reichtum zu mehren und auf Anweisung zu arbeiten
Die arbeitende Klasse, um die es in diesem Buch vor allem geht,[3] hat immer wieder ihr Gesicht verändert. Was sich hingegen nicht verändert hat, ist die Vielfalt der Tätigkeiten, die von abhängig Beschäftigten ausgeübt werden. Wie wir (in Kapitel 3 und 4.1.) sehen werden, bestand die arbeitende Klasse in früheren Perioden kapitalistischer Entwicklung aus Menschen, die in Bergwerken, in Landwirtschaft und ländlicher Heimarbeit, in Handwerk und ersten Manufakturen, aber auch in häuslichen Diensten, im Verkauf oder in Banken arbeiteten. Heutzutage umfasst die Arbeitswelt ein ähnlich weites Spektrum: So ist etwa Industriearbeit nach wie vor ein wichtiger Sektor des deutschen Arbeitsmarktes, wo neben dauerhafter, qualifizierter Facharbeit auch un- und angelernte Hilfstätigkeiten zu finden sind. Noch schillernder ist der Bereich der Dienstleistungen, der etwa Softwareprogrammierung, standardisierte Verwaltungstätigkeiten, die Pflege und Erziehung von Menschen, die Reinigung von Gebäuden oder die Lieferung von Essensbestellungen oder Paketen umfasst.
Neben der Privatwirtschaft, in der Kapital und Arbeit direkt aufeinandertreffen, hat sich (etwa durch den Ausbau der staatlichen Verwaltung sowie eines öffentlichen Bildungs-, Gesundheits- oder Transportwesens) der öffentliche Dienst als weiterer Schwerpunkt abhängiger Beschäftigung herausgebildet. Hier fungiert nicht ein nach kapitalistischen Grundsätzen wirtschaftendes Unternehmen, sondern der Staat als «Arbeitgeber». Seit den 1980er Jahren ist jedoch neben der Privatisierung vieler ehemals staatlicher Einrichtungen eine schrittweise Übertragung privatwirtschaftlicher Steuerungslogiken, etwa auf das Gesundheitssystem, festzustellen. Dadurch gleichen sich die Bedingungen, unter denen abhängig Beschäftigte in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst arbeiten, tendenziell an. Wir werden darauf (in Kapitel 7) zurückkommen.
Bei aller Buntheit und Vielfalt gibt es jedoch ein Element, das all diese Tätigkeiten verbindet: Sie werden in der Regel auf Grundlage von abhängiger Beschäftigung ausgeübt – angesichts der Verallgemeinerung von Lohnarbeit gilt das inzwischen für mehr als 90 Prozent der Erwerbstätigen (siehe Kapitel 4.1.). Damit gehen eine Reihe von Erfahrungen einher, die Mitglieder der arbeitenden Klasse teilen.
Dazu gehört zunächst der Zwang zur Existenzsicherung durch kontinuierlichen Verkauf der eigenen Arbeitskraft, der eine Entlassung oder selbst kürzere Phasen von Arbeitslosigkeit zu einer (mehr oder minder) unmittelbaren Bedrohung macht. Hintergrund ist der Umstand, dass Arbeitende im Kapitalismus, wie Marx hervorhebt, «doppelt frei» sind.[4] Auf der einen Seite konnte sich dieses ökonomische System nur deshalb herausbilden, weil mit Zurückdrängung von feudalen Abhängigkeiten und (ab Mitte des 19. Jahrhunderts) auch der Sklaverei die Zahl derjenigen zunahm, die «persönlich frei» waren, also selbst über ihre Arbeitskraft verfügen und diese auch an eine andere Partei «verkaufen» konnten. Eine Sklavin oder ein Leibeigener hat diese Möglichkeit nicht.
Auf der anderen Seite waren diese Menschen, wie Marx süffisant bemerkt, aber auch «frei» von anderen Mitteln der Existenzsicherung. Sie verfügten weder über (ausreichenden) Besitz an Land noch über andere Vermögenswerte, die es ihnen erlaubt hätten, auch nur zeitweise auf den Verkauf der eigenen Arbeitskraft zu verzichten. Die (für das bürgerliche Recht entscheidende) Annahme, dass ein Arbeitsvertrag zwischen «gleichen», also rechtlich ebenbürtigen, Parteien geschlossen wird, die «frei» sind und freiwillig handeln, ist allerdings insofern eine Fiktion, als faktisch ein strukturelles Machtgefälle zwischen Kapital und Arbeit besteht. Weil Arbeitende in der Regel um knappe Arbeitsplätze konkurrieren, können Unternehmen zwischen Bewerbern und Bewerberinnen wählen. Sie können die Investition in Arbeitskraft aufschieben, falls Arbeitende in Bezug auf Vergütung oder Arbeitsbedingungen zu hohe Ansprüche stellen. Oder sie können (zumindest in manchen Teilen der Wirtschaft) auf Arbeitskraft in anderen Weltregionen zugreifen, die «günstiger» zu bekommen ist. Wer hingegen Arbeitskraft zum «Verkauf» anbietet, hat oft nicht die Wahl, einen Job abzulehnen. Abgesehen von Phasen, in denen «Fachkräftemangel» Beschäftigte mit spezifischen Qualifikationen vorübergehend in eine günstigere Verhandlungsposition bringen kann, sind Lohnabhängige in aller Regel gezwungen, verfügbare Stellen zu akzeptieren, um ihren Lebensunterhalt zu decken. «Freie Lohnarbeit» beinhaltet daher stets ein erhebliches Maß an strukturellem Zwang. Dieser fällt umso größer aus, wenn formal «freie» Vertragsbeziehungen durch andere Formen sozialer Ungleichheit überlagert werden, wie man es etwa im Fall von Frauen und migrantischen Beschäftigten beobachten kann (siehe Kapitel 5).
Auch das, was Marx ohne moralische Aufladung «Exploitation» oder Ausbeutung nennt, verbindet abhängig Beschäftigte (wenn auch in mehr oder minder offenkundigem Maße). Wie (in Kapitel 2.1.) erwähnt, ist die Ausbeutung von Arbeitskraft die Antwort der Kapitalseite auf das Problem, wie man durch den Austausch von gleichwertigen (äquivalenten) Waren Überschüsse erzielen, also letztlich Gewinn machen und Kapital anhäufen kann. Der Schlüssel zur Lösung dieses Problems liegt im besonderen Charakter der Ware Arbeitskraft.
Grundsätzlich bemisst sich der Wert einer Ware (egal, ob es sich um einen Stuhl, um Getreide oder eben um Arbeitskraft handelt) danach, wie viel Arbeitszeit aufgewendet werden muss, um diese Ware herzustellen. Auch die Vergütung von Arbeitskraft orientiert sich an dem «Tauschwert», der sich aus den Kosten für ihre Erzeugung und ihren Erhalt ergibt. Er hängt davon ab, wie viel Aufwand zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt in einem bestimmten Land notwendig ist, um Menschen so zu ernähren, zu kleiden, unterzubringen, auszubilden usw., dass ihre Arbeitskraft auf dem Markt gehandelt werden und wiederhergestellt (reproduziert) werden kann, nachdem sie im Arbeitsprozess eingesetzt, genutzt und teilweise verschlissen worden ist. Wer nach Feierabend müde den Betrieb verlässt, weiß um die Notwendigkeit einer solchen Reproduktion – und wer auf Dauer so hart arbeitet, dass die eigene Arbeitskraft nicht (gänzlich) wiederhergestellt werden kann, erlebt, was eine «Vernutzung» von Arbeitskraft bedeutet. Eine gelungene Reproduktion von Arbeitskraft hingegen erfordert neben Schlaf und Freizeit auch die Möglichkeit, sich (etwa durch Bildung) weiterzuentwickeln, gesund zu bleiben oder zu werden, am kulturellen und öffentlichen Leben teilzunehmen und nicht zuletzt: durch die Geburt und Erziehung von Kindern neue Arbeitskraft hervorzubringen.
Auch im Fall des Arbeitsvertrags wird also formal Gleichwertiges getauscht: Arbeitskraft gegen einen Lohn, der ihrem Wert entspricht. Arbeitskraft ist aber gerade deshalb eine so attraktive Ware, weil sie die besondere Eigenschaft hat, mehr als ihren eigenen «Tauschwert» erzeugen zu können: Wenn ein Unternehmen etwa jemanden einstellt, um aus Holz, Leim und Nägeln Stühle zu produzieren, schafft diese Person zusätzlichen Wert, weil in einem Stuhl sehr viel mehr Arbeitszeit steckt als in einem frisch gefällten Baumstamm. Vor allem aber profitieren Unternehmen davon, dass Menschen an einem Arbeitstag «mehr Wert» schaffen, als ihnen in Form von Lohn ausgezahlt wird. Oder anders formuliert: Sie arbeiten über jenen Zeitpunkt hinaus, zu dem sie die Kosten ihrer Arbeitskraft erwirtschaftet haben, leisten also «Mehrarbeit». Der dadurch geschaffene Mehrwert verbleibt als Gewinn beim Unternehmen.
Das ist eine formal völlig korrekte Vorgehensweise, denn Arbeitskraft wird nach ihrem realen Wert, also den Kosten ihrer Erzeugung und Reproduktion, vergütet. Faktisch bedeutet das aber, dass aus Kapital immer mehr Kapital werden kann und Beschäftigte um einen Großteil der «Früchte ihrer Arbeit» gebracht werden, weil sie eben systematisch mehr Arbeit leisten als vom Unternehmen entgolten wird. Rosa Luxemburg hat diesen bemerkenswerten Widerspruch schon früh beschrieben: Die Akkumulation von Kapital bewege sich,
«im Fabrikraum wie auf dem Markt, ausschließlich in den Schranken des Warentauschs, des Austauschs von Äquivalenten […]. Friede, Eigentum und Gleichheit herrschen hier als Form, und es bedurfte der scharfen Dialektik einer wissenschaftlichen Analyse, um zu enthüllen, wie bei der Akkumulation Eigentumsrecht in Aneignung fremden Eigentums, Warenaustausch in Ausbeutung, Gleichheit in Klassenherrschaft umschlägt.»[5]
Wie genau sich das Verhältnis von «notwendiger Arbeit» (die der Erwirtschaftung der Reproduktionskosten dient) und «Mehrarbeit» (die sich in Unternehmensgewinnen niederschlägt) darstellt, hängt von verschiedensten Faktoren ab. Dazu gehören u.a. Konjunkturschwankungen, die Entwicklung der Kosten für die Reproduktion von Arbeitskraft (etwa in Gestalt von veränderlichen Konsumstandards) oder die Möglichkeit von Gewerkschaften, Lohnerhöhungen durchzusetzen, die Gewinnmargen schmälern.
Die Durchschnittswerte der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung verwischen zwar Unterschiede zwischen Branchen und Unternehmen, doch trotzdem lassen sie die große Veränderung erkennen, die sich hier «nach dem Boom» der Nachkriegsjahrzehnte vollzogen hat. In den Nachkriegsjahrzehnten hatten Unternehmens- und Vermögenseinkommen sowie das Einkommen aus abhängiger Beschäftigung weitgehend parallel zugenommen (siehe Abbildung 1). Teilweise stiegen die Löhne und Gehälter sogar stärker als die Gewinne. Etwa ab 1985 entwickelten sich die beiden Kurven jedoch markant auseinander. Der Graben zwischen Kapital und Arbeit vertiefte sich insofern, als die Löhne immer deutlicher hinter der Produktivitäts- und Gewinnentwicklung zurückblieben. Gewerkschaften nutzten solche Zahlen zu Recht, um ihre Kritik an Ausbeutung statistisch zu untermauern.
Abbildung 1: Entwicklung der Einkommen aus abhängiger Beschäftigung sowie der Unternehmens- und Vermögenseinkommen im Verhältnis zur Produktivität[6]
Im Arbeitsalltag hingegen ist Ausbeutung in der Regel nicht direkt erfahrbar. Für Beschäftigte ist nicht einsichtig, ab welchem Punkt sie aufhören, für den eigenen Unterhalt zu produzieren, und stattdessen Mehrwert schaffen, den sich das Unternehmen aneignet. Solange die Arbeit Spaß macht und die Vorgesetzten umgänglich sind, scheint alles in Ordnung zu sein. Und tatsächlich findet ja ein formal korrekter Tausch von Arbeitskraft gegen Geld statt, wenngleich er «wunderbarerweise» nur den Reichtum einer Seite wachsen lässt. Ausbeutung ist daher zweifellos ein Grundmerkmal von Lohnarbeit – sie konkret nachzuweisen, setzt jedoch Einsicht in die Funktionslogiken kapitalistischen Wirtschaftens und am besten auch in die Bücher von Unternehmen voraus.
Eine dritte Erfahrung, die Lohnabhängige verbindet und von ihnen sehr viel unmittelbarer erlebt wird als Ausbeutung, ist jene Fremdbestimmung, die sich daraus ergibt, dass Beschäftigte einen Großteil des Tages und ihres Lebens in einem sozialen Kontext verbringen (müssen), in dem sie sehr wenig Einfluss darauf haben, was und wie gearbeitet wird.[7] Unternehmen sind keine demokratischen Einrichtungen: Dort entscheidet nicht die Mehrheit darüber, welche Produkte hergestellt oder welche Dienstleistungen erbracht werden, wie die Arbeit organisiert oder die Hierarchie strukturiert wird, sondern letztlich die Unternehmensleitung bzw. das von ihr beauftragte Management. Beschäftigte müssen den Anweisungen von Vorgesetzten Folge leisten, weil diese das Direktionsrecht haben. Auch das ist ein Strukturmerkmal der Klassengesellschaft, findet jedoch in Diskussionen über Entwicklungen der Arbeitswelt kaum Erwähnung. Entsprechend betont Stephen Macedo in seiner Einleitung zu der Monografie «Private Regierung» von Elizabeth Anderson, «das heutige Denken über den freien Markt – unter Forschenden, Intellektuellen und Politikern» sei «blind für das Ausmaß an Willkür und nicht rechenschaftspflichtiger Macht, dem die Beschäftigten in diesem [privaten] Sektor ausgesetzt sind.»[8]
Zwar haben Lohnabhängige und ihre Gewerkschaften im Laufe der Zeit zum Beispiel in Deutschland eine schrittweise Ausweitung von «Mitbestimmungsrechten» erkämpft, die eine gewisse demokratische Kontrolle von Unternehmenshandeln durch Betriebs- oder Personalräte ermöglichen. Doch zum einen gibt es selbst in Deutschland immer weniger Betriebe mit Betriebsrat, und auch Tarifbindung spielt in wachsenden Teilen der Arbeitswelt keine Rolle mehr.[9] Zum anderen sind selbst die Einflussmöglichkeiten von existierenden Betriebsräten in Deutschland recht eng gefasst (und klammern etwa die «wirtschaftlichen Angelegenheiten» eines Unternehmens weitgehend aus).[10] Beschäftigte können daher auf jenen Teil ihres Lebens, den sie mit Erwerbsarbeit verbringen, bemerkenswert wenig Einfluss nehmen.
Zu jeder dieser Charakteristiken von Lohnarbeit (Alternativlosigkeit des Arbeitskraft-Verkaufs, Ausbeutung und Fremdbestimmung) ist sehr viel mehr zu sagen, und wir werden (in Teil II) anhand konkreter Befunde immer wieder auf sie zurückkommen. An dieser Stelle mag der Hinweis genügen, dass all diejenigen, die als «abhängig Beschäftigte» unter diesen Bedingungen tätig sind, zur arbeitenden Klasse gehören.
2.3 Kampf aller gegen alle: Unterschiedlichkeit und Konkurrenz als Stoff, aus dem der Kapitalismus ist
Kapitalismus ist ein sehr dynamisches System. Dies verdankt er nicht zuletzt dem Umstand, dass Unternehmen miteinander wetteifern, Standorte gegeneinander antreten, Nationalstaaten sich bei der Anwerbung von Investoren zu überbieten suchen – und dass auch abhängig Beschäftigte permanent konkurrieren, um Jobs, Vergütungen, Aufstiegschancen, interessante Aufgaben oder eine halbwegs verlässliche Lebensplanung. Dies beschrieb bereits Friedrich Engels in seiner immer noch lesenswerten Studie zur «Lage der arbeitenden Klasse in England»:
«Die Konkurrenz ist der vollkommenste Ausdruck des in der modernen bürgerlichen Gesellschaft herrschenden Kriegs Aller gegen Alle. Dieser Krieg, ein Krieg um das Leben, um die Existenz, um alles […] besteht nicht nur zwischen den verschiedenen Klassen der Gesellschaft, sondern auch zwischen den einzelnen Mitgliedern dieser Klassen; jeder ist dem anderen im Wege, und jeder sucht daher auch alle, die ihm im Wege sind, zu verdrängen und sich an ihre Stelle zu setzen. Die Arbeiter konkurrieren unter sich, wie die Bourgeois unter sich konkurrieren.»[11]
Daher sind auch innerhalb der arbeitenden Klasse, in den Beziehungen zwischen abhängig Beschäftigten, sei es im Betrieb, auf dem Arbeitsmarkt oder im weiteren gesellschaftlichen Kontext, Konkurrenz und Spaltung der «Normalzustand», wie Frank Deppe zu Recht betont hat.[12] Einheit und Solidarisierung sind hingegen Ausnahmeerscheinungen, die immer wieder mühsam gegen die Logik des Systems durchgesetzt werden müssen. Im besten Falle wird dabei das Verbindende zwischen Arbeitenden gestärkt, werden die Unterschiede zwischen ihnen reduziert. Doch selbst wenn eine solch solidarische Politik erfolgreich ist, sind ihre Errungenschaften stets in Gefahr, zurückgedrängt zu werden.