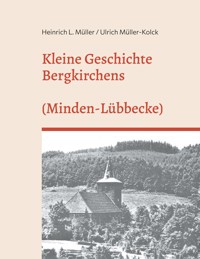
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Wohin gehen wir denn?", fragt Heinrich von Ofterdingen, als er zum Ende des gleichnamigen Romans des Dichters Novalis durch das Gebirge pilgert. Von einem Kind erhält er die einfache und doch tiefgründige Antwort: "Immer nach Hause." Auch wenn wir unsere heutige Welt in Vielem anders sehen als vormals die Romantiker, so bleibt unser Zuhause, unsere Heimat doch immer eine starke Herzenssache, deren Reiz wir uns nicht verschließen können. Für jeden von uns entwickelt die Geschichte seiner Heimat irgendwann ihre besonderen Anziehungskräfte. Die Kleine Geschichte Bergkirchens (Kreis Minden-Lübbecke) ist eine Heimatgeschichte, die mit einem weit gespannten Themenkreis die Geschichte Bergkirchens ab dem 8. Jahrhundert bis in unserer Zeit erzählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bergkirchen (1998)
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Kirchengemeinde
2.1 Entwicklung der Gemeinde im Mittelalter
2.2 Zeit der Glaubenskämpfe
2.3 Erweckungsbewegung im 19. Jahrhunderts
2.4 Kirchenkampf 1933 – 1945
2.5 Zeit nach 1945
2.6 Pfarrer in Bergkirchen seit ca. 1600
2.7 Die christliche Dichterin Käte Walter (1886 – 1985)
Baugeschichte
3.1 Widukind-Legende und erste Holzkirche
3.2 Steinbau
3.3 Innenausstattung
3.4 Orgeln
3.5 Die Glocken
3.6 Friedhof, Kirchenasyl und Feme
3.7 Kirchliche Gebäude
Schulwesen
Bergkirchen als Ortsteil
5.1 Beschreibung und Karte Bergkirchens
5.2 Wechselnde politische Zugehörigkeit
5.3 Heimat- und Verkehrsverein e.V.
Gesundheitswesen
6.1 Ärzte
6.2 Apotheke
Wirtschaft und Verkehr
7.1 Wallückebahn – „Wallücker Willem“
7.2 Erzbergbau, Steinbruch Störmer
7.3 Straßenbau
7.4 Jahrmarkt
7.5 Spar- und Darlehnskasse
7.6 Postamt
Attraktionen der Umgebung
8.1 Freilichtmuseum Detmold
8.2 Der „Wilde Schmied“
8.3 Wittekindsburg
8.4 Kaiser-Wilhelm-Denkmal
8.5 Mahnmal
Schlussbetrachtung
Kommentiertes Quellen- und Literaturverzeichnis
Register
11.1 Personenregister
11.2 Ortsregister
1 Einleitung
Über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren sammelte Heinrich L. Müller heimatkundliches Material über Bergkirchen, dessen Kirche die Älteste im Kreis Minden-Lübbecke ist und deren Anfänge in das 8. Jahrhundert bis zu einem alten germanischen Quellheiligtum zurückreichen. Einen Teil dieses Materials veröffentlichte Hansjürgen Kochanek in den 1990er Jahren im Bad Oeynhausener Lokalteil des Westfalen Blattes. In loser Folge schrieb der Redakteur dieser in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung eine Reihe von Artikeln, die an das alte Leben im Kirchspiel Bergkirchen erinnerten. Jedoch gab es keine übersichtliche und kompakte Zusammenfassung der Bergkirchener Geschichte, die das Geschehene erzählt hätte ohne übergroßen Drang zu historischen Details, die einfache Leser wie uns oft überfordern. So entstand die Idee zu dieser „kleinen“ Geschichte Bergkirchens.
Heinrich Müller sichtete sein Archiv und wählte das Material aus, das am Ende im Quellen- und Literaturverzeichnis aufgeführt ist. Wir haben ein kommentiertes Verzeichnis angelegt, weil es für weitergehende Interessen den Einstieg erleichtert.
Unser Text beginnt mit der Geschichte der Kirchengemeinde Bergkirchen. Mit ihrer Entwicklung eng verbunden ist die Geschichte des Schulwesens. Die schon vorliegenden Aufsätze zur Kirchen- und Schulgeschichte von Fritz Klausmeier und Hermann Hevendehl sind erschöpfend und dienten uns als wichtige Orientierung. Die Baugeschichte der Kirche und kirchlichen Gebäude handeln wir in einem gesonderten Kapitel ab. Außerhalb der Kirchengemeinde ging das Leben aber auch weiter. Gerade ab dem 19. Jahrhundert vollzogen sich in Bergkirchen Veränderungen, die in einer Ortschronik nicht fehlen dürfen. So wurden die Themen Gesundheitswesen, Wirtschaft und Verkehr hinzugenommen. Da Bergkirchen seit der Erfindung der Mobilität Ausflugsziel für Wanderer und Liebhaber des Wiehengebirges war und geblieben ist, informiert ein kurzes Kapitel über die Geschichte der Attraktionen der Umgebung.
Den Text formulierte Ulrich Müller-Kolck. An Stellen, an denen wir selbst häufiger in Geschichtsbüchern nachschlagen mussten, haben wir diese Fakten eingefügt, weil sie das Verständnis der lokalen Ereignisse in der Heimat erleichtern.
Das Ergebnis ist eine ereignishistorische „Kleine Geschichte Bergkirchens“, mit der man sich, wie wir hoffen, schnell über die Heimatgeschichte des nahen und persönlichen Erfahrungsbereiches informieren kann. Maßstäbe, wie sie an professionelle Arbeiten zur Regionalgeschichte oder zur heimatkundlichen Forschung angelegt werden, können wir als Laien, die sich in ihrer Freizeit der Heimatgeschichte widmen, nicht erfüllen. Unsere Geschichte kann und will keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Auch deshalb wählten wir bewusst den Titel „Kleine Geschichte Bergkirchens“. Wir hoffen aber, dass die Leserinnen und Leser in ihr das finden, was ihnen wichtig ist, und wir sind sicher, dass sie einiges über ihre Heimat entdecken, womit sie nicht gerechnet haben und worüber sie sich besonders freuen.
2 Kirchengemeinde
In Bergkirchen steht die älteste Kirche der Region. Sie begründet die historische Bedeutung dieses Ortes als christliches Zentrum, das auf einem alten germanischen Quellheiligtum entstand. Die Entwicklung der Gemeinde sehen wir in vier großen Abschnitten. Bereits mit Beginn der Missionsgeschichte in Westfalen wurde Bergkirchen im Mittelalter als Missionskirche aktenkundig. Wichtige Etappen waren die Reformation, die Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert und die Zeit des Kirchenkampfes während des Dritten Reiches.
2.1 Entwicklung der Gemeinde im Mittelalter
Die Missionsgeschichte Westfalens begann 691. In diesem Jahr kamen zwei irische Missionare ins Münsterland, um die angelsächsische Mission auf dem Festland fortzusetzen. Die Verbreitung des christlichen Glaubens unter den Sachsen vollzog sich auch hier mit militärischen Mitteln und erzeugte heftige Gegenwehr unter der Führerschaft des einheimischen Adels.
Der religiöse Kult der Sachsen mit dem Hauptgott Wodan oder Odin, den Göttern Donar, Saxnot, dem Genossen der Sachsen, sowie zahlreichen Nebengöttern stand in enger Verbindung mit dem Adelspersonal. Gerade im Kampf galt der adlige Anführer als ein von den Göttern beseelter Priesterfürst mit magischen Kräften. Ihre letzte herausragende Führungsfigur war Widukind, der auch Wittekind genannt wird, und dessen Person die Verbindung mit dem späteren Bergkirchen herstellte.
Im Kampf gegen das anrückende Christentum führte Widukind von 777 bis 785 den Widerstand gegen Karl den Großen. Der fränkische König Karl, der mit 21 Jahren den Thron bestieg, eroberte 775 die Sigiburg über der Ruhr und Lenne und überquerte bei Höxter die Weser. Die unterworfenen Sachsen, die zum Frieden bereit waren, sammelten sich an den Paderquellen, dem Gründungsort des späteren Paderborn, um sich taufen zu lassen. Zum Zeichen seiner Macht ließ Karl eine Karlsburg errichten, hier fand auch 777 der erste Reichstag auf sächsischem Boden statt. Karl gelang es aber nicht, Widukind zu fassen. Der entkam zunächst nach Dänemark und formierte den sächsischen Widerstand neu. Erst nachdem Karl die Widerständigen bis an die Elbe verfolgt hatte, musste sich Widukind der Übermacht des Kaisers geschlagen geben. Er kapitulierte und ließ sich 785 in Attigny taufen, nachdem der Realpolitiker Karl ihm Straffreiheit und ein auskömmliches Amt in seiner Reichsverwaltung versprochen hatte. Wie bedeutsam die Kapitulation Widukinds für die Machtpolitik der Kirche war, lässt sich daran ablesen, dass im Jahr 786 Papst Hadrian für die gesamte christliche Welt ein dreitätiges Dankfest aus Anlass der Bezwingung und Taufe Widukinds ausrufen ließ.
Die Person Widukinds aber auch die Region Westfalen insgesamt verschwanden damit allerdings für lange Zeit von der historischen Bühne. Widukind verbrachte den Rest seines Lebens als Graf im fränkischen Staatsdienst. Er liegt in der Stiftskirche in Enger begraben. Zumindest werden die dort gefundenen Überreste eines ungefähr 60 Jahre alten Mannes mit Rückenschaden als seine leiblichen Überreste angesehen. Widukind war zu Lebzeiten nachweislich durch einen Sturz vom Pferd schwer verletzt worden.
Der alte Naturglaube hielt sich aber sehr lange und es ist nicht anzunehmen, dass alle Anhänger Widukinds sofort ihren Glauben wechselten. Zu sehr waren sie an die alte, von ihren Ahnen überlieferte Kultpraxis gewöhnt. Unsicher war außerdem, welche Vorteile der neue Glaube tatsächlich bringen würde. Den Umfang der damaligen Kultpraxis zeigte ein altsächsisches Taufgelöbnis, in dem aufgezählt wurde, was der Getaufte in Zukunft auf keinen Fall tun durfte. Streng verboten waren Totenopfer, Totenmähler auf den Gräbern der Verstorbenen, Totenbeschwörungen, Donar- oder Wodanopfer, Amulettglaube, Quellen- und Hainkulte, Zaubersprüche und Mantik, Los- und Rauchorakel, Notfeuer, Wetterzauber, Pflug- und Laufrituale, Ahnen- und Heroenkult, Götterbilder und Votivgaben, Hexenglauben. Obwohl die Vorschriften Karls des Großen harte Strafen androhten, lebte die alte Glaubenswelt heimlich weiter.
Über die Entwicklung der Gemeinde Bergkirchen im Mittelalter ist nicht viel überliefert und unsere heutigen Kenntnisse stützen sich auf wenige historische Fragmente. Die Kirchengemeinde war mit einem Pfarracker ausgestattet, der dem Lebensunterhalt des Geistlichen diente. Das Pfarrland stammte von einem Grundherrn, dessen Namen heute nicht mehr bekannt ist. Es muss ein ziemlich großes Stück Land gewesen sein, denn aus den später angelegten Kirchenbüchern ist noch zu erkennen, dass ungefähr 80 Morgen Land am Stück zur Pfarre gehörten.
Der Stelleninhaber der Pfarre war dem Grundherren abgabenpflichtig. Diese Abgabepflicht wechselte irgendwann an das Stift Borghorst im Münsterland, das 968 gegründet worden war. Der Grundherr verschenkte offenbar zu jener Zeit Land an das Stift. Für das Stift Borghorst gehörten diese Ländereien und Höfe zum Amt Wolberdingsen, in der damaligen Sprache Villikation Wolberdingsen, später wurden sie auch Mindische Güter genannt. Höfe und Bauernschaften der Villikation Wolberdingsen gehörten damit zum Grundkapital des Stiftes Borghorst und standen in den Listen der Abgaben an die Stiftsdamen. In diesem Güterverzeichnis tauchte auch der Pfarrhof zu Bergkirchen auf. Hinsichtlich der weltlichen Ordnung gehörte der Pfarrer in Bergkirchen also zum Amt Wolberdingsen. Von dort war er mit seinem Pfarrland ausgestattet worden, und er entrichtete seine Abgaben an die Stiftsdamen in Borghorst. Hinsichtlich der geistlichen Ordnung gehörte er dagegen zum Bistum Minden. Die Abgaben nach Borghorst erfolgten noch bis zum Ende des 30jährigen Krieges, als Bergkirchen schon viele Jahre evangelisch war.
Gehen wir noch einmal zurück in die Zeit des späten Mittelalters. In diese Zeit fällt die Trennung Volmerdingsens von Bergkirchen. Anfangs war Volmerdingsen eine Kapellenkirche von Bergkirchen und wurde auch vom Bergkirchener Pfarrer betreut. In der Sprache der Kirchenverwaltung war Bergkirchen eine Parochialkirche des Bistums Minden. In der damaligen Kirchenorganisation gehörte das Kirchspiel Bergkirchen eine Verwaltungsstufe tiefer zum Archidiakonat Lübbecke. Im 14. Jahrhundert wurde Volmerdingsen selbstständig und gehörte von da an als eigenständige Kirchengemeinde zum Archidiakonat Rehme.
Eine neue selbstständige Kirchengemeinde zu schaffen, war auch damals keineswegs nur ein einfacher Verwaltungsvorgang, der quasi mit einem Federstrich zu erledigen gewesen wäre. Entscheidend war die Frage, ob der Pfarrer auch von der neu geschaffenen Pfarrstelle leben konnte. Das bedeutete, dass er mit Pfarrland für seinen Unterhalt ausgerüstet werden musste. Über diese Frage verständigten sich vermutlich die Edelherren von Hausberge mit dem Bischof zu Minden. Die Hausberger besaßen einiges Land in Volmerdingsen. Als Bischof Otto III. von Minden 1397 als letzter der Edelherren von Hausberge starb, fielen 46 Höfe mit 116 Morgen Land an das Domkapitel in Minden. Es ist daher anzunehmen, dass die Hausberger das nötige Pfarrland für den Geistlichen zur Verfügung stellten. Das Land war aber nicht eine zusammenhängende Ackerfläche wie in Bergkirchen, sondern verteilte sich auf mehrere verstreut liegende Felder. Die Höfe der Hausberger Grundherren lagen ebenfalls verstreut und ihr Grundbesitz mischte sich mit den Höfen der Villikation Wolberdingsen, was dazu führte, dass nicht die lokale Nähe zur Kirche sondern der Grundherr entschied, zu welcher Kirche die Menschen gehen mussten. Dieser Grenzverlauf führte dazu, dass die Menschen einzelner Höfe (z. B. von Hedingsen bis Schnedingsen) nicht nach Volmerdingsen sondern nach Bergkirchen zur Kirche gingen, obwohl sie ganz in der Nähe der Volmerdingser Kirche wohnten. War diese Raumordnung anfangs nebensächlich, entwickelte sie sich in späterer Zeit, besonders aber mit der Bildungsoffensive der Reformation und den neuen Gemeindeschulen zu einem Konfliktstoff für die Eltern, die ihren Kindern nicht die unnötig langen Schulwege zumuten wollten, die sich nur durch die historisch gewachsene Kirchenzugehörigkeit ergaben.
Aus der vorreformatorischen Zeit in Bergkirchen ist nur wenig bekannt. 1393 war Johannes de Hokelve Pfarrer in Bergkirchen. 1445 war Gerd Ruwe Kirchherr in Bergkirchen, denn es wird überliefert, dass in diesem Jahr der Dechant an der St. Andreas Kirche in Lübbecke, Richard von dem Rode, die so genannte Sneckenershove in Nettelstedt an ihn verkaufte. 1450 war Gerd Smeding Kirchherr in Bergkirchen, denn aus den Kaufbelegen geht hervor, dass Richards Sohn, Albert von dem Rode, denselben Hof an ihn verkaufte. Der Domherr Heinrich Tribbe erwähnt Bergkirchen 1460 in seiner Beschreibung von Stadt und Stift Minden und erwähnt Haddenhausen als den zugehörigen Wohnplatz. Nach dem Bistumskatalog von 1509 gehörten zur Kirchengemeinde Bergkirchen damals: „Ober- und Unterlübbe, Wulverdingsen, Rothenuffeln, die Kolonien Biemke, Lettern (Luttern), Barenstock, Schürbusch, Ellerbusch, Hermsmeier (Liliensiek), Lohof, Meinte, Maschweg, Wallücke, Elftermühle, Bergmühle, Eiksen, Winthof, Heide, Rothenuffeln Mühle, Griepshop, Hiverdingsen, Stelzenkrug, Ellernstraße, Köhling, Köhlte, Köhlterholz, Rittergut Haddenhausen und Höfe.“ Damit wurde eine recht große Fläche südlich und nördlich des Berges umrissen (vgl. Karte). In der Zeit um 1450 hieß der Burgherr in Haddenhausen Ludolf von Münchhausen (Mönnighausen).
Kirchspiel Bergkirchen nach dem Bistumskatalog 1509 (Zeichnung: A. Kolck)
2.2 Zeit der Glaubenskämpfe
Die Reformation gelangte über die Klöster der Augustiner-Eremiten in Herford, Osnabrück und Lippstadt nach Westfalen. Der Osnabrücker Prior Gerhard Hecker war ein treuer Anhänger seines Ordensbruders Martin Luther (1483 – 1546). Luther hatte ja auch seine theologische Laufbahn mit dem Eintritt in ein Kloster der Augustiner-Eremiten, nämlich in Erfurt, begonnen. Hecker überzeugte seinen Herforder Ordensbruder Johannes Dreier von der neuen Lehre. Dreier wiederum hatte Einfluss auf das Fraterhaus und gewann den Fraterherrn Jacob Montanus für den neuen Glauben. Montanus genoss hohes lokales Ansehen und wurde zu einer der Leitfiguren der Reformation in Westfalen. Das erste evangelische Buch Westfalens, eine Fastenpredigt, ließ 1524 der Lippstädter Augustiner-Eremit Johannes Westermann drucken, der bei Luther in Wittenberg studiert hatte. Schnell verbreiteten sich die Gedanken der Reformation im Hochstift Minden.
Zu Unruhen oder Gewalttaten, wie sie in anderen Gegenden den Glaubenskampf heftig begleiteten, kam es in Westfalen nur vereinzelt in Osnabrück und Minden. Als Verteidiger des katholischen Glaubens trat hier Johann von Münchhausen hervor, der seit 1500 in Haddenhausen ansässig war. Wiederholt griff er zwischen 1525 und 1528 das Hochstift Minden an und zerstörte bei einem dieser Überfälle das Haus Rodenbeck. 1530 reagierten die Mindener und belagerten Haddenhausen. Sie beschossen vier Tage lang die Burg, ließen dann das Wasser aus dem Wassergraben ab und eroberten die Burg. Johann von Münchhausen und seine drei Söhne kamen in Gefangenschaft. Ihr Haus brannte nieder. Nach seiner Freilassung 1540 verklagte von Münchhausen die Mindener wegen ihres Überfalls auf Haddenhausen beim Kaiserlichen Kammergericht. Dem Herzog von Jülich, der hoheitlich zuständig war, wurde der undankbare Fall zugewiesen. Er konnte aber trotz einer Anhörung des Klägers in Hamm keine Entscheidung herbeiführen. Die Streitereien zwischen von Münchhausen und den Mindenern bestanden noch bis 1553 fort.
Der Augsburger Religionsfrieden 1555 führte vorerst zum Waffenstillstand der Konfessionen. Mit dem „jus reformandi“ erhielten die Landesfürsten das Recht, in ihren Ländern das Bekenntnis der Bevölkerung zu bestimmen. Sie durften Stifte und Klöster reformieren. Für die Lutheraner begannen bessere Zeiten, während die Anhänger Zwinglis und Calwins, die als Reformierte bezeichnet wurden, weiter unter Verboten litten.
In Haddenhausen waren diese Änderungen der Kirchenpolitik ebenfalls zu spüren. Christopf von Münchhausen, ein Sohn Johanns, verschuldete sich bei dem Versuch, Ländereien zurückzukaufen derart, dass er nach Lettland zu seinem Bruder auswanderte. 1558 übernahm Heinrich von Münchhausen, ebenfalls ein Sohn des alten Johann, das Gut Haddenhausen. Heinrich verkaufte es dann an Kurt von Münchhausen-Schöbber, der das Schloss 1612 bis 1614 von dem Hamelner Baumeister Cort Tönnies im Stil der Weserrenaissance ausbauen ließ. Der nächste Besitzer des Gutes wurde der Schwager, Johann von dem Busche, der 1640 im Besitz von Haddenhausen war.
Die Edelleute von Haddenhausen übten das Patronatsrecht über die Kirche und die Schule in Bergkirchen aus. Damit entschieden sie über die Einstellung von Predigern und Küstern, die als Lehrer tätig waren. Fritz Klausmeier erwähnt in seiner „Bergkirchener Geschichte“ den Prediger Johann Plötzker als den ersten Lutheraner in Bergkirchen, allerdings fehlen genaue Zeitangaben. Viele Dokumente aus dieser Zeit sind während des Dreißigjährigen Krieges (1618 – 1648) zerstört worden.
Noch unter der Familie von Münchhausen-Schöbber war 1639 Erich Spilker als Prediger tätig. Zusammen mit Diedrich Staels, Pastor in Eidinghausen, wird sein Name bereits 1612 erwähnt. Spilker bewirtschaftete den Pfarrhof in Bergkirchen, der ungefähr 80 Morgen Land am Stück umfasste und über die Villikation Wolberdingsen dem Kloster Borghorst im Münsterland abgabenpflichtig war. Anfang des 14. Jahrhunderts umfassten die Abgaben Hafer (I malt avene), 8 Scheffel Weizen (octo modios siliginis), Schaf (ovem), Lamm (agnum) und Leinen (XV boten lini). 300 Jahre später mussten immer noch 8 Scheffel Hafer jährlich abgeliefert werden, obwohl die Gemeinde um 1600 bereits evangelisch war. Verursacht durch die Wirren des 30-jährigen Krieges erfolgten die Abgaben aber unregelmäßig oder gar nicht mehr. 1633 besetzten die Schweden Minden und übernahmen die Verwaltung des Fürstbistums. Der letzte Fürstbischof von Minden, Franz Wilhelm Graf von Wartenberg, der die Rekatholisierung Mindens durchsetzen wollte, wurde vertrieben. Die Schweden hatten kein Interesse daran, Naturalien und Geld ins katholische Münsterland zu zahlen. Ein Borghorster Protokoll erwähnt aber Spilker, der auch unter der Herrschaft der Schweden noch preußisch korrekt seine Abgaben nach Bockhorst schickte: „1639 war in der Pfarrei Bergkirchen ein großer Hagelschlag. Erich Spilker, Pastor in Bergkirchen, gibt Habern 8 Scheffel.“ Selbst nach dem Tode Spilkers 1647 liefen die Abgaben weiter. Noch mit Datum 1652 werden „8 Scheffel Haberen aus der Pfarr Berchkirchen“ registriert. Anton Beneke, der Nachfolger von Spilker im Pfarramt, stellt die Zahlungen nach Borghorst dann aber unter der jetzt wieder preußischen Regierung ein. Die Borghorster Stiftsdamen beauftragen zwar einen Kanoniker des Martini-Stifts in Minden, Beneke an seine Abgabenpflicht zu erinnern, vermutlich hatten sie aber damit keinen Erfolg. Als 1650 Superintendent Julius Schmidt die Bergkirchener Gemeinde besuchte, verschwieg ihm Beneke einfach die alte Verpflichtung gegenüber dem Kloster Borghorst. Mit Datum vom 3. November 1659 wird der Hof Spilker – der Name seines Nachfolgers Beneke wird gar nicht mehr erwähnt – in einer Inventarliste des Stiftes Borghorst zum letzten Mal geführt. Die Chefin des Klosters, Pröpstin Barbara von Plettenberg, stellte sie anlässlich des Verkaufs des Amtes Wolberdingsen zusammen. Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der nun über das Fürstentum Minden verfügte, kaufte das „Amt Walberinghausen“ für 325 Reichstaler. Der Kurfürst versprach dabei aber auch, dass die Höfe des Amtes Wolberdingsen bis zu diesem Zeitpunkt fehlende jährliche „intraden“ und „einkommen“ an das Kloster Borghorst nachzahlen sollten. Mit dem Jahr 1659 endete damit die Verbindung zwischen dem Pfarrhof in Bergkirchen und dem katholischen Damenstift in Borghorst.
Durch diesen Exkurs in die alten Besitzverhältnisse in der Zeit etwas vorausgeeilt kommen wir nun aber zurück zur Kirchengeschichte in Bergkirchen.
Nach dem Tod Spilkers 1647 schlug Lucia von dem Busche zu Haddenhausen als Nachfolger ihr Patenkind Anton Beneke vor, der zuvor Hausprediger in Haddenhausen gewesen war. Seine Einstellung wurde 1647 vom Mindener Domprobst Johan Hinrich von Vinke unterschrieben. Die Wirren des Dreißigjährigen Krieges, der als Glaubenskampf begann und in einem europäischen Krieg der politischen Kräfte um die Macht endete, spiegeln sich auch in Benekes Lebenslauf wider. 1601 in Arzten geboren verbrachte er seine Kind- und Jugendjahre an unterschiedlichen Orten in Westfalen, studierte dann 1624 in Wittenberg, 1625 in Jena, 1626 in Straßburg und ab 1627 wieder in Wittenberg. 1628 lehnte er einen Ruf auf das Diakonat in Coburg ab und wurde Hausprediger in Schwöbbern. Dort blieb er aber nur ein Jahr, um anschließend nach Schweden auszuwandern. Von dort kam er mit der Armee Gustav Adolfs II., in der er ab 1631 als Feldprediger tätig war, nach Deutschland zurück. Seine Tätigkeit als Militärprediger führte ihn bis nach Frankreich. Nach Bergkirchen kam er über die Stelle als Hausprediger in Haddenhausen.
Während seiner Amtszeit brannte das neu gebaute Pfarrhaus 1653 komplett ab. Beneke selbst war in dieser Zeit schwer krank. Nur wenige Bücher wurden gerettet. Als nach dem Westfälischen Frieden 1648 das Fürstbistum Minden säkularisiert worden war, erfolgten durch die neue brandenburgische Kirchenleitung Visitationen, die von einem Superintendenten geleitet wurden. Erster Superintendent in Minden war Julius Schmidt, der noch 1646 von den Schweden eingesetzte Pfarrer aus Petershagen. Er wurde 1650 von den Preußen in seinem Amt bestätigt. Am 29. Oktober 1650 kam er nach Bergkirchen. Beneke verhielt sich hinsichtlich seiner Auskünfte vorsichtig und der Verpflichtung, ab 1650 ein Kirchenbuch zu führen, kam er wohl nicht nach. Beneke wirkte bis 1669 in Bergkirchen und wurde von seinem Sohn Hilmar abgelöst.
Hilmar Beneke war von 1669 bis 1706 im Amt. Aus seiner Amtszeit stammt die erste erhaltene Kirchenchronik, mit der er am 7. Dezember 1670 begann. Kirchenchroniken waren kontinuierlich und streng chronologisch geführte Aufzeichnungen, die von den Pfarrern, später auch von den Küstern und Lehrern vorgenommen wurden. In ihnen wurden alle wichtigen Ereignisse der Gemeinde festgehalten, wie die Zahl der Geburten und Taufen, der Eheschließungen (Copulationen), Konfirmationen, Beerdigungen oder besondere Ereignisse zu bestimmten Festtagen. Sie enthalten daher auch wichtige Begebenheiten der Ortsgeschichte. Die Bergkirchener Kirchenchroniken beginnen im Jahr 1670/71.1Neben den Themen der Kirchenadministration spiegeln sie die wirtschaftliche Situation der Gemeinde wider. Zu notorischen Geldmängeln durch die wirtschaftlich schweren Zeiten kam in Bergkirchen noch die exponierte Lage des Kirchengebäudes oben auf dem Berg, durch die es der rauen Witterung verstärkt ausgesetzt war und mit häufigen Wetterschäden und Baumängeln die Finanzen der Bergkirchener noch mehr belastete. Die Chroniken beschreiben den ständigen Kampf der Pfarrer um das Geld für nötige Sanierungen, Reparaturen der Kirche oder des beschädigten Pfarrhauses aber auch für die Finanzierung der eigenen Existenz.
In die Zeit um 1670 fällt auch ein Bericht im ersten erhaltenen Kirchenbuch, der von einem Pranger vor der Kirche in Bergkirchen erzählt. Der Pranger stand vor dem Haupteingang der Kirche. Er wurde Fluchpfahl genannt. An ihn wurde das Gemeindemitglied, das bestraft werden sollte, angebunden und während des Gottesdienstes dem Gespött der Kirchgänger überlassen. Das Fluchen wurde offenbar besonders hart bestraft. Der Schandpfahl gehörte früher zu den gebräuchlichen Strafmaßnahmen der Kirche. Ob davon in Bergkirchen viel Gebrauch gemacht wurde, ist nicht bekannt. Lediglich eine kurze Liste der Sünder ist erhalten geblieben:
„1. Am Fluchphal gestanden Paul Korth hinterm Brehenhagen (Kolonie), weil er beim Wetter Gottes geflucht.
2. Zwey am Fluchpfahl gewesen, nemlich Frau au der Schmalmke (Kolonie), weil sie ihren Kindern die Sucht an den Hals gewünscht,
3. und eine aus Mennighüffen Kirchspiel, die da den Teufel einem (oder einer) angewünscht.
4. Sonntag am Fluchpfahl gestanden Johann in Kosiek (Kolonie) der einem Nachbar geflucht.“2
Pfarrer Beneke berichtet auch von einem militärischen Kollateralschaden des Niederländisch-Französischen Krieges (auch Holländischer Krieg), der von 1672 bis 1678 in Europa von den Franzosen (Ludwig XIV) gegen die Vereinigten Niederlande geführt wurde und in dem das Königreich England, Schweden, das Hochstift Münster und Hochstift Lüttich mit Frankreich verbündet waren. Beneke berichtet auch, wie die Kirche am 18. Juni 1679 von französischen Soldaten überfallen worden sei (vgl. auch Kapitel Innenausstattung).3
Der Nachfolger von Pfarrer Hilmar Beneke wurde der aus Clausthal am Harz stammende Pfarrer Georg Andreas Sauerbrey. Er wirkte von 1706 bis 1741 in Bergkirchen. Unter seiner Leitung wurde eine größere Reparatur der Kirche durchgeführt. Eines seiner Schreiben an die Baubehörde lässt den Umfang der Arbeiten erkennen. Darin stellte er einen Kostenvoranschlag für die geplanten Umbauten zusammen: 2 Maurer für 4 bis 5 Tage, 10m Latten, 400 gute Dachsteine, 6 Ballen Kalk, 10 Reichstaler Unkosten. Wegen seiner Verdienste wurde er 1740 zum Ende seiner Dienstzeit zum Inspektor über sechs Pfarren bestellt: Bergkirchen, Volmerdingsen, Eidinghausen, Löhne, Gohfeld und Mennighüffen.
1741 übernahm sein Sohn Georg Heinrich Sauerbrey das Amt vom Vater. Während seiner Zeit brannte 1751 die Kirche ab und so war auch er mit dem Neu- und Erweiterungsbau beschäftigt. Vermutlich wegen mangelhafter Bauaufsicht wurde der Wiederaufbau viel teurer als geplant. In der Not half Sauerbrey der Gemeinde mit einem großzügigen Darlehen von 740 Talern. Das Geld sah er allerdings nicht wieder. Bis zum Ende seiner Amtszeit 1773 gelang es der Gemeinde nicht, das Darlehen zurückzuzahlen. Dieses Defizit führte in der Folgezeit zu vielen Briefwechseln und Verhandlungen seiner Nachfolger mit der Gemeinde und der Mindener Kirchenverwaltung.
Übergangsweise vertrat Pastor Quade, der Schwiegersohn Sauerbreys, die Pfarrstelle in Bergkirchen. Obwohl er sich auch beworben hatte, wurde er nicht genommen. Statt seiner trat 1773





























