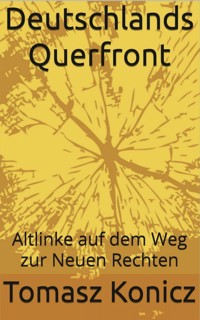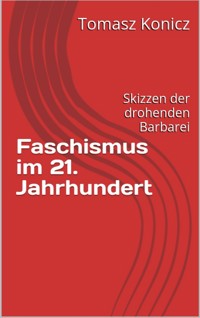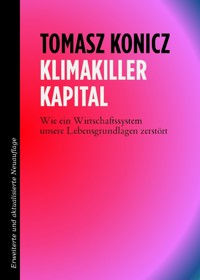
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Angesichts der eskalierenden Klimakrise bricht sich in der Öffentlichkeit der meisten Industrieländer mühsam, allen Widerständen zum Trotz, eine fundamentale Erkenntnis bahn: Nichts wird so bleiben, wie es ist. Es ist ein grundlegender, fundamentaler Wandel notwendig, um den sich beschleunigenden klimatischen Umbrüchen, dem drohenden Kollaps ganzer Ökosysteme adäquat und schnell begegnen zu können. Die Klimakrise muss folglich als die größte Gefahr für den Zivilisationsprozess im 21. Jahrhundert begriffen werden. Das, was sich vor allem ändern muss, ist unsere Gesellschaft, so die Kernthese dieses Buches. Der von inneren Widersprüchen getriebene Kapitalismus muss radikal infrage gestellt werden. Das Kapital ist in seinem Verwertungszwang einerseits die Ursache der Klimakrise, es verstärkt aber auch die gesellschaftlichen Folgen des Klimawandels. Die Unvereinbarkeit von Kapital und Klimaschutz lässt die Überwindung der destruktiven kapitalistischen Wirtschaftsweise zu einer Überlebensnotwendigkeit der Menschheit im 21. Jahrhundert werden. Wir müssten somit von einer kapitalistischen Klimakrise sprechen. Diese zweite Auflage des ursprünglich 2020 publizierten Buches wurde umfassend erweitert und aktualisiert. Ein ganzes Kapitel, Opportunismus in der Klimakrise, ist hinzugekommen, in dem Krisenblindheit, ideologische Verblendung und sozialdemokratischer Karrierismus in der Linken und der Klimabewegung kritisiert werden. Etliche neue Texte ergänzen die Kapitel über die kapitalistische Selbstzerstörung und die Wechselwirkung von Klima- und Wirtschaftskrise. Die Einleitung und das Kapitel zur Transformationspraxis in der manifesten Klimakrise sind überarbeitet worden. Das Buch bietet somit wieder einen guten Überblick über das komplexe Themenfeld der kapitalistischen Klimakrise.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltserzeichnis
Inhaltserzeichnis
Impressum
1. Einleitung
2. Wirtschafts- und Klimakrise: Zwei Momente spätkapitalistischer Widerspruchsentfaltung
2.1 Systemkrise: Rückblick und Ausblick
2.2 Fetischismus: Die Selbstbewegung des Kapitals
2.3 Die Weltvernichtungsmaschine: ökologische Grenzen des Kapitals
2.3.1 Exkurs: Green New Deal als gangbare Sackgasse
2.4 China und die ökologische Unmöglichkeit nachholender Modernisierung
2.5 Schuldenberge im Klimawandel
2.6 Klimakrise und Inflation
2.7 Von ökologischen und ökonomischen Sachzwängen
2.8 Häuschen mit Katastrophenblick
3. Kampf um das Klima
3.1 Die große Klimaverschwörung
3.2 Keine Gnade für Klimaschänder?
3.3 BRD: Klimapolitischer Schwindel für Fortgeschrittene
3.4 Wissenschaft: Immer zu spät?
3.5 Beruhigungspillen - Kapitalismus mit menschlichem Antlitz
3.6 Die Neue Rechte und die Klimakrise
3.6.1 Exkurs zu Malthus
3.7 Die Politisierung des Wetters
4. Kapitalistische Selbstzerstörung
4.1 Katastrophenkapitalismus – marode, labil, krisenanfällig
4.2 Das globale Agrarsystem – Wahnsinn mit Methode
4.3 Imperialismus im Klimawandel
4.4 Alles muss in Flammen stehen - apokalyptische Religionsunternehmer und Kapitalismus als Religion
4.5 Hitzetod in der Klimakrise
4.6 Nachhaltig Plündern
4.7 Sackgasse Elektromobilität
4.8 Ruhm und Ähre
5. Opportunismus in der Klimakrise
5.1 Der linke Blödheitskoeffizient
5.2 Rockin' like it's 1917
5.3 Rebranding des Kapitalismus
5.4 Unwort Klimagerechtigkeit
6. Jenseits der Apokalypse - Wege in den Postkapitalismus
6.1 Keine Enteignung ist auch keine Lösung?
6.3 Postkapitalismus ohne Verzicht
6.4 Was tun angesichts der kapitalistischen Klimakrise?
7. Epilog unter den Sternen
Impressum
Impressum © 2024 Tomasz Konicz
Tomasz Konicz
Glimmerweg 21
30455 Hannover
Alle Rechte vorbehalten
Kein Teil dieses Buches darf ohne ausdrückliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, fotokopiert, aufgezeichnet oder auf andere Weise übertragen werden.
1. Einleitung
Wie lebt es sich in einer Zeitlupenapokalypse? Es sei eine Art klimabedingter posttraumatischer Belastungsstörung, der viele Bewohner Alaskas ausgesetzt seien, berichtete der Buchautor und Journalist Dahr Jamail Ende 2019 aus seiner alten Wahlheimat, der er anlässlich einer Vortragstour einen Besuch abstattete.1 Die Bewohner des konservativ geprägten nördlichen US-Bundesstaates - seit den 60er-Jahren fest in der Hand der Republikaner - befänden sich nach den extremen Hitzewellen und gigantischen Waldbränden des Sommers in einem permanenten Schockzustand. Bei Vorlesungen seines Buches über den Klimawandel hätten Menschen zu schluchzen anfangen und seien in Tränen ausgebrochen – und das in einem Bundesstaat, dessen veröffentlichte Meinung bis vor Kurzem ganz in der Leugnung oder Verharmlosung des Klimawandels aufging, wie sie von den Republikanern und Trump propagiert wird.
Es ist ein Leben in der Klimakatastrophe: Die Temperaturen in Alaska sind auf historisch absurd hohe Werte geklettert, ein klimatischer Kipppunkt scheint in der Region überschritten. In Anchorage, wo das Quecksilber im Sommer selten über 20 Grad Celsius klettert, wurden im Juli 2019 rund 32 Grad gemessen. Einwohner berichteten von apokalyptischen Zuständen, vom Verlust aller Hoffnung, als Rauchwolken wochenlang die Sicht auf wenige Dutzend Meter beschränkten oder die traditionelle Aufbewahrung von Lebensmittelvorräten im schmelzenden Permafrostboden aufgegeben werden musste. Ein alter Freund erzählte Jamail von Flüssen im Landesinneren, in denen unzählige Lachskadaver schwammen. Das Wasser in den Gewässern hat sich aufgrund der andauernden Hitze so stark erwärmt, dass die Tiere massenhaft an Herzversagen verendeten.
Die Fachzeitschrift "Psychology Today"2 umriss die Grundzüge eines neuen Krankheitsbildes, der Klimaangst ("climate anxiety"), das durch die nicht mehr zu leugnende Klimakrise ausgelöst werde und in der US-Bevölkerung um sich greife: Stress, Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, Schuldgefühle und Suizidgedanken, ausgelöst durch einsetzenden Klimawandel, zählten zu den Symptomen. Es sei keine "wissenschaftliche Abstraktion" mehr, erläuterte eine Psychotherapeutin ihre praktischen Erfahrungen, sie sehe, wie immer mehr Menschen "verzweifelt, in Panik" seien. Insbesondere unter Klimawissenschaftlern, die mitunter "um unseren Planeten und die Zukunft der Menschheit" trauerten, mehrten sich diese Krankheitssymptome.
An krassen, von der nach rechts abdriftenden Politik ignorierten Warnungen der Wissenschaft fehlt es nach Dekaden ideologischer Auseinandersetzungen und wissenschaftlicher Zurückhaltung nicht mehr. Warnungen vor dem Überschreiten zivilisationsbedrohender klimatischer Kipppunkte,3 vor dem katastrophalen Sauerstoffverlust der Meere,4 vor der Unzulänglichkeit der kapitalistischen Klimaschutzpolitik5 schaffen es inzwischen kaum noch in die Hauptnachrichtensendungen oder auf die Frontpages der großen Internetportale. Routinemäßig wird Alarm geschlagen: Selbst bei Einhaltung der vereinbarten Klimaziele durch alle daran beteiligten Staaten würden die durchschnittlichen globalen Temperaturen bis zum Ende des 21. Jahrhunderts um 3,2 Grad Celsius steigen, was einem Katastrophenszenario entspricht.6 Die Emissionen von Treibhausgasen erreichten immer neue Höchstwerte – es findet, Stand 2023, keine Reduzierung des CO2-Ausstoßes statt.7 Sollte dieser Emissionsanstieg nicht revidiert werden, wird die kapitalistische "One World" schon 2030 rund 120 Prozent mehr CO2 ausstoßen, als zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs um 1,5 Grad Celsius erlaubt wäre.8 Diese Emissionsreduzierung wäre nach Ansicht der Klimawissenschaft notwendig, um die totale Klimakatastrophe noch abzuwenden.
Ungerührt von diesen dramatischen Entwicklungen scheint die kapitalistische Weltwirtschaft weiterhin dem eingefahren Gleis des größtmöglichen Profit- und Wirtschaftswachstums zu folgen und kaum Rücksichten auf Mensch oder Natur zu nehmen. Im Gegenteil: Es ist, angefacht von der im Auftrieb befindlichen Neuen Rechten, eher eine Enthemmung zu beobachten, bei der jegliche Rücksichtnahme auf Klima- oder Ökosysteme fallengelassen wird. Dies gilt nicht nur für die USA des Donald Trump und die deutsche AfD. Ein Paradebeispiel war auch der Rechtsextremist im brasilianischen Präsidentenpalast, Jair Messias Bolsonaro, unter dessen Regentschaft der brasilianische Regenwald abgefackelt wurde, während Waldschützer und Klimaaktivisten ermordet werden. Auf den abgewählten Bolsonaro folge 2023 in Argentinien der rechtslibertäre Präsident Javier Gerardo Milei, der ebenfalls die Klimakrise gerne leugnet.
Klimaschutz und Wirtschaftswachstum, kapitalistische Ökonomie und Ökologie scheinen unvereinbar – nach drei Dekaden kolossal gescheiterter kapitalistischer Bemühungen zur Eindämmung der Klimakrise scheint diese Schlussfolgerung nicht abwegig. Der Augenschein trügt in diesem Fall auch nicht. Wenn etwa die deutsche Industrie Ende 2019 in Reaktion auf die "ambitionierten Klimaziele" (Spiegel Online)9 der EU warnte, sich durch das für 2050 angepeilte Ziel eines klimaneutralen Europa "bedroht" zu fühlen, da nun ganze Branchen und viele Arbeitsplätze gefährdet seien, dann ist den Deutschen Managern und ihren Politvertretern wie Baden-Württembergs "grünem" Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann durchaus zuzustimmen.
Wirtschaftswachstum und Klimaschutz, kapitalistische "Arbeitsplätze" und ökologisch intakte Umwelt sind unvereinbar. Ein Gesellschaftssystem, das von einem unkontrollierbaren Wachstumszwang angetrieben wird, kann in einer endlichen Welt keine ökologisch nachhaltigen Formen der sozialen Reproduktion etablieren. Verelendung jetzt oder Klimakollaps später – dies ist die systemimmanente Alternative, die der Kapitalismus in seiner Krise den Lohnabhängigen lässt. Die zentrale These dieses Buches lautet, dass der Kapitalismus der Menschheit die ökologischen Lebensgrundlagen entzieht. Kapital und Umwelt- wie Klimaschutz sind unvereinbar. Die Überwindung dieses destruktiven Weltsystems stellt folglich eine Überlebensnotwendigkeit für die gesamte Menschheit dar.
Das vorliegende Buch bemüht sich, in bester Tradition radikal zu sein, indem es die monströse Problematik des Klimawandels an der Wurzel zu erfassen versucht und die Ursachen der scheinbar unaufhaltsam, quasi automatisch ablaufenden Klimakrise klar benennt – ohne Rücksichtnahme auf den herrschenden Klimadiskurs, der von einem schwindelig machenden Abgrund zwischen den öffentlich diskutierten Maßnahmen zum Klimaschutz - wie Elektromobilität, Fleischverzicht oder Steuern auf Flugbenzin - und der überlebensnotwendigen Transformation der spätkapitalistischen Gesellschaften geprägt ist. Diese ideologisch induzierte Diskrepanz zwischen öffentlich diskutierten Klimaschutzmaßnahmen und tatsächlicher Krisendynamik kann tatsächlich depressiv stimmen. Der Kampf um eine der Klimakrise adäquate sozioökologische Transformation der kapitalistischen Gesellschaften fällt somit in eins mit dem Kampf gegen die spätkapitalistische Ideologie.
Ideologie bedeutet in diesem Zusammenhang zuallererst die Naturalisierung des Kapitalismus, der der verwildernden, in Faschisierung übergehenden neoliberalen Ideologie als Ausfluss einer als raubtierhaft imaginierten menschlichen Natur gilt. Es ist nicht der "Mensch" an sich, der das Klima ruiniert, wie es in der misanthropischen spätkapitalistischen Ideologie Konsens ist, sondern das krisengeplagte Kapitalverhältnis als treibendes Moment einer konkreten, instabilen, historischen Formation menschlicher Geschichte, unter dem die Menschen unter zunehmend prekären Bedingungen zu überleben versuchen. Die im öffentlichen Klimadiskurs tabuisierte Selbstverständlichkeit, die dieses Buch thematisiert, ist somit die Wechselwirkung zwischen der Gesellschaftsformation, in der die spätkapitalistischen Menschen ihr Leben zu fristen genötigt sind, und der Umwelt, die die Ressourcen und Rohstoffe für den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess liefert.
Sagen, was Sache ist, ohne falsche Rücksichtnahme auf die kapitalistische Ideologie – dieses klare Vorgehen, bei dem kein weltanschauliches "Abholen" praktiziert wird, resultiert nicht nur aus der simplen Tatsache, dass die Klimakrise nach rund dreißig Jahren kapitalistischer Ignoranz und Ineffizienz so weit vorangeschritten ist, dass kaum noch Zeit für den notwendigen radikalen Diskurs und Wandel bleibt. Das kapitalistische Weltsystem wird in der vorliegenden Arbeit als eine scheiternde, an seinem Wachstumsdrang zerbrechende Gesellschaftsformation begriffen. Dies ist keine Prognose, sondern eine vor allem in der Peripherie mit ihren "failed states" bereits sich entfaltende Realität.
Das System scheitert ohnehin an seinen inneren Widersprüchen, es kommt darauf an, was darauf folgt, wie der einsetzende Transformationsprozess ablaufen wird – falls überhaupt etwas auf das Kapital in seinem dunklen Todesdrang folgt. Die Krise entfaltet sich unabhängig von der herrschenden Ideologie und der öffentlichen Wahrnehmung des Krisengeschehens. Die Öffentlichkeit mag von Meinungsmachern oder Rechtspopulisten hinters Licht geführt werden, die objektiv ablaufende Klimakrise bleibt von diesen weltanschaulichen Verrenkungen unbeeindruckt, sie schreitet weiter voran. Vieles wäre gewonnen, wenn zumindest die Krisenursachen adäquat wahrgenommen würden, da es entscheidend ist, welcher Bewusstseinsstand beim nächsten Krisenschub in der Bevölkerung vorherrscht.
Das zweite Kapitel des Buches bemüht sich, diesen Krisenprozess zu beleuchten, der gewissermaßen in Eigendynamik "über" die Menschheit abläuft und ihr die ökologischen Lebensgrundlagen zu entziehen droht. Dabei werden die "Wirtschaftskrise" und die Klimakrise als zwei Momente desselben historischen Krisenprozesses begriffen, der von den zunehmenden inneren Widersprüchen der kapitalistischen Produktionsweise angetrieben wird. Das Kapital stößt in einem schubweise ablaufenden, historischen Krisenprozess an seine innere und äußere Schranke, wobei beide Krisenmomente – die Produktion einer ökonomisch überflüssigen Menschheit und die eskalierende Umweltkrise – nicht nur eine gemeinsame Ursache haben, sondern einander verstärken.
Die "systemischen" Ursachen dieser Unvereinbarkeit von kapitalistischer Ökonomie und Ökologie sollen nicht nur auf die zunehmenden sozialen Widersprüche, auf die Abgründe zwischen Arm und Reich, auf den in den neoliberalen Dekaden zunehmenden "Klassenkampf von oben" zurückgeführt werden. Unter Verwendung des Begriffs des Fetischismus, der von der Marxschen Theorieschule der Wertkritik maßgeblich geformt wurde, wird gerade die Irrationalität der kapitalistischen Produktionsweise ein zentrales Thema des zweiten Kapitels sein. Das Kapital entwickelt auf gesamtgesellschaftlicher, globaler Ebene eine irrationale, die Welt quasi verbrennende Eigendynamik, der alle Rationalität kapitalistischer Warenproduktion unterworfen ist. Dieser durch eskalierende innere Widersprüche angetriebene Fetischismus des Kapitals soll dabei in seiner Wechselwirkung mit den zunehmenden ökologischen Verheerungen und sozialen Auseinandersetzungen als die treibende autodestruktive Kraft hinter der Krise der Ökonomie wie der Ökologie benannt werden.
Das zweite Kapitel beinhaltet auch eine Auseinandersetzung mit den sozialdemokratischen Ideen einer ökologischen Transformation des Kapitalismus, mit dem "Green New Deal", der einer konstruktiven Kritik unterzogen wird. Es stellt sich hierbei vor allem die Frage, inwiefern diese binnenkapitalistischen Reformvorschläge einen ersten Schritt in die postkapitalistische Systemtransformation leisten können. Radikal sein heißt ja nicht, sektiererisch zu sein. Hinzu kommen neue Beiträge, die in dieser erweiterten Ausgabe einzelne Facetten dieser sozioökologischen Weltkrise des Kapitals beleuchten: hierzu gehört die Wechselwirkung von Überschuldung und Klimakrise, die insbesondere die Klimapolitik in der Peripherie des Weltsystems sabotiert, oder die destabilisierenden Effekte zunehmender Wetterextrema auf die Preisstabilität und die Nahrungsmittelversorgung. Der gemeinsame Nenner dieser Beiträge besteht in dem Bemühen, Wirtschafts- und Klimakrise als Momente desselben kapitalistischen Krisenprozesses darzustellen, wie es Anhand des "Sachzwangdiskurses" im vorletzten Abschnitt dieses Kapitels konkret geleistet wird.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den zunehmenden gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die durch den Krisenprozess angeheizt werden: Wie reagiert der gesellschaftliche "Überbau" auf die systemische Doppelkrise aus Ökonomie und Ökologie? Die zerstörerische fetischistische "Selbstbewegung" des Kapitals impliziert nicht die Exkulpation der beteiligten Funktionseliten. Deswegen werden diejenigen gesellschaftlichen Kräfte benannt, die sich in den vergangenen Dekaden mit ihren subjektiven Strategien und Aktionen daran beteiligten, Klimaschutz zu hintertreiben und somit die objektive Tendenz des Systems zu exekutieren. Sowohl in den USA als auch in der BRD konnten maßgebliche Lobbies über lange Jahre nennenswerte Klimaschutzmaßnahmen erfolgreich torpedieren. Der binnenkapitalistische Kampf um das Klima tobte auch in der Wissenschaft. In einem Beitrag soll das evidente Scheitern der Klimawissenschaft, die mit ihren Prognosen die Dynamik des Klimawandels jahrzehntelang furchtbar unterschätzte, mit dem politischen und ideologischen Druck in Zusammenhang gebracht werden, der auf der Wissenschaftscommunity lastete. Des Weiteren werden in diesem Kapitel die Aussichten einer strafrechtlichen Aufarbeitung der kapitalistischen Sabotage des Klimaschutzes erörtert – gerade im Zusammenhang mit der notwendigen Systemtransformation.
Der Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Funktion der Neuen Rechten in der Klimakrise muss in diesem Kapitel breiter Raum eingeräumt werden. Ein zentrales Moment rechter Ideologie ist die von Malthus entlehnte Überbevölkerungsthese, die die krisenbedingte Produktion einer ökonomisch "überflüssigen" Menschheit durch das Kapital naturalisiert. In einem Exkurs soll die Unhaltbarkeit dieser ins Massenmörderische treibenden Argumentationskette dargelegt werden. Die Akteure des aufschäumenden Rechtspopulismus und Rechtsextremismus werden als die Subjekte begriffen, die den objektiv gegebenen Drang des Kapitals zur Barbarei und Selbstzerstörung in seiner letalen Krise ideologisch legitimieren und politisch exekutieren. Die Gleichzeitigkeit von Leugnung des Klimawandels und forcierter Abschottung der nördlichen Zentren des Weltsystems, die den Kern der Politik der Neuen Rechten bilden, sollen auf ihren irrationalen Kern, den faschistischen Todesdrang, zurückgeführt werden, der gerade in Krisenzeiten mit den autodestruktiven Tendenzen des Kapitals zusammenfällt. Hinter all dem neonationalistischen Geschrei der Neuen Rechten lauert letztendlich die Panik, die sich in den neuen rechten Organisationsformen wie dem Prepper-Unwesen manifestiert.
Die mitunter bizarr anmutende Klimaleugnung der Neuen Rechten wird ab dem Überschreiten eines Schwellwerts in Panik umschlagen, in die Auflösung der im neoliberalen Zeitalter ohnehin erodierenden gesellschaftlichen Bindungen, die in eine hoffnungslose Logik des "Rette sich, wer kann" mündet.
Das vierte Kapitel bemüht sich hiernach, einige konkrete gesellschaftliche Felder und Prozesse aufzuzeigen, in denen die Krisentendenzen zur kapitalistischen Selbstzerstörung manifest werden. Zum einen findet eine Auseinandersetzung mit den Folgen des krisenbedingten Sparzwanges der öffentlichen Haushalte, der verheerenden Deregulierungs- und Privatisierungsoffensiven des neoliberalen Zeitalters statt. Die zentrale These dieser Ausführungen lautet, dass der Neoliberalismus als Krisenverstärker fungiert, da er die Krisenanfälligkeit der infrastrukturell maroden, organisatorisch beschränkten spätkapitalistischen Gesellschaftern erhöht. Diesem Kapitel liegt die einfache Logik zugrunde, dass der Verlauf einer konkreten Krisensituation, wie eines extremen Wetterereignisses, aus der Wechselwirkung zwischen der betroffenen Gesellschaft und der entsprechenden Naturkatastrophe rührt. Der Markt, dem in den neoliberalen Dekaden mythische Qualitäten angedichtet wurden, regelt nichts, er erhöht die Krisenanfälligkeit der betroffenen Gesellschaften.
Die ökologische Monstrosität der spätkapitalistischen Warenproduktion, die kaum noch etwas mit der neoliberalen Marktromantik von freier Konkurrenz zu tun hat, soll anhand des globalen Agrarsektors in seiner oligopolistischen, durch massive Staatssubventionen und brutale Vernichtungskonkurrenz in der Peripherie geprägten Struktur erhellt werden. Diesem Thema ist ein ausführliches Kapitel gewidmet, da die spätkapitalistische Agrarindustrie einen gewichtigen Anteil an der Eskalation der Klimakrise hat und die Nahrungsmittelproduktion besonders schnell unter Druck geraten wird. Die auf Profitmaximierung geeichte globale Lebensmittelproduktion ist nicht nur aufgrund einer effizient betriebenen Ressourcenverschwendung einer der größten Emittenten von Treibhausgasen, sie forciert auch die soziale Krise in der Peripherie des kapitalistischen Weltsystems. Zudem erhöht das buchstäblich überzüchtete kapitalistische Agrarsystem, das gerade arme Menschen in den Zentren des Weltsystems zu einer ungesunden und ökologisch ruinösen Diät nötigt, die Krisenanfälligkeit der Lebensmittelversorgung der Menschheit.
Der drohende Kollaps des Zivilisationsprozesses muss nicht schubweise, in einem längeren Prozess der ökologischen und sozialen Widerspruchsentfaltung vonstatten gehen, er kann auch mit einem Knall erfolgen: Die zunehmenden geopolitischen Auseinandersetzungen zwischen den spätkapitalistischen Staaten sollen in einem Beitrag in Zusammenhang mit der sozialen und ökologischen Krise gebracht werden. Wie verändert sich das blutige imperiale Ringen um Einflusszonen und Rohstoffe der "Staatsmonster" angesichts der Krisendynamik, welche Prognosen können aufgrund der einsetzenden klimatischen Verwerfungen gestellt werden? Diese Fragen sollen vor dem Hintergrund eines ins Absurde steigenden Vernichtungspotenzials der imperialistischen Militärmaschinen diskutiert werden. Neu hinzugekommen sind Texte, die sich mit der bereits deutlich abzeichnenden Unbewohnbarkeit von Erdregionen befassen, wie auch mit den ökologischen Verheerungen des illusorischen "grünen" Kapitalismus.
Im fünften Kapitel, das für diese Neuausgabe verfasst worden ist, wird die Auseinandersetzung mit ideologischer Verblendung und linkem Opportunismus in der Klimakrise gesucht, die maßgeblich zur innerlinken Regression und zur Marginalisierung radikaler Krisentheorie beigetragen haben. Zum einen thematisieren die hier versammelten Beiträge die langjährige Krisenignoranz einer strukturell konservativ ausgerichteten Linken, die sich am Paradigma des Klassenkampfs und des sozialdemokratischen Umverteilungsdenkens festkrallt, obwohl die kapitalistische Klimakrise bereits in ein manifestes Stadium getreten ist. Andrerseits wird das Kalkül der opportunistischen Kräfte des linksgrünen "Bewegungsmanagements" und der erodierenden Linkspartei kritisiert, die auf Teilnahme bei der Krisenverwaltung hoffen – als "soziales Gewissen" des ohnehin scheiternden "Green New Deal". Zentral ist dieser unheiligen Allianz aus Ignoranz, ideologischer Verblendung und Karrieregeilheit, dass sie mit aller schwindenden Macht das Aufkommen eines radikalen, transformatorischen Krisenbewusstseins in der Linken sabotiert. Die kapitalistische Klimakrise, die zwangsläufig die Systemfrage aufwirft, wird vom Opportunismus zu einer Verteilungsfrage verkürzt, wobei die krisenbedingt zunehmenden Tendenzen zum Staatskapitalismus insbesondere der keynesianischen Staatsgläubigkeit aufrieb verleihen. Zumeist werden hierbei Elemente der Wertkritik aus ihrem theoretischen Kontext herausgelöst, um sie in die anachronistischen staatssozialistischen, keynesianischen oder altmarxistischen Ideologien einzubauen.
Im sechsten Kapitel sollen schließlich Wege zu einer emanzipatorischen Transformation des kapitalistischen Weltsystems sondiert werden. Zwei Beiträge befassen sich mit der Verteilungs- und Eigentumsfrage. Die Intention hierbei ist es, dem ökologisch motivierten Verzichtsdenken wie auch dem simplen Klassenkampfparadigma entgegenzuwirken, das der Überwindung des Kapitalismus mittels Enteignung und simpler Übernahme der kapitalistischen Produktionsmittel und Verhältnisse durch die Arbeiterschaft oder eine staatliche Nomenklatura das Wort redet. Es soll in diesen Texten nachgewiesenen werden, dass beide Ansätze nicht weit genug gehen, da sie in den kapitalistischen Denkformen verfangen bleiben: Verzicht, da Bedürfnisbefriedigung in Warenform gedacht wird; Klassenkampf, da der Fetischismus und die Formen subjektloser Herrschaft im Kapitalismus ausgeblendet werden.
Dass der Kapitalismus aller ideologischen Verblendung zum Trotz "reif" für eine emanzipatorische Transformation, dass der Absturz in die Barbarei und den Zivilisationsbruch nicht zwangsläufig ist, soll anhand der Auseinandersetzung mit den technologischen Möglichkeiten einer hochentwickelten postkapitalistischen Produktionsweise dargelegt werden. Die Kernthese lautet, dass technische Mittel und die "Produktivkräfte" als organisatorisches Potenzial einer neuen Gesellschaftsformation bereits im Schoße der kapitalistischen Produktionsweise entwickelt wurden. Es gilt folglich "nur" noch, die kapitalistischen Produktionsverhältnisse in einem gigantischen transformatorischen Prozess in Geschichte zu überführen.
Kapitalistische Ideologie arbeitet in der gegenwärtigen Systemkrise auf die Versöhnung des Subjekts mit der Apokalypse, dem Zivilisationsbruch hin; sie kommt einem Todeskult gleich. Immer neue Varianten der Klimaleugnung und Verharmlosung werden von Thinktanks und Meinungsmachern in Umlauf gebracht: etwa der Versuch, das vom Kapitalismus verursachte Elend in der Peripherie gegen den vom Kapitalismus verursachten Klimawandel auszuspielen.10 Der Kapitalismus offenbart inzwischen klar sein Wesen als "gesellschaftliche Selbstmordsekte", wie es der Werttheoretiker Robert Kurz zu Beginn des 21. Jahrhunderts formulierte. An der sich immer deutlicher abzeichnenden Katastrophe, die die Neue Rechte in ihrem dunklen Todesdrang umarmt, erkranken die Menschen. "Klimaangst" resultiert aus der impliziten Einsicht, dass in dem Gesellschaftssystem, das vorgibt, naturgegebene "Normalität" zu sein, Überleben immer unwahrscheinlicher scheint.
Was vorgibt, "normal" zu sein, sich ideologisch und politisch in der "Mitte" der Gesellschaft zu befinden, driftet ins Extreme ab, um eine unwiederbringlich im Zerfall befindliche Weltunordnung möglichst lange im Siechtum zu halten. Der Kapitalismus ist ein extremistisches System, was nicht nur an der fortgesetzten, systemimmanent unüberwindbaren Vernichtung der ökologischen Lebensgrundlagen der Menschheit, sondern auch an der zunehmenden Faschisierung seiner Funktionseliten evident wird. Der offen zutage tretende Irrationalismus des Systems manifestiert sich in einer Riege blutiger Terrorclowns wie Trump, Erdoğan, Bolsonaro, Duterte oder Orbán, die an die Macht gespült wurden – und über die mensch eigentlich lachen müsste, wenn sie nicht über genügend Machtmittel verfügten, um den Krisenprozess Richtung Barbarei zu treiben.
Angesichts der atemlos voranschreitenden kapitalistischen Weltverbrennung, angesichts des um sich greifenden Extremismus der kapitalistischen Mitte stellt der Überlebenskampf um die emanzipatorische Überwindung dieses Todessystems das einzig Vernünftige, Mittlere, Sinnvolle dar. Das ist der letzte Sachzwang: die Überwindung des kapitalistischen Sachzwang-Regimes mit seinen absurden Wachstumszwang, der immer mehr soziales Elend und ökologische Verwüstung produziert. Im letzten Text des sechsten Kapitels wird der Versuch unternommen, konkrete Vorschläge einer transformatorischen Praxis zur Diskussion zu stellen; einer Praxis, die sich ihrer selbst bewusst ist und nicht in der falschen Unmittelbarkeit früherer Kämpfe stecken bleibt. Emanzipation meint in diesem Zusammenhang vor allem die Überwindung des gesellschaftlichen Fetischismus, um eine bewusste, ressourcenschonende Gestaltung der gesellschaftlichen Reproduktion zu erkämpfen. Dieser Text wurde ebenfalls aktualisiert und erweitert - vor allem, um die Erfahrungen mit dem Krisenopportunismus zu reflektieren.
Das Einzige, was gegen die um sich greifende Verzweiflung und Resignation, gegen die aufkommende Panik wirklich hilft, ist zu kämpfen, aufbauend auf einem adäquat radikalen Verständnis der systemischen Ursachen der gegenwärtigen Doppelkrise der Ökonomie und Ökologie. Es gibt keine andere Option, die nicht in die Barbarei führte. Im kollektiv geführten Klimakampf, im emanzipatorischen Transformationskampf können noch mentaler Halt und Vernunft angesichts der drohenden kapitalistischen Apokalypse gefunden werden. Dies scheint das beste Gegengift gegen die Panik, die das System produziert.
Schlussbemerkung: Dieses Buch baut teilweise auf Texten oder Textpassagen auf, die in den vergangenen zwölf Jahren zur Problematik des Klimawandels vor allem in der Zeitschrift Konkret und auf dem Portal Telepolis veröffentlicht wurden. Insbesondere die im Buch Kapitalkollaps11 geführte Argumentation wird hier – etwa bei der Frage einer adäquaten Praxis angesichts der Krise – fortgeführt, erweitert und aktualisiert. Zentral für das theoretische Verständnis der Unvereinbarkeit von Klimaschutz und Kapital sind die Abschnitte 2.3 und 2.3.1. Die Möglichkeiten einer emanzipatorischen Praxis in der Klimakrise werden vor allem in Abschnitt 6.4 diskutiert.
Die erweitere Neuauflage des Buches bemüht sich einerseits um eine stärkere Fokussierung auf das Kernthema der kapitalistischen Klimakrise, periphere Texte zum Zustand der Marxschen Theorieproduktion oder zur spätkapitalistischen Kultur der Panik entfernt wurden (Diese Texte finden sich nun in dem E-Book "Krisenideologie. Wahn und Wirklichkeit spätkapitalistischer Krisenverarbeitung"). Stark erweitert wurden hingegen die Kapitel zur Wechselwirkung von Klima und Wirtschaftskrise und zur kapitalistischen Selbstzerstörung. Neu hinzugekommen ist das fünfte Kapitel "Opportunismus in der Klimakrise". Ändernden wurden an der Einleitung, wie auch im 6. Kapitel vorgenommen, das sich mit Fragen der Praxis in der Klimakrise befasst.
Ich danke Thomas Knopp, der das Titelbild dieses E-Books entwarf, sowie Thomas Meyer vom Exit-Zusammenhang für ihre Hilfe bei der Anfertigung der Neuausgabe. Ferner danke ich dem Mandelbaum Verlag für die unkomplizierte Freigabe der Rechte an der Erstauflage.
2. Wirtschafts- und Klimakrise: Zwei Momente spätkapitalistischer Widerspruchsentfaltung
2.1 Systemkrise: Rückblick und Ausblick
Ein kurzer Überblick über den historischen Verlauf der Krise des spätkapitalistischen Weltsystems.12
Wann kommt das nächste Marktbeben? Asienkrise 1997, Dot-Com-Blase 2000, Weltfinanz- und Wirtschaftskrise 2007-09: Alle Jahre wieder wird das kapitalistische Weltsystem von Krisenschüben erfasst, deren Intensität beständig zunimmt. Die Einschläge kommen immer näher. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das fragile globale Kartenhaus erneut einzubrechen beginnt. Tatsächlich wird spätestens seit 2018/19 in der Öffentlichkeit darüber spekuliert, wann es mal wieder "kracht" auf den Märkten.13 Der große Unterschied zum Crash von 2008 besteht darin, dass diesmal das Krisenbewusstsein in der Öffentlichkeit weitaus stärker ausgeprägt ist als beim Platzen der transatlantischen Immobilienblasen in den USA und Westeuropa, auf das der Mainstream nicht vorbereitet war.
Einem Gewitter gleich scheint abermals eine neue globale Krise aufzuziehen, und es fehlt insbesondere in der Restlinken nicht an Stimmen, die dies als einen "normalen", quasi natürlichen Vorgang der "schöpferischen Zerstörung" anzusehen gewillt sind. Im bürgerlichen Lager setzt hingegen die große Sündenbocksuche ein.14 Bevor nun abermals die Absturzangst der Mittelklasse die Sinne trübt, der sich in dieser "Mitte" formierende Mob auf Sündenbocksuche und auf die Jagd nach dem "ewigen Soros"15 geht und deutsche Polizisten sowie Sondereinheiten zu faschistischen Todesschwadronen mutieren,16 könnte ein nüchterner Blick auf das Krisengeschehen eventuell nicht gänzlich vergebens sein.
Kapital und Krise als historische Prozesse
Streng genommen handelt es sich bei den immer wieder mit verstärkter Intensität einsetzenden Verwerfungen nicht um "neue" Krisen, sondern um einen abermaligen manifesten Krisenschub eines langfristigen Prozesses zunehmender Widerspruchsentfaltung. Die Krise des kapitalistischen Weltsystems kann nur als ein historischer Entwicklungsgang begriffen werden, der sich schubweise entfaltet: Perioden des "latenten" Krisengangs, die von einem global anschwellen Schuldenberg und aufsteigenden Spekulationsblasen gekennzeichnet sind, kulminieren in manifesten Krisenschüben, in denen diese Blasen platzen, Währungs- oder Schuldenkrisen ausbrechen und Depressionen ganze Volkswirtschaften verwüsten.
Ein adäquates Verständnis der Krise kann ohne ein entsprechendes Verständnis des Kapitalismus nicht gewonnen werden - das Kapital ist ebenfalls kein (ewiger) Naturzustand. Nicht nur die Krise muss als historischer Prozess begriffen werden, der durch innere Widersprüche angetrieben wird. Auch das kapitalistische System ist keine überhistorische Konstante menschlicher Existenz, sondern eine konkrete, widersprüchliche Gesellschaftsformation, die ihren bluttriefenden Anfang in der frühen Neuzeit nahm - und nach einer rund 300-jährigen Expansionsgeschichte in der gegenwärtigen Krisenperiode an ihren ökonomischen und ökologischen Widersprüchen zerbricht.17
Es gilt somit, der im Spätkapitalismus allgegenwärtigen Verdinglichung des Denkens entgegenzuwirken, welche die Grundlage aller Krisenideologie samt ihrer Extremformen wie Faschismus und Nationalsozialismus ist. Das dynamische Denken und Wahrnehmen in Prozessen und Entwicklungen - angetrieben von Widersprüchen - muss an die Stelle des statischen Denkens in Zuständen treten. Die Frage lautet somit nicht, wie das spätkapitalistische System oder wie der Mensch "ist", der in diesem System sozialisiert wurde, sondern wie es geworden ist, wohin es treibt, wie die Triebkräfte dieses kapitalistischen Prozesses beschaffen sind. Ebenso gilt es zu beleuchten, wie die spätkapitalistischen Menschen durch diese blindwütige, fetischistische Kapitaldynamik geformt und verheert werden, die ihnen als eine übermächtige, naturhaft erscheinende Gewalt entgegentritt, obwohl sie sie alltäglich marktvermittelt erarbeiten.
Kapital als prozessierender Widerspruch
Welcher Widerspruch ist es konkret, der seit der Durchsetzung des Kapitals in der historischen Expansionsbewegung des kapitalistischen Weltsystems "prozessiert"? Das Kapital ist in seinem uferlosen Verwertungskreislauf bemüht, sich seiner eigenen Substanz zu entledigen. Die Lohnarbeit, verwertet im Reproduktionsprozess des Kapitals, bildet dessen Substanz. Im Endeffekt ist das Kapital ein realabstrakter Verwertungsprozess, bei dem durch alle Formwandel von Ware und Geld immer größere Mengen abstrakter, "toter" Lohnarbeit akkumuliert werden.
Die Instabilität, die Krisenanfälligkeit, aber auch die zerstörerische Dynamik des kapitalistischen Systems resultiert aus der marktvermittelten Tendenz des Kapitals, den Einsatz von Lohnarbeit im Produktionsprozess zu minimieren. Dieser "prozessierende Widerspruch", bei dem das Kapital konkurrenzvermittelt seine "Entsubstantialisierung" betreibt, ist nur in einer Expansionsbewegung, bei Erschließung neuer Märkte, Wachstumsfelder und insbesondere Industriesektoren aufrechtzuerhalten. Das Kapital muss expandieren - oder es zerbricht an sich selbst.
Das Scheitern des industriellen Strukturwandels
Die bürgerliche Volkswirtschaftslehre bezeichnet diesen in seiner inneren Widersprüchlichkeit unverstandenen historischen Prozess zunehmender Widerspruchsentfaltung als "industriellen Strukturwandel": Alte Industrien, die eine Zeitlang als Leitsektoren dienten, verschwinden, um neuen, moderneren Wirtschaftszweigen Platz zu machen. Historisch betrachtet waren es die Textilbranche, die Schwerindustrie, die Chemie, die Elektrobranche, zuletzt der Fahrzeugbau, die als "Leitsektoren" dienten, die massenhaft Lohnarbeit verwerteten - wobei das ideologische Dogma der Volkswirtschaftslehre in der Annahme besteht, dass letztendlich, allen Friktionen zum Trotz, die neuen Sektoren immer genügend neue "Arbeitsplätze" schüfen, um den Wegfall der Lohnarbeit in den alten Industrien zu kompensieren.
Dies funktioniert aber schon seit etlichen Dekaden nicht mehr.18 Wollte man nun die Ursache der gegenwärtigen Systemkrise in einem Satz auf den Punkt bringen, so könnte er folgendermaßen formuliert werden: Die Krise ist Folge des Scheiterns des industriellen Strukturwandels seit den 80er-Jahren des 20. Jahrhundert. Die Rationalisierungsschübe der mikroelektronischen Revolution führten schon damals dazu, dass erstmals die neuen IT-Industrien nicht genügend neue Arbeitsplätze und Verwertungsmöglichkeiten schaffen konnten, um die Masse der abschmelzenden Arbeitskraft in den alten Industrien zu kompensieren. Es gibt seit den 80ern, seit dem Auslaufen des langen Nachkriegsbooms, keinen industriellen Leitsektor mehr, in dem massenhaft Lohnarbeit verwertet würde.
Die Krise frisst sich seit Jahrzehnten schubweise von der Peripherie in die Zentren des Weltsystems - die Wirtschaftszusammenbrüche infolge von Schuldenkrisen der Dritten Welt in den 80er- und 90er-Jahren bildeten den Vorlauf zu den Verheerungen, die zuletzt Südeuropa in Gestalt des Sparsadisten Schäuble verwüsteten. Die Reaktion des Systems besteht jedes Mal in einer abermaligen Flucht nach vorn, die den ökonomischen Kern des Neoliberalismus bildet: Entrechtung der Lohnabhängigen, Entfesslung der Finanzmärkte, Globalisierung des Schuldenturmbaus mittels Defizitkreisläufen, ökologisch zerstörerische Billigproduktion in Schwellen- oder Entwicklungsländern.
Neoliberalismus und Finanzialisierung als "Flucht nach vorn"
In der globalen "Finanzialisierung" des Kapitalismus, bei der die Finanzbranche zum dominanten Volkswirtschaftssektor aufstieg, schien die Finanzsphäre die Funktion eines Leitsektors oder "Motors" der Ökonomie zu übernehmen. Dass dies über längere Zeiträume nicht funktionieren kann, da in der Finanzsphäre keine Verwertung wertbildender Lohnarbeit abläuft, machten die zunehmenden Finanzmarktbeben klar, die das Weltfinanzsystem seit den 90er-Jahren erschüttern.
Nach einer Reihe regionaler Finanzkrisen in den 90ern, wie der Asienkrise und der Russlandpleite, etablierte sich ab der zweiten Hälfte der 90er-Jahre eine regelrechte globale Finanzblasenökonomie. An Umfang zunehmende Spekulationsblasen, die beim Platzen immer größere Finanzmarktbeben hervorrufen, lösen einander ab: von der im Jahr 2000 platzenden Dot-Com-Spekulation mit Hightech-Aktien über die Immobilienblase von 2007/08 bis zur gegenwärtigen gigantischen Liquiditätsblase, die ihren Reifegrad erreicht hat - wobei die Politik zu einer Getriebenen dieser Dynamik wurde und mit immer extremeren Mitteln die Folgen der geplatzten Blasen auffangen musste.
Politik in der Krisenfalle
Gewissermaßen war die Politik beim Umgang mit der Krise der vergangenen Dekaden "erfolgreich". Es waren ihre "Rettungsmaßnahmen" nach dem Platzen einer Blase, mit denen ein wirtschaftlicher Zusammenbruch immer wieder kurzfristig verhindert wurde - und die zugleich den Grundstein für die nächste, noch größere Spekulationsdynamik legen. Die Politik hangelt sich von Blase zu Blase, kann somit aus dieser Finanzblasenökonomie nicht ausbrechen, da dies zum ökonomischen Kollaps führt, wie die jüngste Krisengeschichte illustriert.
Die Weltwirtschaftskrise von 2009 resultierte gerade daraus, dass die US-Administration unter George W. Bush die Finanzmärkte nicht "auffangen" und "retten" wollte, sondern die Investmentbank Lehmann Brothers als abschreckendes Beispiel für alle Finanzmarktakteure pleitegehen ließ. Die Folgen dieses Versuchs, aus der Finanzblasenökonomie auszubrechen, sind bekannt: Die Finanzmärkte froren ein, die Kreditvergabe kam zum Erliegen, die Weltwirtschaft versank in der Rezession.
Um den 2009 einsetzenden Absturz der Weltwirtschaft samt Kernschmelze des Weltfinanzsystems zu verhindern, tat die Politik das systemimmanent einzig Mögliche: Sie legte massive Konjunkturprogramme auf und öffnete die Geldschleusen. In einer historisch beispiellosen, global koordinierten "Abfangaktion" wurde der freie Fall der Konjunktur revidiert, und die eingefrorenen Finanzmärkte wurden wieder "aufgetaut". Die ab 2008/09 aufgelegten Konjunkturprogramme (vor allem in China und abgeschwächt in den USA) umfassten nahezu fünf Prozent der Weltwirtschaftsleistung des Jahres 2009.
Zugleich gingen die Notenbanken in allen Zentren des Weltsystems zu einer Nullzinspolitik über, die dazu beitragen sollte, die Konjunktur zu beleben und die Finanzmärkte "aufzutauen", die sich nach dem Platzen der Immobilienblasen und der Pleite von Lehmann Brothers in Schockstarre befanden. Doch diese geldpolitische Maßnahme - die von der Fed auch nach dem Platzen der Dot-Com-Blase im Jahr 2000 kurzfristig mit einem Leitzins von einem Prozent angewendet wurde - reichte nicht aus. Zusätzlich wurde massiv Liquidität in die Finanzmärkte gepumpt, indem die Notenbanken all den Finanzmarktschrott aufkauften, der nach der geplatzten Immobilienblasen die Finanzsphäre verstopfte. Die "Verbriefungen" fauler Hypotheken, die während der ImmobilienBonanza das Weltfinanzsystem fluteten, belasten nun die Bilanzen der Notenbanken.
Die Liquiditätsblase
Mit dem Aufkauf von Schrottpapieren oder - vor allem von der EZB - von Anleihen krisengebeutelter Euroländer konnte ab 2010 die konjunkturelle und finanzielle Kehrtwende erreicht werden. Das Weltsystem stabilisierte sich zumindest in den Zentren, auch wenn die Aufwärtsbewegung bei der Konjunktur und auf den Finanzmärkten mit Verelendungsschüben in Südeuropa und dem Abschmelzen der US-Mittelschicht einherging. Diese historisch einmaligen Maßnahmen waren also gewissermaßen "erfolgreich", doch initiierten sie ein Liquiditätsblase, die zu platzen droht.
Die frische Liquidität, die mit Nullzinsen und dem Aufkauf von Schrottpapieren in die Finanzsphäre gepumpt wurde, legte den Grundstein für den kreditfinanzierten Boom in den Schwellenländern (China, Brasilien, Türkei, etc.) wie für das abermalige Abheben der Aktienmärkte in den Zentren, vor allem in den USA. Die kapitalistische Krisenpolitik vollführte de facto einen Spekulationsblasentransfer. Der gemeinsame Krisennenner all der disparat erscheinenden Krisenphänomene in den Zentren und der Semiperipherie besteht gerade in einer Krisenpolitik, der es 2008/09 gelang, die ökonomischen Folgen der geplatzten Immobilienblasen durch eine neue Spekulationsbewegung abzufangen.
Ab 2009/10 strömte die in die Märkte gepumpte Liquidität sowohl in die Schwellenländer, die Defizitkonjunkturen erfuhren (vor allem China mit den charakteristischen Immobilien- und Aktienblasen), als auch in die Aktienmärkte der Zentren des Weltsystems, die sich in einem geisterhaften, hauptsächlich durch Großaktionäre angefachten Aktienboom befanden.
Die Politik befindet sich somit in einer Krisenfalle: Sie kann den manifesten Ausbruch der Krise nur durch Initiierung weiterer Spekulationsdynamiken hinauszögern - um den Preis immer größerer Blasenbildungen. Es ist letztendlich ein Krisenaufschub von einer Dekade, der mittels der Öffnung der Geldschleusen ab 2009 erreicht wurde. Die ökonomischen wie ökologischen Kosten eines solchen Blasentransfers steigen aber mit dem Platzen jeder Blase.
Die Entwertung des Werts
Inzwischen hat die Politik ihr systemimmanentes "Pulver" verschossen. Den Politeliten stehen kaum noch Optionen zur Verfügung, um den Kollaps des Weltfinanzsystems und der Weltwirtschaft zu verhindern: Am Vorabend des kommenden Krisenschubs sind die Zinsen immer noch größtenteils im Keller, die Bilanzen der Notenbanken immer noch mit Schrottpapieren vollgestopft, die wichtigsten Metropolenstaaten - insbesondere die USA und weite Teile der EU - weitaus höher verschuldet als 2008, und die Schwellenländer, allen voran China, befinden sich in Schulden- oder Währungskrisen.
Die Finanzmarktexzesse der letzten Jahrzehnte sind nicht die Ursache, sondern die Folge der Systemkrise des Kapitals. Die Ursachen sind in den Widersprüchen der Warenproduktion zu verorten, die immer mehr Lohnarbeit durch Rationalisierungsschübe überflüssig machen: Das kapitalistische Weltsystem ist längst zu produktiv für sich selbst geworden. Es produziert eine ökonomisch überflüssige Menschheit, wie es die Flüchtlingskrise evident macht.
Letztendlich läuft das System nur noch auf Pump. Die globalen Schulden wachsen seit den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts schneller als die Weltwirtschaftsleistung - und es ist dieser Prozess der globalen Defizitbildung, der die Massennachfrage für eine hyperproduktive Industrie generiert, die an ihrer eigenen Produktivität zu ersticken droht. Die wuchernde Finanzsphäre bildete somit den Transmissionsriemen, der mittels immer größerer Blasenbildung den beständig anwachsenden globalen Schuldenberg erschuf, unter dem der Spätkapitalismus zusammenzubrechen droht. Der kommende Krisenschub wird somit mit einer Entwertung des Werts in all seinen Aggregatzuständen einhergehen.
2.2 Fetischismus: Die Selbstbewegung des Kapitals
"Nur wenn, was ist, sich ändern läßt, ist das, was ist, nicht alles."
Adorno
Wer trägt die Schuld an den zunehmenden Widersprüchen und Verwerfungen spätkapitalistischer Gesellschaften? Wer herrscht im Kapitalismus? Der erste Augenschein scheint zu bestätigen, was zumeist den Grundbestandteil linker Theoriebemühungen oder Ideologie bildet: Es ist die Klasse der Kapitalisten, der Besitzer von Produktionsmitteln, die die Fäden der Macht in der Hand zu halten scheint - und somit den gegenwärtigen Zustand des kapitalistischen Weltsystems zu verantworten hat.
Diese Schlussfolgerung erscheint berechtigt angesichts der absurden sozialen Spaltung zwischen Arm und Reich, zwischen der Masse der Lohnabhängigen und den "Happy Few" der Milliardärskaste, die durch die neoliberale Wirtschafts- und Finanzpolitik der vergangenen Dekaden immer weiter forciert wurde.
Die Daten zur sich immer weiter öffnenden Schere zwischen Arm und Reich wirken nur noch bizarr: Inzwischen besitzen die 26 reichsten Milliardäre ein Vermögen, das den Habseligkeiten der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung entspricht - das sind rund 3,8 Milliarden Menschen.19 In den USA sind es die vermögendsten 20 Superreichen, deren Vermögenswerte dem Hab und Gut der verarmten Bevölkerungshälfte entsprechen. In der Bundesrepublik wiederum liegt diese Relation zwischen Milliardären und Mittellosen bei 45 zu 41 Millionen.20 45 megareiche Kapitalisten besitzen genauso viel wie die untere Hälfte der Bevölkerung, wobei die Spaltung bei den Einkommen in der Bundesrepublik inzwischen sogar stärker ausgeprägt ist als in den Vereinigten Staaten.
Diese extreme soziale Spaltung des spätkapitalistischen Weltsystems spiegelt sich auch im globalen Verbrauch ökologischer Ressourcen und in den Emissionen von Treibhausgasen wider. Die reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung sind für rund 50 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich, warnte Oxfam Ende 2015. Die abgehängte, verarmte untere Hälfte der Weltbevölkerung im Globalen Süden, die künftig die Hauptlast der Klimakrise tragen wird, generiert hingegen nur zehn Prozent der globalen Treibhausgase.21 Wer zum reichsten Prozent der Weltbevölkerung zähle, produziere im Schnitt die 175-fache Menge an CO2 von jemandem, der zu den ärmsten zehn Prozent zähle.
Die sozioökologische Spaltung der spätkapitalistischen Gesellschaften mitsamt der Herausbildung einer weitgehend abgekapselten Kaste von Milliardären geht mit einer verstärkten, immer offener praktizierten Durchsetzung von Interessen der Kapitalistenklasse einher. Dieser erfolgreiche Lobbyismus schlug sich etwa in der Finanz- und Steuerpolitik der letzten Dekaden nieder, die nahezu ausschließlich die Superreichen und die Großkonzerne begünstigte.22
US-Milliardäre wie die berüchtigten Koch-Brüder finanzieren eine Politmaschine, die ihre reaktionären Interessen in Washington in Gesetzesform bringt.23 Inzwischen wird darüber debattiert, ob die USA zu einer Oligarchie verkommen seien, die von wenigen Milliardären politisch dominiert werde.24 In der Bundesrepublik hingegen lassen die BMW-Milliardäre aus dem berüchtigten Quandt-Clan der CDU direkt Spenden zukommen, bevor die Bundesregierung wieder einmal CO2-Grenzwerte zugunsten der deutschen Autoindustrie reduziert. Zum Aufstieg der Neuen Rechten kommt die direkte Finanzierung von Rechtsextremisten und Rechtspopulisten durch Milliardäre, wie etwa im Fall von US-Präsident Trump und der deutschen AfD.
Generell scheint die effektive Lobbytätigkeit des "großen Geldes" auch für die Untätigkeit der Politik angesichts der eskalierenden Klimakrise verantwortlich zu sein. Die entsprechenden Lobbygruppen der fossilen kapitalistischen Wirtschaft haben erfolgreich jedwede ernsthafte Maßnahme zur Bekämpfung des Treibhauseffekts über Jahrzehnte mit Millionenbeträgen torpediert - sowohl in den USA als auch in Deutschland.
Kapitalisten, Klassenkampf und Krise
Angesichts dieser informellen Machtfülle der Kapitalistenklasse, die ihre wirtschaftlichen Interessen mühelos durch Lobbymaschinen in Gesetzesform gießen kann, scheinen sich insbesondere der Linken die Ursachen der gegenwärtigen Krise klar abzuzeichnen: Es ist die zunehmende sozioökonomische Spaltung der Gesellschaft, die gerade durch die anscheinend hinter den Kulissen herrschende Klasse der Milliardäre, der Kapitalisten, verursacht wurde. Die grenzenlose Gier oder der unersättliche Machthunger der Kapitalistenklasse führte den Kapitalismus in die Krise.
Ähnlich scheint es sich mit der ökologischen Krise zu verhalten: Die Gier der Konzernbosse der Öl- und Autoindustrie sowie ihr Einfluss auf die Politik scheinen dafür verantwortlich zu sein, dass der Klimawandel allen Sonntagsreden zum Trotz durch beständig steigende CO2-Emissionen immer angefacht wird. Die ökonomische Stagnation, die steigenden CO2-Werte, der jahrzehntelange soziale Abstieg großer Teile der Bevölkerung in den Zentren des kapitalistischen Weltsystems erscheinen als eine Folge der Politik der Klasse der Superreichen, die einen regelrechten "Klassenkrieg" gegen die arbeitende Bevölkerung führe, wie es etwa der Milliardär und Spekulant Warren Buffet formulierte:
"There’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s making war, and we’re winning."25
Für gewöhnlich wird der Beginn dieses "Klassenkrieges" in der neoliberalen Wende der 1980er-Jahre verortet, die nach dem blutigen Vorspiel 1973 in Chile26 zuerst in den USA und in Großbritannien von Ronald Reagan und Margaret ("There is no such thing as society") Thatcher durchgesetzt wurde.
Inzwischen haben die Verelendungsschübe nach dem Platzen der Immobilienblasen 2008, die etwa die US-Mittelklasse verheerten, aber auch zur Formierung einer starken klassenkämpferischen Linken beigetragen.
Der Hetze gegen Minderheiten, die die Neue Rechte nach dem Krisenschub 2008 forcierte, wird von der Linken in den USA und Großbritannien die Option des Klassenkampfes entgegengestellt, bei dem der von den Superreichen geführte Klassenkrieg nun durch den von "unten", von den Lohnabhängigen bewusst mittels politischer Mobilisierung, beantwortet werde.27 Die Klimakrise soll wiederum durch ein massives keynesianisches Investitionsprogramm, den Green New Deal, überwunden werden. Klassenkampf und ökologischer Umbau des Kapitalismus – dies sind die Antworten der "Neuen Linken" im angelsächsischen Raum auf die Krise des Kapitals.
Politiker wie Jeremy Corbyn, Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez plädieren für eine Umverteilung von oben nach unten, für eine strikte Besteuerung großer Vermögen und für eine Beschneidung der informellen politischen Machtfülle der Superreichen, um mit großen Investitionsprogrammen den Kapitalismus aus seiner ökologischen wie ökonomischen Krise zu führen. Angesichts dieser Renaissance eines linken Klassenkampfbegriffes scheint sich möglicherweise ein fortschrittliches Gegengewicht zur reaktionären Welle der Neuen Rechten zu formieren.
Dennoch handelt es sich bei diesem Erklärungsansatz des Krisengeschehens, der in der Dichotomie von Proletariat und Bourgeoisie verbleibt, um ein verzerrtes Bewusstsein, das nicht radikal genug ist, um den Krisenprozess adäquat zu erfassen. Die Krise ist mehr als die Summe des krisenbedingt eskalierenden Klassenkampfes. Die Prämisse, die dem altlinken Klassenkampfdenken innewohnt, wonach es eine Gruppe von Menschen gebe, welche die gesellschaftliche Reproduktion bewusst kontrolliere, ist falsch.
Die Realität kapitalistischer Krisenentfaltung ist viel erschreckender als alle Schreckgespenster einer hinter den Kulissen des Politbetriebes ablaufenden allmächtigen Herrschaft superreicher Generalbösewichte - so abstoßend und verwerflich die egomanischen Akteure dieser exklusiven Zirkel auch agieren mögen.
Fetischismus: Die Selbstbewegung des Kapitals
Allen tatsächlich gegebenen Verschwörungen zum Trotz: Da ist niemand hinter dem Vorhang, der in letzter Instanz die Strippen zöge und den Gang des kapitalistischen Systems "steuerte". Die Menschheit unterm Kapital ist Objekt einer verselbstständigten, widersprüchlichen Dynamik, die sie selber unbewusst, marktvermittelt hervorbringt. Dieser als Fetischismus bezeichnete Prozess der Selbstbewegung des Kapitals konstituiert sich "hinter den Rücken der Produzenten", wie Karl Marx in einer berühmten Formulierung bemerkte.28
Allgemein gefasst, ist der Kapitalismus als eine fetischistische Gesellschaftsformation dadurch gekennzeichnet, dass in ihm "der Produktionsprozeß die Menschen, der Mensch noch nicht den Produktionsprozeß bemeistert", wie es Marx in seinem Hauptwerk "Das Kapital" erklärte.29 Die den Subjekten gegenüber verselbstständigen fetischistischen Verwertungsformen des Kapitals "gelten ihrem bürgerlichen Bewußtsein" als eine "selbstverständliche Naturnotwendigkeit". Dieser Fetischismus durchzieht alle Aggregatzustände, die das Kapital bei seiner Selbstbewegung, seinem Verwertungskreislauf durchläuft, bei dem mittels Warenproduktion und Ausbeutung von Lohnarbeit aus Geld mehr Geld geschaffen wird.
Im Arbeitsprozess wird der lohnabhängige Marktteilnehmer ("Proletarier") zum "variablen Kapital", zur einzigen vom Kapital auf dem Arbeitsmarkt zu erwerbenden Ware, die durch ihre Arbeitsfähigkeit mehr Wert schaffen kann, als sie selber hat. Die Arbeit ist dem Arbeiter "äußerlich", er fühle "sich daher erst außer der Arbeit bei sich und in der Arbeit außer sich", wie es Marx in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten formulierte.30 Dieses Ausgeliefertsein an einen äußerlichen Arbeitsprozess, über dessen Ziel und Verlauf der Arbeiter keine Kontrolle hat, in dem seine Entäußerung Moment der fetischistischen Verwertungsbewegung des Kapitals ist, führt zur Ausbildung des allgegenwärtigen Gefühls der Entfremdung im Kapitalismus.
Die "gezwungene" Arbeit unterm Kapital diene nicht mehr der direkten "Befriedigung eines Bedürfnisses, sondern sie ist nur ein Mittel, um Bedürfnisse außer ihr zu befriedigen", so Marx weiter. Ihre Fremdheit trete "darin rein hervor, daß, sobald kein physischer oder sonstiger Zwang existiert, die Arbeit als eine Pest geflohen wird. Die äußerliche Arbeit, die Arbeit, in welcher der Mensch sich entäußert, ist eine Arbeit der Selbstaufopferung, der Kasteiung."
Ähnlich ohnmächtig scheinen die durch den Konkurrenzzwang voneinander isolierten Marktsubjekte, die nur marktvermittelt in den Warenaustausch treten, also dem Warenfetischismus gegenüberzutreten. Der gesellschaftliche Charakter ihrer eignen Arbeit spiegele sich den Warenproduzenten als gegenständlicher Charakter ihrer Arbeitsprodukte wider, so Marx im berühmten Fetischkapitel seines Hauptwerks.31
Die soziale, im Rahmen der Verwertungsbewegung erzeugte Wareneigenschaft, Wert zu haben (das in ihrem Herstellungsprozess aufgewendete Quantum notwendiger gesellschaftlicher Arbeitszeit), erscheint als eine Natureigenschaft dieser Dinge. Der einzelnen Ware scheint ihre Eigenschaft, Wert zu besitzen, genauso zuzukommen wie ihre sonstigen physischen Eigenschaften. Da diese sozial konstituierte "Wertgegenständlichkeit" der Ware nur beim Warentausch auf dem Markt zum Vorschein tritt, scheint es den isolierten Produzenten so, als handelte es sich dabei um ein "außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen".
Die Dinge "verselbstständigen" sich also marktvermittelt gegenüber den Marktsubjekten, die sie selbst erarbeiten und in Warenform auf den Märkten feilbieten - beseelt vom gesamtgesellschaftlichen Verwertungszwang des Kapitals. Diese Verselbstständigung des Kapitals tritt vor allem auf den Finanzmärkten krass zutage, wo der Fetischismus sich in der abstrakten Geldform manifestiert - und die wichtigste Triebkraft für reaktionäre Krisenideologien samt antisemitischem Wahn bildet.
Gerade in Krisenzeiten, wenn wieder ein "Marktbeben" oder geplatzte Finanzblasen die Stabilität des gesamten Wirtschaftssystems bedrohen, wird evident, dass selbst die Kapitalistenklasse diese fetischistische und destruktive Dynamik des Kapitals keineswegs "unter Kontrolle" hat und der krisenhafte Gang der Dinge im Kapitalismus keineswegs von einer Verschwörung gesteuert wird.
Die fetischistische Realität im Kapitalismus ist gruseliger als die schlimmste Verschwörungsideologie. Mensch wie Natur sind nur Durchgangsstadien eines blind prozessierenden Akkumulationsprozesses abstrakten Reichtums, letztendlich abstrakter Quanta verausgabter, "toter" menschlicher Arbeit. Die Gesellschaft ist aber ein notwendiges Anhängsel der amoklaufenden, realabstrakten Verwertungsbewegung des Kapitals, da Kapital nur durch Lohnarbeit und Ressourcenverfeuerung in der Warenproduktion verwertet werden kann. Soziale Existenz hat letztendlich nur das, was im Rahmen dieses blinden Kreislaufs der Kapitalvermehrung notwendig und finanzierbar ist: also nur das, was zum Wuchern des Kapitals direkt oder indirekt beiträgt.
Dies gilt nicht nur für die "Arbeitsplätze" in der Wirtschaft, sondern auch für den Staatsapparat in seiner Funktion als "ideeller Gesamtkapitalist" (Marx) und sogar für die Kulturproduktion, die in den neoliberalen Vermarktungsstrategien zur Standortoptimierung beizutragen hat - soziale Existenz unterm Kapital steht immer unter dem Vorbehalt ihrer "Finanzierbarkeit". Auf gesamtgesellschaftlicher, globaler Ebene agiert das Kapital als ein "automatisches Subjekt" uferloser, tautologischer Selbstvermehrung.
Die konkrete Welt ist nur "Material" dieser verselbstständigten, realabstrakten Selbstbewegung des Kapitals, das in seinem Wachstumswahn der Menschheit ihre sozialen und ökologischen Existenzgrundlagen entzieht. Die globale Mehrwertmaschine des Kapitals verfeuert die Welt, um den Selbstzweck des Kapitalwachstums möglichst lange aufrechtzuerhalten. Eine anwachsende, ökonomisch "überflüssige" Menschheit und eine eskalierende ökologische Krise sind die Folgen dieser widerspruchsgetriebenen Selbstbewegung des Kapitals.
In Umkehrung der alten Fortschrittsromantik drängt sich somit das Bild eines beständig beschleunigenden, auf einen Abgrund zurasenden Zuges auf, angetriebenen von der Selbstbewegung des Kapitals, die von den Marktteilnehmern unbewusst, konkurrenz- und marktvermittelt hervorgebracht wird. Der überlebensnotwendige transformatorische Akt besteht darin, die Notbremse zu finden und zu betätigen.
Von den Menschen unbewusst hervorgebrachte gesellschaftliche Strukturen, die sich gegenüber den Individuen objektivieren; gesellschaftliche Dynamiken, die sich gegenüber den Subjekten, die sie unbewusst hervorbringen, verselbstständigen - diese absurde Form gesellschaftlicher Reproduktion, die die "Vorgeschichte der Menschheit" (Marx) kennzeichnet, wird auf den Begriff des Fetischismus gebracht.
Folglich sind die Menschen der "aufgeklärten" bürgerlichen Gesellschaft nichts anderes als finstere Fetischdiener. Herrschaft im Kapitalismus ist in letzter Instanz subjektlos, wie der Krisentheoretiker Robert Kurz in seinem Text "Subjektlose Herrschaft" ausführte. Das Kapitalverhältnis herrscht als fetischistische Realabstraktion. Das innere Wesen des Kapitalverhältnisses geht laut Kurz gerade nicht in der schnöden Raffgier der kapitalistischen Menschenschinder auf, die in den neoliberalen Dekaden ihren (größtenteils fiktiven) Reichtum ins Obszöne steigern konnten:
"Ihre ‚individuellen Zwecke‘ sind nicht das, was sie zu sein scheinen; es sind ihrer Form nach keine individuellen, selbstgesetzten Zwecke, und deswegen wird auch der Inhalt pervertiert und mündet in Selbstzerstörung. Das Wesen ist nicht, daß die Individuen sich wechselseitig für ihre individuellen Zwecke benutzen, sondern daß sie, indem sie dies zu tun scheinen, einen ganz anderen, überindividuellen, subjektlosen Zweck an sich selbst exekutieren: die Selbstbewegung (Verwertung) des Geldes."
Die subjektiven, "betriebswirtschaftlichen" Ausbeutungsinteressen der Kapitalisten bilden den äußeren Schein, der das fetischistische Wesen der subjektlosen Herrschaft des Kapitalverhältnisses auf "gesamtwirtschaftlicher" Ebene verdeckt. Generell gilt: Das Kapital kann nur als gesellschaftliche Totalität begriffen werden; Versuche, die Reproduktionsverhältnisse einzelner Kapitale (Betriebe, Konzerne) auf das Gesamtsystem zu projizieren, münden letztendlich in Ideologie.
Die Frage von Schuld und Verantwortung im Kapitalismus
Sobald Menschen als Subjekte im Verwertungskreislauf des Kapitals agieren, werden sie zu Charaktermasken (Marx) ihrer jeweiligen Stellung im Akkumulationsprozess - ob als Fließbandarbeiter, Manager, Verkäufer oder Dienstleister ist in dieser Hinsicht einerlei. Sie sind nicht mehr "bei sich", sondern agieren als die Personifikation ihrer jeweiligen ökonomischen Funktion (dies bildet ja die Grundlage der besagten Entfremdungsgefühle).
Marx bezeichnet etwa den Kapitalisten in seiner Funktion als Charaktermaske als "personifiziertes, mit Willen und Bewußtsein begabtes Kapital", das als "Ausgangspunkt und Rückkehrpunkt" des Selbstzwecks der maßlosen Zirkulation des Kapitals fungiert. Der "objektive Inhalt jener Zirkulation - die Verwertung des Werts - ist sein subjektiver Zweck", so Marx im "Kapital".32
Was hier aufscheint, ist die absurde Stellung des Marktsubjekts innerhalb des Automatismus der Kapitalverwertung. Das Kapital als automatisches Subjekt macht die Menschen einerseits zu Objekten seiner Verwertungsbewegung, zu Dingen und Waren, die auf dem Arbeitsmarkt gehandelt werden - und die sich dieser vermittelten Form der subjektlosen Herrschaft wie einem menschengemachten Naturgesetz mit einem unterschwelligen Gefühl von Ohnmacht anzupassen haben.
Zugleich besteht die einzige Chance, noch eine schale Imitation von Subjektivität auszuleben, darin, dass man als besagte ökonomische Charaktermaske daran mitwirkt, diesen Automatismus uferloser Kapitalverwertung "subjektiv" zu perfektionieren, und hierbei wiederum "die Anderen" zu Objekten degradiert und "den Dingen gleichmacht". Innerhalb des Fetischismus, den das automatische Subjekt perpetuiert, sind die Insassen der kapitalistischen Tretmühle immer beides zugleich: Subjekt der Akkumulation und deren ohnmächtiges Objekt.
Alle Charaktermasken, alle Personifikationen ihrer jeweiligen ökonomischen Funktion fungieren folglich als Subjekt-Objekte der verselbstständigten Verwertungsbewegung, die sie selber aufrechterhalten, wobei das konkrete Verhältnis zwischen diesen beiden Polen von der konkreten hierarchischen Stellung im Reproduktionsprozess des Kapitals abhängt. Es ist diese hierarchische Stellung der Subjekte innerhalb des Automatismus der Kapitalverwertung, die bei der Frage nach der Kategorie der Schuld, der persönlichen Verantwortung berücksichtigt werden muss. Selbstverständlich spricht der Fetischismus des Kapitals die Akteure, die diesen exekutieren, nicht frei.
Das andere Extrem zur manischen Sündenbocksuche in Krisenzeiten stellt ein ohnmächtiges Systemdenken dar, bei dem die gegenwärtigen Akteure in Wirtschaft und Politik exkulpiert werden. Bei dieser Sichtweise scheint es so, als wären die Verantwortlichen vor lauter Systemzwängen und objektiven Strukturgesetzten nicht mehr auszumachen.
Die konkreten Täter verschwinden hinter dem zerstörerischen Walten des automatischen Subjekts der kollabierenden Verwertungsdynamik des Kapitals. Insbesondere während der Griechenlandkrise - des brutalen Exempels, das Deutschland an Hellas exekutierte33 - zogen sich die kleinbürgerlichen Verfallsprodukte der wertkritischen deutschen Linken auf diese bequeme Position zurück.
Dass der Fetischismus der kapitalistischen Gesellschaft, in der die marktvermittelten Handlungen der Subjekte diesen als eine fremde, quasi-objektive Kraft entgegentreten, keineswegs zu einer Exkulpierung der Taten der Täter führt, hat Robert Kurz schon zu Beginn des 21. Jahrhunderts dargelegt:34
"Wenn nun der gemeinsame Formzusammenhang von abstrakter Arbeit, Warenform, Staatsbürgerlichkeit usw. ins Blickfeld der Kritik rückt, wo bleibt da die Verantwortlichkeit? Kann man einen blinden Strukturzusammenhang, kann man das automatische Subjekt für irgend etwas verantwortlich machen, und sei es das größte Verbrechen? Und umgekehrt: Wenn die kapitalistische Barbarei letzten Endes in den stummen Zwängen der Konkurrenz usw. angelegt ist, sind dann nicht die barbarischen Taten der hässlichen Manager, der schmutzigen Politiker, der bürokratischen Krisenverwalter, der blutigen Schlächter des Ausnahmezustands irgendwie entschuldigt, weil immer bedingt und eigentlich durch die subjektlosen Strukturgesetze der ‚zweiten Natur‘ verursacht?
Eine solche Argumentation vergisst, dass der Begriff des automatischen Subjekts eine paradoxe Metapher für ein paradoxes gesellschaftliches Verhältnis ist. Das automatische Subjekt ist keine aparte Wesenheit, die für sich irgendwo dort draußen hockt, sondern es ist der gesellschaftliche Bann, unter dem die Menschen ihr eigenes Handeln dem Automatismus des kapitalisierten Geldes unterwerfen.
Wer aber handelt, das sind immer die Individuen selbst. Konkurrenz, künstlich erzeugter Überlebenskampf, Krisen usw. treiben die Potenz der Barbarei hervor, aber praktisch vollstreckt werden muss diese Barbarei von den handelnden Menschen, also auch durch ihr Bewusstsein hindurch. Und deshalb sind die Individuen auch subjektiv verantwortlich für ihr Tun, der hässliche Manager und der schmutzige Politiker ebenso wie andererseits der rassistische Arbeitslose und die antisemitische alleinerziehende Mutter.
Das ungeheuere Angst- und Drohpotential dieser Gesellschaft muss tagtäglich verarbeitet werden, und jeden Moment treffen die Individuen dabei Entscheidungen, die niemals völlig alternativlos sind - weder im alltäglichen kleinen noch im gesellschaftlich-historischen großen Maßstab. Niemand ist einfach nur eine willenlose Marionette, sondern alle müssen die haarsträubenden Widersprüche, die Ängste und Leiden dieses Banns selber ausagieren.
Deshalb ist es kein Widersinn, die notwendige Gesellschaftskritik auf die Ebene der sozial übergreifenden Strukturen, auf die abstrakte Arbeit und das automatische Subjekt zu richten, gleichwohl aber die handelnden Individuen für ihr Tun verantwortlich zu machen, auch wenn ihre gesellschaftliche Charaktermaske ihnen den Zustand der Unzurechnungsfähigkeit nahelegt."
Ein Donald Trump oder Jeff Bezos sind als Subjekte, die den widersprüchlichen Automatismus der Kapitalakkumulation auf politischer und wirtschaftlicher Ebene exekutieren, für ihre Taten voll verantwortlich. Die Manager von Exxon & Co., die mit Millionenbeträgen Klimaleugner finanzierten, können sich nicht durch Berufung auf Systemzwänge exkulpieren. Dies gilt auch für einen Wolfgang Schäuble, der für all das voll verantwortlich ist, was er Griechenland und Südeuropa angetan hat; aber dies gilt auch für den kleinen gemeinen Forentroll, der für all die Hetze verantwortlich ist, die er im Netz absondert - auch wenn mit diesen Handlungen nur die systemische Krisendynamik auf politischer oder ideologischer Ebene exekutiert wird.
Wobei selbstverständlich die historische Schuld, die ein Egomane wie Trump oder ein Sparsadist wie Schäuble auf sich geladen hat, weitaus höher wiegt als die kläglichen Absonderungen eines einzelnen politischen Borderliners der Neuen Rechten in Zeitungsforen oder sozialen Netzwerken.
Die große Schuldfrage in Bezug auf die subjektlose Herrschaft des Kapitals lässt sich nun auch in Hinblick auf die Krisendynamik präzisieren: Die Krise als historischer Prozess ist Folge der zunehmenden inneren Widersprüche des Kapitals, die den Subjekten als zunehmende "Sachzwänge" gegenübertreten.
Deswegen gilt es schlicht festzustellen, dass absolut niemand die Schuld am Krisenausbruch trägt - und schon gar nicht ist die Krise von irgendwelchen Verschwörern "inszeniert" worden. Die Krise brach gerade deswegen aus, weil die Marktsubjekte genau das immer effizienter tun, was das System von ihnen verlangt: Lohnarbeit zwecks uferloser Kapitalakkumulation verwerten. Je effektiver Lohnarbeit verwertet wird, desto größer der Druck, desto stärker zieht sich die Schlinge marktvermittelt um den Hals aller Marktsubjekte zu.
Die erste, in ideologische Verblendung führende falsche Frage, die sich dem verdinglichten Bewusstsein wie selbstverständlich bei Krisenausbruch aufdrängt, ist die nach der Krisenschuld. Gerade umgekehrt wird ein Schuh draus: Persönliche Schuld muss im "Alltag" der Kapitalverwertung, im "Normalvollzug" der kapitalistischen Tretmühle gesucht werden: bei der konkreten ökonomischen Ausbeutung, der politischen Unterdrückung und der Ideologieproduktion, die den Automatismus des Systems am Laufen halten.
Während also niemand "Schuld" trägt an dem Ausbruch der Systemkrise, deren Dynamik sich quasi "hinter dem Rücken der Produzenten" (Marx) entfaltet, ist es gerade das alltägliche Funktionieren des Systems - die marktvermittelte Unterdrückung, Ausbeutung und Ideologieproduktion -, in dessen Verlauf all die Individuen Schuld auf sich laden, die als "Charaktermasken" ihrer kapitalistischen Funktionen die Systemzwänge bewusst exekutieren. Mehr noch: In Wechselwirkung mit der Krisendynamik werden gerade die Ausbeutung, die Unterdrückung und die Lügenproduktion des Systems ins Absurde gesteigert.
Wenn, wie in den neoliberalen Dekaden, die Ausbeutung der Lohnabhängigen immer weiter zunimmt, so deutet dies auf einen systemischen Krisenprozess hin, der auf den Rücken der Lohnabhängigen perpetuiert wird. Und das gilt umso mehr, wenn ein "Normalarbeitsverhältnis" zur Ausnahme wird und, global betrachtet, immer mehr Menschen vom Kapital gar nicht mehr ausgebeutet werden können, weil sie überflüssig sind und daher nichts anderes als "unnütze Esser".
Klassenkampf als Verteilungskampf
Die Zunahme der Ausbeutung, der Verelendung und Prekarisierung auch in den Zentren des kapitalistischen Weltsystems muss folglich als eine Systemreaktion auf einen tiefgreifenden, historischen Krisenprozess verstanden werden, wie er im vorigen Kapitel skizziert wurde. Es ist gerade die absurd anmutende Spaltung zwischen Arm und Reich, zwischen den Massen der prekarisierten und pauperisierten Lohnabhängigen sowie den Fantastzillionen an größtenteils fiktivem Kapital, die einige wenige Milliardäre zu halten scheinen, die auf die Systemkrise verweist - wie auch auf einen Mangel an profitträchtigen Investitionsmöglichkeiten in der realen Warenwirtschaft, der eine entsprechende Verlagerung auf Spekulationstätigkeiten in der Finanzsphäre mit sich bringt ("Finanzialisierung des Kapitalismus").
Diese Krisenfolgen treten allen Akteuren als zunehmende, objektivierte Widersprüche oder "Sachzwänge" gegenüber. Die Subjekte reagieren darauf systemimmanent mit einer Intensivierung der Konkurrenz: Politiker und Staaten, die im Rahmen der Standortkonkurrenz Sozialabbau durchsetzen, Konzerne, die immer brutalere Formen der Ausbeutung finden, Lohnschreiber, deren Opportunismus bei der Ideologieproduktion keine Grenzen zu kennen scheint, Lohnabhängige, die verstärkt zu Mobbing übergehen.
Der marktvermittelte stumme Zwang der immer "härter" werdenden Verhältnisse nötigt die Charaktermasken ihrer jeweiligen gesellschaftlichen Funktion dazu, diesen bei Strafe des eigenen Untergangs zu exekutieren. Derjenige Kapitalist, der es im zunehmenden Konkurrenzkampf auf den "enger" werdenden Märkten nicht vermag, die Ausbeutung seines Menschenmaterials zu steigern, wird in der Krisenkonkurrenz untergehen. Dasselbe gilt für die kapitalistischen Volkswirtschaften als nationale "Standorte", die sich ebenfalls in einem krisenbedingten Wettlauf nach unten befinden.35
Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen scheint nun auch eine klare Einschätzung des Klassenkampfs möglich. Hierbei handelt es sich somit um einen Verteilungskampf innerhalb des Reduktionsprozesses des Kapitals, dessen Intensität von dessen konkreter historischer Widerspruchsentfaltung bestimmt wird. In Perioden starker ökonomischer Expansion, wie in der Nachkriegskonjunktur bis in die 1970er, können Formen der "Sozialpartnerschaft" zwischen den Funktionseliten des Kapitals und den Gewerkschaften als Vertretern der Lohnabhängigen (des "variablen Kapitals" bei Marx) aufkommen.
Solange die Märkte stark expandieren, können hohe Profite mit Löhnen vereinbart werden, die Lohnabhängige zu Konsumenten machen. Dies ändert sich schnell in Krisenperioden, wenn es für jeden Kapitalisten vornehmlich darum geht, den irrationalen Selbstzweck der Kapitalakkumulation notfalls auch auf Kosten der eigenen Lohnabhängigen zu perpetuieren.
Dem Klassenkampf als Verteilungskampf wohnt somit keine objektive transformatorische Potenz inne. Es ist ein Kampf um Anteile an einer krisenbedingt abschmelzenden realen Wertproduktion - ohne aber diese irrationale Form gesellschaftlicher Reproduktion infrage zu stellen. Der Klassenkampf (auch der historische Klassenkampf vergangener Zeiten) bewegt sich also in den Formen kapitalistischer Vergesellschaftung (Wert, Arbeit, Kapital, Staat) und sucht Emanzipation und Anerkennung in diesen Kategorien, statt gegen sie.
Der sich verschärfende Klassenkampf ist somit ein Verteilungskampf. Die Militanz, mit der dieser krisenbedingt eskalierende "Klassenkrieg" (Warren Buffet) propagiert wird, verdeckt seine mangelnde Radikalität, da die Krisenursachen und die fetischistische Form gesellschaftlicher Reproduktion im Kapitalismus nicht reflektiert werden. Dies gilt auch für die ökologische Schranke des Kapitals, da durch bloße soziale Verteilungspolitik der kapitalistische Wachstumszwang mit seinem beständig wachsenden Ressourcenhunger nicht überwunden wird.
Die gegenwärtigen sozialen Verhältnisse scheinen auch deswegen den Pauperismus früherer Zeiten zu ähneln, weil die historische "Aufstiegsphase" der Arbeiterklasse im 18. und 19. Jahrhundert soziale Parallelen zu der gegenwärtigen Abstiegsphase des Kapitals und der Arbeiterklasse aufweist. Das gegenwärtig um sich greifende Elend innerhalb der erodierenden Klasse der Lohnabhängigen in den Zentren des Weltsystems spiegelt somit das Elend ihrer historischen Ausformung.
Um es plastisch auszudrücken: Das Fundament, auf dem die Klassenakteure agieren, die Verausgabung von Lohnarbeit in der Warenproduktion, zerfällt zunehmend. Die einseitige Klassenkampfrhetorik verdeckt vor allem, dass die Klassen selbst krisenbedingt in Auflösung begriffen sind. Das Proletariat zerfällt in jene ökonomisch "überflüssige" Schicht von Menschen, die verzweifelt in die Kernregionen des kapitalistischen Weltsystems fliehen. Der Kapitalist macht im Prozess der Verwilderung des Kapitals dem Oligarchen und letztendlich - im Endstadium des Krisenprozesses in der Peripherie - dem Warlord Platz.
2.3 Die Weltvernichtungsmaschine: ökologische Grenzen des Kapitals
"Abstraktionen in der Wirklichkeit geltend machen, heißt Wirklichkeit zerstören."
Hegel
Es gab bislang im 21. Jahrhundert genau zwei Jahre, in denen der oberflächliche Eindruck entstehen konnte, die Reduktion der CO2-Emissionen wäre im Rahmen des spätkapitalistischen Weltsystems doch noch irgendwie möglich: zuerst war dies anno 2009 der Fall. Tatsächlich gingen in diesem Jahr die globalen Emissionen von Treibhausgasen gegenüber dem Vorjahr deutlich zurück. Doch war dieser Rückgang schlicht auf die Weltwirtschaftskrise zurückzuführen, die alle wichtigen Wirtschaftsräume nach dem Platzen der transatlantischen Immobilienblasen in Europa und den USA heimsuchte. Als die Finanzmärkte im Gefolge der Pleite von Lehman Brothers einfroren, 2009 die Weltwirtschaftskrise voll ausbrach, die USA und Europa mit heftigen Konjunktureinbrüchen zu kämpfen hatten und die ersten Pauperisierungsschübe die amerikanische Mittelklasse und Südeuropas Krisenstaaten erfassten - nur dann gingen auch die Kohlendioxidemissionen global um rund ein Prozent zurück. Offensichtlich sind nur heftige Rezessionen imstande, die Emissionen von CO2 zu senken.36 Hiernach folgte das Pandemiejahr 2020, in dem der globale Ausstoß von Treibhausgasen ebenfalls leicht zurückging, um hiernach wieder kräftig anzusteigen.
Dabei war es gerade die "erfolgreiche" binnenkapitalistische Krisenbekämpfung, die diese Illusion eines kapitalismuskompatiblen Klimaschutzes sehr schnell zerstörte. Um den Absturz der Weltwirtschaft zur verhindern, legten die führenden Industrienationen und Wirtschaftsräume 2009 und 2020 massive Konjunkturprogramme auf, um kreditfinanziert Nachfrage zu generieren – etwa bei Staatsinvestitionen in die Infrastruktur und den Immobiliensektor (China) oder bei Konsumspritzen wie der berüchtigten und ökologisch unsinnigen deutschen "Abwrackprämie", als ältere PKW von ihren Besitzern verschrottet werden konnten, um Neufahrzeuge mit staatlichen Zuschüssen zu erwerben. Das Ziel war dasselbe: Nachfrage für eine warenproduzierende Industrie zu schaffen, um deren konjunkturellen Absturz samt Massenarbeitslosigkeit und Verelendung zu verhindern.
Die staatlichen Programme, die zur Aufrechterhaltung des stotternden kapitalistischen Konjunkturmotors aufgewendet wurden, erreichten auf globaler Ebene enorme Dimensionen. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) bezifferte den weltweiten Umfang der staatlichen Konjunkturhilfen 2009 auf rund drei Billionen US-Dollar. Dieser gigantische staatliche Nachfrageschub entsprach laut IfW ca. 4,7 Prozent des Welteinkommens.
Die Vereinigten Staaten haben dabei mit Aufwendungen in Höhe von 972 Milliarden US-Dollar das größte Konjunkturprogramm aufgelegt, das circa 35 Prozent der globalen Gesamtausgaben umfasste. Dieser in zwei Konjunkturgesetzen vom Februar und Oktober 2008 verabschiedete Nachfrageschub entsprach beeindruckenden 7,1 Prozent des damaligen amerikanischen Bruttoinlandsprodukts. In Relation zur eigenen Wirtschaftsleistung wurden diese Aufwendungen aber vom chinesischen Konjunkturpaket weit in den Schatten gestellt. Die 586 Milliarden US-Dollar, die Peking zur Stützung der Wirtschaft aufwendete, entsprachen 14 Prozent des damaligen chinesischen BIP und trugen maßgeblich zu Chinas weiterem, durch Spekulationsblasen auf den Immobiliensektor und den Finanzmarkt angetriebenen rasanten Konjunkturaufschwung bei.
Die wirtschaftlichen Stimulierungsmaßnahmen der EU und Japans erreichen immerhin einen Anteil von jeweils circa 15 Prozent an den weltweiten staatlichen Konjunkturausgaben. Aufgrund des unterschiedlichen Bruttoinlandsprodukts ergibt sich aber eine ganz anders zu gewichtende Auswirkung dieser Aufwendungen. Die 468 Milliarden US-Dollar des japanischen Konjunkturprogramms entsprechen circa neun Prozent der Wirtschaftsleistung Nippons, während die von den europäischen Einzelstaaten und der Europäischen Investitionsbank aufgelegten Stimulierungsmaßnahmen gerade 1,6 Prozent des BIP aller Mitgliedsländer der Europäischen Union betrugen – hier trug der deutsche Sparsadismus, exekutiert vom obersten europäischen Sparkommissar Wolfgang Schäuble, maßgeblich zur miesen, vom Berliner Austeritätsdiktat verschuldeten Konjunkturentwicklung im Verlauf der Eurokrise bei.37
Diese Politik war global dahingehend "erfolgreich", als dass der konjunkturelle Absturz - mit Ausnahme des von Berlin in die Depression getriebenen Südeuropas - verhindert werden konnte und trotz aller sozialer Erosionsprozesse, die vor allem die US-Mittelklasse dezimierten, eine langwierige Weltwirtschaftskrise nach dem Muster der 30er-Jahre des 20. Jahrhunderts - bislang - abgewendet werden konnte. Ökologisch war dieses erfolgreiche keynesianische Wirtschaftsmanöver aber schlicht verheerend.