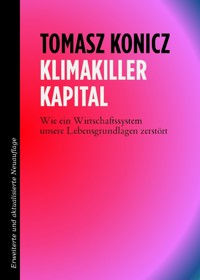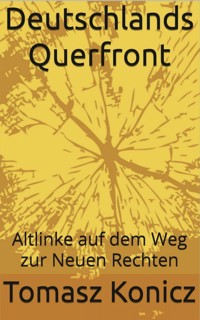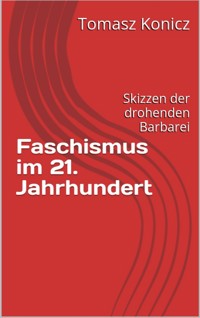
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wohin treiben die beständig nach rechts abdriftenden Gesellschaften in den Zentren des kapitalistischen Weltsystems? Mit jeder neuen Wahl scheint der Durchmarsch der Neuen Rechten unaufhaltsam voranzuschreiten. Die Verrohung des öffentlichen Diskurses, die zunehmende rechte Gewalt, die rasch voranschreitende Aushebelung von Grundrechten - sie lassen Erinnerungen an den Vorfaschismus der 30er Jahre aufkommen. Für Tomasz Konicz ist dies kein Zufall. In den hier versammelten Beiträgen werden Parallelen zwischen dem Aufstieg des Faschismus im Europa der Zwischenkriegszeit und dem gegenwärtigen Durchmarsch der Neuen Rechten gezogen. Zentral ist hierbei der Krisenprozess der spätkapitalistischen Gesellschaften, der in Wechselwirkung mit dem politischen Aufstieg der extremen Rechten steht: von der Weltwirtschaftskrise von 1929 bis zur gegenwärtigen Systemkrise. Faschismus soll hierbei als eine Extremform von Krisenideologie demaskiert werden, die in Krisenzeiten mittels Gewalt und Terror eine im Zerfall begriffene kapitalistische Gesellschaftsformation aufrechtzuerhalten versucht - und diese in die Barbarei treibt. Diese Neuveröffentlichung des zuvor beim Heise-Verlag erschienen E-Books ist umfassend aktualisiert und erweitert worden. Das Buch, das nun mit der berüchtigten Sarrazin-Debatte einsetzt, verschafft somit dem Leser einen guten zeithistorischen Überblick über die Genese, die Ausformung, die den extremistischen Werdegang der neuen deutschen Rechten in einer Bundesrepublik, in der die mit Rechtsextremisten durchsetzte AfD zur zweitstärksten politischen Kraft aufsteigen konnte. Zudem werden im abschließenden Kapitel Möglichkeiten einer antifaschistischen Praxis in der gegenwärtigen Systemkrise diskutiert. Tomasz Konicz, geb. 1973, arbeitet als Publizist und freier Journalist mit den Schwerpunktthemen Krisenanalyse und Ideologiekritik. Den theoretischen Hintergrund seiner Beiträge bilden die Wertkritik und die Weltsystemtheorie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 708
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
1. Einleitung
2. Systemkrise und Neue Rechte
2.1 Der Terror der Ökonomie (2018)
2.2 Die Nation in der Krise
2.3 Politische Ökonomie des Krisennationalismus
2.4 Zur Wiederkehr der nationalistischen Ideologie
2.5 Willkommen in der Postdemokratie
2.6 Freihandel und Flüchtlinge
2.7 Vertikal vs. Horizontal
2.8 Neue kapitalistische Nähe
2.9 Transatlantische Entkopplung?
2.10 Deutschlands Exportsackgasse
2.11 Konjunktur für Faschismus
2.12 Die Klimakrise und die äußeren Grenzen des Kapitals
3. Die Mitte und ihr Extremismus
3.1 Sarrazins Sieg
3.2 Sarrazin für Fortgeschrittene
3.3 Pegida - die Generation Sarrazin
3.4 Autobahn und Ausländerhass
3.5 Die "Lügenpresse" und ihre Lügenfressen
3.6 "Absaufen!" - Pro und Contra
3.7 Tanz den Adolf Gauland
3.8 Forum für neurechten Elitenzüchter
3.9 Besetzt!
3.10 Wahn, wenn nicht jetzt?
3.11 Die Verbrechen des Bill Gates
3.12 Leipziger Corona-Randale
3.13 "Die Corona-Proteste sind eine rechtsradikale Sammlungsbewegung"
3.14 Captain Ancap is watching you!
4. Psychopathologie der Neuen Rechten
4.1 AfD: Die Partei für die weniger Intelligenten?
4.2 AfD: Nur ein stummer Schrei nach Liebe?
4.3 Ich will, wo Es ist
4.4 Der alte Todesdrang der Neuen Rechten
5. Das Geld im Hintergrund
5.1 Das Establishment hinter den Rechtspopulisten
5.2 AfD: Die Masken fallen
5.3 Goldene Geschäfte mit der Panik
5.4 Trübe Finanzquellen
5.5 Die große AfD-Geldverschwörung
5.6 Nationalismus muss sich wieder lohnen!
6. Antisemitismus im 21. Jahrhundert
6.1 Der letzte Dammbruch
6.2 Der "ewige Jude" hat Konjunktur
6.3 Der ewige Soros
6.4 Antisemitische Kontinuität
6.5 Antisemitismus im Wandel der Zeiten
7. Islamismus und Faschismus
7.1 Von grünen und braunen Faschisten
7.2 Fluchtpunkt Amok
7.3 Globalisierte Barbarei
8. Alte Neue Rechte
8.1 Die Bewegung als Bewegung
8.2 Donald Trump und die Zeit des irrationalen Grenzgängers
8.3 Abschied vom Menschenrechtsimperialismus?
8.4 "Ukraine über Alles!"
8.5 Polnische Postdemokratie
8.6 Österreichs "Baby-Hitler" schlägt zurück!
8.7 Österreich: Mit permanenten Tabubrüchen wird eine neue Normalität geschaffen
8.8 Strache im Sommerschlussverkauf
8.9 Ungarn: "Kultur des Faschismus"
8.10 Von Judenzählern, Horthy-Verehrern und völkischen Ornithologen
8.11 Roma zwischen Segregation, Pogrom und Vertreibung
8.12 Deutschland: Vom Rechtspopulismus zum Rechtsterrorismus
8.13 Rechter Terror als neue Normalität?
8.14 AfD: Keiner kann mehr sagen, von alldem nichts gewusst zu haben
8.15 Eine ganz normale (Nazi-) Partei?
8.16 Papst vs. Bannon
9. Barbarei im 21. Jahrhundert
9.1 Outsourcing der Barbarei
9.2 Klima für Extremismus
9.3 Der Exodus der Geldmenschen
9.4 KI und Kapital: Maschinenkult und Menschenhass
10. Antifaschistische Praxis in der Krise
10.1 Was tun gegen Faschismus im 21. Jahrhundert?
10.2 Radikalität vs. Extremismus
10.3 Wieso Antifaschismus?
Impressum
Tomasz Z. Konicz
Faschismus im 21. Jahrhundert
Skizzen der drohenden Barbarei
Erweiterte und aktualisierte Neuausgabe.
Hannover, Januar 2024
Version 2.0
Impressum © 2024 Tomasz Konicz
Tomasz Konicz
Glimmerweg 21
30455 Hannover
Alle Rechte vorbehalten
Kein Teil dieses Buches darf ohne ausdrückliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, fotokopiert, aufgezeichnet oder auf andere Weise übertragen werden.
1. Einleitung
"Weil man ja gegen irgendwen sein muss, und mit denen ist es einfach."
Chemnitz, August 2018
Der alltägliche Triumph der AfD besteht schlicht darin, dass es sie gibt, dass sie existiert. Das reicht, um der Verrohung, der Barbarisierung Vorschub zu leisten. Die bloße Existenz dieser ins Faschistische abdriftenden Formation, die selbst ein Verfassungsschutz, der einen Hans Georg Maaßen hervorbrachte, in etlichen Bundesländern als "gesichert rechtsextremistisch" einstuft, verschiebt die Grenzen des Sagbaren. Sie wirkt alltäglich als Faktor in Politik, Öffentlichkeit und im Alltagsleben. Und dies führt dazu, dass Gewöhnungseffekte einsetzen - selbst bei all jenen Menschen, die ihr opponieren. Die braunen Absonderungen der Neuen Rechten werden zum Alltag, sie gehen ein ins große kulturindustrielle Hintergrundrauschen der spätkapitalistischen Gesellschaft.
Was im Alltagstrott aber als ein statischer Zustand erscheint, wird erst aus zeitgeschichtlicher Distanz als sozialer Prozess, als gesellschaftliche Entwicklung sichtbar. Nichts "ist", alles wird. Die AfD ist Teil einer reaktionären, ins offen Faschistische strebenden Dynamik, die viele Gesellschaften in den westlichen Zentren des Weltsystems erfasst hat und bereits sehr weit vorangeschritten ist. In der Bundesrepublik hat sie in weiten Bereichen des öffentlichen Diskurses die Hegemonie errungen und steht 2024 an der Schwelle der Machtübertragung.
Die hier versammelten Texte, die in den vergangenen 14 Jahren verfasst worden sind, zeigen zuallererst, wie es dazu kommen konnte, dass im Land der Täter die geistigen Erben der Nazis im 21. Jahrhundert abermals Morgenluft wittern können. Diese Textsammlung ist eine im Präsenz verfasste Darstellung des Aufstiegs der Neuen Rechten, der Verrohung, der Barbarisierung und offenen Faschisierung der Bundesrepublik. Die Lektüre soll somit auch den erwähnten Gewöhnungseffekten entgegenwirken, bei denen der Präfaschismus zur einen "Normalität" gerinnt und die drohende Barbarei kaum noch als Bedrohung wahrgenommen wird von einer bürgerlichen Demokratie, die langsam weichgekocht wird - gleichsam dem sprichwörtlichen Frosch im langsam sich erhitzenden Wasser.
Woran hat sich die bundesrepublikanische Gesellschaft inzwischen gewöhnt, kraft der Alltagsmacht des Faktischen? Sie hat sich an die perverse Opferpose rechter Hetzer gewöhnt, wie sie in der Sarrazin-Debatte als den irren Urknall der neuen deutschen Rechten etabliert wurde. Zur Normalität ist die offene Hetze gegen sozial Marginalisierte und Minderheiten geronnen, die zuvor nur am Stammtisch üblich war. Antisemitische Ausfälle sind längst keine Karrierekiller mehr, sie fungieren eher als Wahlkampfhilfe, wie der Skandal um Hubert Aiwangers antisemitisches Flugblatt zeigte. Der blanke faschistoide Wahn, wie er in der rechtsextremen Sammlungsbewegung der Pandemieleugner ausbrütete, fordert seinen Platz im öffentlichen Diskurs ein. Deutschland hat sich auch mit dem rechten Terror arrangiert, dem nicht nur Flüchtlinge und Minderheiten zum Opfer fallen, sondern auch Staatsrepräsentanten.
Die Texte decken die wichtigsten Schübe dieses Formierungsprozesses der Neuen Rechten ab: von der Sarrazin-Debatte, die durch Abstiegsängste der Mittelschichten nach dem Krisenschub von 2008-09 befördert wurde, über die Eurokrise mit dem Feindbild des "faulen Südländers", die Flüchtlingskrise mitsamt der Hasskampagne gegen Migranten, die Ära irrer Verschwörungstheorien und gewalttätiger Aktionen während der Pandemie, bis hin zur gegenwärtigen Situation, in der die Stagflation und das Ende des deutschen Exportbooms der Neuen Rechten weiteren Auftrieb zu verschaffen drohen. Es waren somit die großen Krisenschübe der letzten Jahre, die der Neuen Rechten immer wieder Auftrieb verschafften. Dabei ist die demokratische Fassade dieser reaktionären Bewegung, die sich anfänglich so gerne als unterdrückte Minderheit darstellte, schon 2018 im sächsischen Chemnitz zerbrochen.
Der Spätsommer 2018 dürfte somit als die Zeitperiode in die bundesdeutsche Zeitgeschichte eingehen, in der die Neue Deutsche Rechte ihre demokratische Fassade endgültig fallen ließ. Unter Instrumentalisierung eines durch Flüchtlinge begangenen Totschlags tobte Ende August 2018 ein brauner Mob durch die Straßen der sächsischen Stadt Chemnitz, der - weitgehend unbehelligt vor der "überforderten" Polizei – Jagt auf Migranten und all jene Menschen machte, die nicht ins faschistische Weltbild passen.
Der offene Straßenterror, an dem sich bis zu 8000 Faschisten und deren Sympathisanten aus der "Mitte" der Gesellschaft beteiligten, machte schlagartig die wachsende Akzeptanz rechtsextremistischer Ideologie und Praxis in breiten Teilen der deutschen Bevölkerung offensichtlich. Die massenmediale Fassade von den irregeleiteten "besorgten Bürgern", die jahrelang um die Neue Deutsche Rechte vom Medienbetrieb und der Politik aufgebaut wurde, ist nach dem Exzess von Chemnitz nicht mehr aufrechtzuerhalten.
Diese faschistische Wende wurde von der AfD bewusst forciert, die den rechten Straßenterror von Chemnitz umgehend rechtfertige. Der AfD-Führer Alexander Gauland erklärte, bei den pogromartigen Ausschreitungen handelte es sich um "Selbstverteidigung".1Es sei normal, dass nach einer solchen Tötungstat die Menschen "ausrasten". Dabei war der Spitzenpolitiker der AfD mit dieser Einschätzung beileibe nicht allein. Umfragen, die kurz nach den Ausschreitungen durchgeführt wurden, legten eine wachsende Akzeptanz faschistischer Gewalt in der Bundesrepublik offen: Nur 62 Prozent der befragten Ostdeutschen konnten sich dazu durchringen, die Ausschreitungen zu verurteilen, im Westen waren es 72 Prozent.2
Eine der Bürgerinnen in Chemnitz, die mit den Nazis marschierte und dabei beteuerte, kein Nazi zu sein, machte gegenüber Spiegel-Online in entwaffnender Offenheit klar, was die Anziehungskraft faschistischer Bewegungen ausmacht. Auf die Nachfrage des Reporters, wieso ihre Klage über die soziale Spaltung des Landes nicht zu einem Engagement für "Umverteilung" führe, sondern sich im Hass auf Ausländer und Flüchtlinge entlade, antwortete die kurz vor ihrer (mageren) Verrentung stehende Bestatterin: "Weil man ja gegen irgendwen sein muss, und mit denen ist es einfach." Es ist einfach, Faschist zu sein.3
Es ist somit der alte Untertannencharakter, der auch im 21. Jahrhundert den Faschismus auftrieb verschafft. Unzufriedenheit und Ängste, die angesichts zunehmender Krisentendenzen gerade in der Mitte der kapitalistischen Gesellschaften aufkommen, führen nicht zur Opposition oder zu kritischer Reflexion, sondern zu einer manischen Suche nach sozial schwachen Sündenböcken. Es ist so einfach, sich dem Wahn zu ergeben. Und es ist oftmals auch dem Faschisten klar, dass keine kausale Beziehung besteht zwischen den beklagten sozialen Verwerfungen – wie der obszönen Schere zwischen Arm und Reich in der Bundesrepublik – und den hierfür verantwortlich gemachten, zumeist ohnehin marginalisierten Bevölkerungsgruppen, wie den Flüchtlingen.
Die Begriffe der konformistischen Rebellion und der autoritären Revolte sind somit unabdingbar, um den Aufstieg des Faschismus in Krisenzeiten zu erhellen. Der zunehmende Druck, die zunehmenden Abstiegsängste, denen nahezu alle Gesellschaftsschichten ausgesetzt sind, sie erhalten in dem Hass auf Krisenopfer ihr irrationales Ventil. Ohne die Gefahren einer echten Revolte einzugehen, die sich immer gegen mächtige soziale Gruppen und bestehende Machtstrukturen richtet, kann der Faschist sich in die absurde Pose des konformistischen Rebellen werfen, in der er sich einerseits im Kampf gegen mächtige Verschwörungen wähnt, doch eigentlich nur das tut oder sagt, was alle, die von ihm imaginierte große schweigende Mehrheit, heimlich wollten. Die Hetze und das Pogrom gegen sozial schwache Minderheiten wandelt sich in der faschistischen Ideologie folglich zum Kampf gegen mächtige, im Verborgenen agierende Gegner.
Ein Schwerpunkt der vorliegenden Textsammlung liegt gerade auf der umfassenden Darstellung der Genese und der Verlaufsform des Ins-Extrem-Treibens dieser konformistischen Rebellion des Faschismus im 21. Jahrhundert. Dabei reift die totalitäre Gefahr nicht an den "Rändern", sondern gerade in der Mitte der spätkapitalistischen Gesellschaften heran. Die im 3. Kapitel zusammengestellten Texte fassen diese Tendenzen unter dem Begriff des Extremismus der Mitte zusammen. Die Kernthese, an der sich dieses Kapitel orientiert, interpretiert den Faschismus als die politische Kraft, die das latent gegebene, barbarische Potenzial kapitalistischer Vergesellschaftung in Krisenzeiten manifest werden lässt. Hierdurch soll eine zentrale Fragestellung erhellt werden: Wieso befindet sich in nahezu allen Industriegesellschaften in Krisenzeiten gerade die extreme Rechte im Aufschwung?
Die Ursachen des Aufstiegs der neuen Rechten müssen somit in dem Krisenprozess verortet werden, in dem das spätkapitalistische Weltsystem sich befindet. Dieser wird in Kapitel 2 diskutiert, wobei der Schwerpunkt der Textsammlung auf das Spannungsverhältnis zwischen neoliberaler Globalisierung und den zunehmenden neonationalistischen Bestrebungen, wie dem zunehmenden Protektionismus, liegen wird. Es gilt, in diesem 2. Kapitel den inneren, systemischen zusammenhing zwischen den disparat scheinenden Krisenphänomenen herauszuarbeiten. Angesichts der sich entfaltenden Klimakrise und der damit einhergehenden Flüchtlingsströme soll hier überdies der Zusammenhang zwischen kapitalistischen Wachstumszwang und der daraus folgernden, irrationalen Ressourcenverbrennung dargelegt werden. Die Kernthese lauter hierbei: Die Wirtschafts- und die Klimakrise bilden nur zwei Seiten desselben Krisenprozesses.
Diese ökonomische wie ökologische Krisenentfaltung soll dabei als ein historischer Prozess dargelegt werden, angetrieben durch die inneren Widersprüche, die der kapitalistischen Produktionsweise innewohnen. Der aufkommende Faschismus und Neo-Nationalismus sind dabei politischer Ausfluss eines drohenden Umbruchs zwischen zwei historischen Krisenphasen: Von der krisenhaften neoliberalen Globalisierung, zum Protektionismus und Neonationalismus. Die Neue Rechte betreibt somit eine Ideologisierung der reell drohenden Krisenverschärfung. Die Parallelen zu der Krisenperiode der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, als die Weltwirtschaftskrise von 1929 dem deutschen Nationalsozialismus den Weg ebnete, sollen so erkennbar werden.
Das Geraune vom "Untergang" Deutschlands oder gleich des Abendlandes, das abermals in deutschen Rechten aufkommt, muss somit als Ideologie begriffen werden: als eine verzerrte, der Legitimierung faschistischer Bewegungen dienende Wahrnehmung der krisenhaften Realität. Die Rechte hat somit dem neoliberalen Mainstream diese dumpfe, quasi unbewusste Wahrnehmung des Krisenprozesses voraus. Die Angst, die angesichts des unverstandenen Krisenprozesses aufkommt und die bekannten Abschottungstendenzen befördert ("Grenzen Dicht!"), wird von der Rechten in Hass transformiert. Es gilt somit, diesen unbewusst erahnten Krisenprozess der bewussten, kritischen Reflexion zuzuführen – dies gerade in scharfer Abgrenzung zum irrationalen Wahn und Hass der Neuen Rechten.
Der Hass richtet sich immer gegen Personengruppen oder Bevölkerungssichten. Die Rechte betreibt somit eine Personifizierungder Krisenursachen, die als Folge des bösartigen oder schädlichen Treibens einer Personengruppe imaginiert werden. Somit geht die rechte Jagt nach "Sündenböcken" mit einer impliziten Naturalisierung des Kapitalismus einher, dessen innere, den historischen Krisenprozess antreibende Widersprüche nicht wahrgenommen werden. Neben den bekannten Sündenböcken wie Südländern, Türken, Griechen, Sozialschmarotzern, Russen, Amerikanern oder Arabern, die als Personifizierungen der Krisenfolgen fungierten, spielt der latente Antisemitismus als Personifizierung der Krisenursachen eine zentrale Rolle in rechter Ideologie aller Schattierungen. Dieses wird etwa am Soros-Wahn offensichtlich, dem Weite Teile der neuen Rechten verfallen sind. Bei der ideologischen Verarbeitung des Krisenprozesses greifen folglich nicht nur ungarische oder polnische Rechtsextremisten zunehmend auf Elemente des Antisemitismus zurück, wie sie in Kapitel 6 in ihren Wandlungen im 21. Jahrhundert dargelegt werden.
Eine Definition des Faschismus scheint nun - unter Verwendung der Begriffe des Extremismus der Mitte und des der opportunistischen Rebellion bzw. konformistischen Rebellion - möglich: Der historische Faschismus samt dem deutschen Nationalsozialismus fungieren, ebenso wie die gegenwärtigen Bewegungen der "Neuen Rechten", als extremistische Krisenideologien, die auf eine terroristische und letztendlich eliminatorische Praxis zutreiben. Faschismus - ob nun der deutsche Nationalsozialismus, Francos katholischer Faschismus in Spanien oder die faschistische Diktatur Pinochets in Chile - ist eine offen terroristische Krisenform kapitalistischer Herrschaft. Rechtsextreme und faschistische Tendenzen gewinnen immer dann an Dynamik, wenn die bürgerlich-liberale kapitalistische Gesellschaft in eine ökonomische oder politische Krise gerät, die das Fortbestehen des Gesamtsystems gefährdet oder auch nur zu gefährden scheint (Weltwirtschaftskrise 1929, Sieg der Volksfront 1936 in Spanien oder Allendes Wahlerfolg 1970 in Chile, manifeste Systemkrise des Weltsystems ab 2008).
Bei dieser Krisenideologie in all ihren Schattierungen - von der deutschen AfD oder der Schweizer SVP über den französischen FN/RN, bis zur Goldenen Morgenröte Griechenlands - handelt es sich somit die besagte "konformistische Rebellion", in denen nicht etwa die Überwindung des bestehenden Systems propagiert wird, sondern dessen extremistische Zuspitzung und Verhärtung. Die Krise des Kapitalismus soll mittels einer terroristischen Entgrenzung des Kapitalismus - der für diese Gesellschaftsformation konstitutiven destruktivenVergesellschaftungsformen - überwunden werden.
Die rechte "opportunistische Rebellion" bringt somit den besagten "Extremismus der Mitte" hervor. Ganz "normale Bürger" - wie am obigen Beispiel aus Chemnitz dargelegt - verfallen dem irrationalen faschistischen Wahn. Denn im faschistischen Irrationalismus spiegelt sich nur die irrationale, fetischistische Form der Vergesellschaftung im krisengeplagten Spätkapitalismus, wie im 4. Kapitel dargelegt. Nicht das emanzipatorische Bemühen, das Bestehende zu überwinden, führt in die Barbarei, sondern der krampfhafte, ins Extrem treibende Versuch, am kollabierenden Bestehenden festzuhalten.
Der Begriff des Extremismus kann die Grundlagen dieser Krisenideologie - die im Bestehenden und scheinbar "Alltäglichen" wurzelt - aber nur dann erhellen, wenn er ernst genommen, und nicht nur als eine rein formale Begriffshülse verwendet wird, mit der in totalitarismustheoretischer Diktion Kräfte an den Rändern des politischen Spektrums belegt werden. Stattdessen gilt es, die Grundzüge der weltanschaulichen Wahnsysteme des europäischen Rechtspopulismus nachzuzeichnen, um so die Kontinuität zwischen neoliberaler und rechtspopulistischer sowie rechtsextremistischer Ideologie aufzuzeigen. Was konkret wird von der Rechten ins Extrem getrieben? Erst bei dieser Auseinandersetzung mit dem konkreten Inhalt der neurechten Ideologie - sowie deren Verwurzelung im Mainstream der spätbürgerlichen Gesellschaften - wird der besagte Begriff des "Extremismus der Mitte" voll verständlich, wie er in Kapital 3 diskutiert wird.
Die Neue Rechte greift also auf Anschauungen, Wertvorstellungen und ideologische Versatzstücke zurück, die im Mainstream der betroffenen Gesellschaften herrschen. Dies war auch bei der "alten Rechten" während der Weltwirtschaftskrise der 30er der Fall, als der damals dominante völkische Nationalismus ins eliminatorische Extrem getrieben wurde. Dieser Prozess des "Ins-Extrem-Treibens" der Mitte wirkt auch in den verwüsteten, islamisch geprägten Gesellschaften der Peripherie, die den militanten Islamismus als dominante postmoderne Form der Krisenideologie hervorbringen. Im 7. Kapitel, "Islamismus und Faschismus", sollen folglich europäischer Faschismus und Islamismus als Wesensverwandte, potenziell eliminatorische Ideologien dargelegt werden – die sich oft genug bei Auseinandersetzungen wechselseitig hochschaukeln. Im 8. Kapitel, "Neue Alte Rechte", sollen hingegen die historischen Kontinuitäten zwischen dem Faschismus des 20. und 21. Jahrhunderts an etlichen Fallbeispielen (USA, Ungarn, Polen, Ukraine, Österreich, Deutschland) beleuchtet werden, wie die völkische Ideologie, Irrationalismus, Barbarisierung, Antiziganismus, Terror, Autoritarismus.
Der Faschismus weist somit eine Eigendynamik auf, er ist nicht einfach nur ein "Betrugsprojekt", das von reichen Eilten, von Kapitalisten, Bankiers oder Ölscheichs – wie im Fall des "Islamischen Staates" – finanziert wird. Eine Zielsetzung dieser Textsammlung besteht gerade darin, die Genese des Faschismus als eine genuine Massenbewegung nachzuzeichnen, die quasi "naturwüchsig" in Reaktion auf Krisenschübe an Breite gewinnt – und erst dann, im zunehmenden Ausmaß, das Interesse der Funktionseliten im Kapitalismus weckt. An die Macht gelangen die konformistischen Rebellionen aber nur dann, wenn sie auf die Unterstützung zumindest eines Teils der Funktionseliten der betreffenden Gesellschaft zählen können. Diese widersprüchliche Beziehung zwischen reaktionären Milliardären, den alten neoliberalen Eliten und den neuen neonationalistischen Populisten und Bewegungen wird in Kapitel 5 thematisiert. Faschismus ist eine Krisenform der letztendlich subjektlosen kapitalistischen Herrschaft, er ist nicht deren Optimum – in der Regel sind es folglich die reaktionärsten Teile der Funktionseliten aus Wirtschaft, Politik und Staat, die faschistische Bewegungen zuerst fördern.
Nicht nur der Faschismus, auch der Kapitalismus soll in dieser Textsammlung dem geneigten Leser als eine historische Formation, als ein dynamisches Weltsystem vermittelt werden, dass von seinen eigenen, inneren Widersprüchen in eine destruktive, weltverheerende Expansionsbewegung getrieben wird. Der Kapitalismus hat einen historischen Anfang, eine Durchsetzungsphase in der ursprünglichen Akkumulation vor rund 300 Jahren – und er wird zwangsläufig ein historisches Ende finden. Entgegen den Tendenzen zur Verdinglichung gesellschaftlicher Prozesse und der korrespondierenden Identitäten, soll somit die Wahrnehmung von sozialen Prozessen und Widersprüchen gefördert werden, anstatt die Gesellschaft und den Menschen als einen verdinglichten Ist-Zustand zu imaginieren.
Wohin triebt das Ganze des Weltsystems, angetrieben von der blindwütigen Dynamik der eskalierenden innerkapitalistischen Widersprüche? Dieser Frage wird im 9. Kapitel nachgegangen, der den Blick auf die sich bereits jetzt in Gestalt des globalen Abschottungsregimes abzeichnende Barbarei wirft, sowie dessen drohende genozidale Verhärtung im Gefolge der Klimakrise thematisiert. Die Auseinandersetzung mit dem KI-Kult des Transhumanismus soll wiederum Bestrebungen innerhalb der IT-Eliten kritisieren, mittels einer Maschinenreligion die Menschheit zu einem veralteten "Auslaufmodell" zu deklarieren.
Die Darstellung des Kapitalismus als einen offenen historischen Prozess zunehmender Widerspruchsentfaltung soll wiederum in der Zusammenfassung (Kap. 10) Eingang finden, um - ausgehend von diesem Befund - konkrete Strategien antifaschistischer Praxis in der Krise zur Diskussion zu stellen. In Frontstellung zum aufschäumenden Extremismus der Mitte der Neuen Rechten ist dieses abschließende Kapitel von der Intention getragen, eine radikale strategische Orientierung bei diesem ergebnisoffenen zivilisatorischen Überlebenskampf zu formulieren. Radikal im besten Sinne des Wortes: als das Bemühen, die Problemstellung an ihrer Wurzel zu fassen und eine entsprechende transformatorische Praxis zu entwickeln, die der Tiefe der sich entfaltenden Krisendynamik gerecht wird. Kernthese: Der Faschismus bezieht seine Dynamik aus dem Krisenprozess. Eine breite Bündnisbildung muss - allen Widersprüchen und Widerständen zum Trotz - mit der offensiven Thematisierung des Krisenprozesses einhergehen, der dem Faschismus des 21. Jahrhunderts letztendlich Auftrieb verschafft, um einen emanzipatorischen Transformationsverlauf zu ermöglichen.
Die vorliegende Textsammlung kann selbstverständlich nicht den Anspruch erheben, eine Gesamtdarstellung des Faschismus im 21. Jahrhundert oder gar des Krisenprozesses zu leisten. Es handelt sich bei den hier zusammengefassten Texten eher um Skizzen einzelner Elemente und Momente der faschistischen Dynamik, die in den Zentren des kapitalistischen Weltsystems um sich greift - die aber in ihrer Gesamtschau dem Leser durchaus ein skizzenhaftes Gesamtbild der drohenden faschistischen Barbarei im 21. Jahrhundert vermitteln dürften.
In Relation zur 2018 erschienen Erstausgabe dieser Textsammlung kann indes klar konstatiert werden, dass die Faschisierung der westlichen Gesellschaften - insbesondere der Bundesrepublik - schon sehr weit vorangeschritten ist. In Deutschland droht ein rechter Dammbruch. Es scheint, als ob die Faschisierung der Bundesrepublik teilweise irreversibel ist, sodass nur noch ein Ende der Existenz der AfD, ihr Verbot, zumindest zeitweilig die faschistische Gefahr eindämmen könnte. Es stellt sich nur die Frage, ob das angesichts der Durchsetzung des deutschen Staatsapparates mit rechten Seilschaften überhaupt noch möglich ist.
Inzwischen treffen sich AfD-Leute mit Rechtsextremisten, um Säuberungen und Vertreibungen nach der "Machtergreifung" zu organisieren.4 Diese dramatische Lage wird auch am Umfang und an der Textauswahl deutlich, da viele seit 2018 verfasste Texte in diese Neuausgabe Eingang fanden, während einige Themenfelder zwecks der Anfertigung separater E-Books (Querfront, rechte Seilschaften im Staatsapparat) ausgegliedert wurden. Das Schicksal der Erstausgabe dieses E-Books, das ursprünglich im Heise-Verlag erschien, spiegelt ebenfalls die Faschisierung der Bundesrepublik wieder. Das E-Books ist aus dem Verkauf genommen worden, nachdem das Internetmagazin Telepolis mit Verlagsdeckung von der national-sozialen Querfront-Fraktion der sogenannten "Linkspartei" gekapert worden ist. Die Studienobjekte dieses E-Books haben faktisch dessen Publikationsort übernommen.
Die einzelnen Texte mussten - mitunter recht umfangreich - modifiziert werden, um etliche Redundanzen zu beseitigen und die tagesaktuellen Bezüge so umzuformulieren, dass die Texte auch mit großem zeitlichen Abstand noch korrekt zeitgeschichtlich vom Leser eingeordnet werden können. Hierbei wurde durchaus ein Balanceakt unternommen, bei dem die intendierte Wirkung von Wiederholungen, die bestimmte Kernelemente der Argumentation beim Leser verfestigen, gegen die negativen Effekte von Redundanzen abgewogen werden musste. Selektives Lesen (etwa im umfangreichen Kapitel 8) soll durch knappe thematische Verweise anstelle jener gestrichenen Passagen ermöglicht werden, wo es für das Gesamtverständnis des Textes erforderlich schien.
Das theoretische Fundament dieser Textsammlung bildet die Weiterentwicklung marxscher Theorie durch die Wertkritik, wie sie maßgeblich vom Philosophen und Krisentheoretiker Robert Kurz und dem Theoriegruppe Exit auf der Höhe des 21. Jahrhunderts geleistet wurde.
Ich danke Thomas Meyer vom Exit-Zusammenhang für die Unterstützung bei der Anfertigung dieser Textsammlung.
Hannover, im Januar 2024
2. Systemkrise und Neue Rechte
2.1 Der Terror der Ökonomie (2018)
Es ist einer der folgenschwersten Fehler der orthodoxen linken Faschismusanalyse, diesen als Folge einer bloßen Verschwörung der reaktionärsten Teile der herrschenden kapitalistischen Klasse darzustellen, die das "Volk" verführt habe. Faschismus ist eine genuine Massenbewegung, die in Krisenzeiten tatsächlich an breiter Attraktivität in der Bevölkerung gewinnt und eine echte Eigendynamik entwickelt.
Der Faschismus scheint einen Ausweg zu bieten für die bedrängten Massen, die ihm quasi naturwüchsig zuneigen. Die sich zuspitzenden inneren Widersprüche kapitalistischer Vergesellschaftung, der zunehmende Druck, der auf den Marktsubjekten lastet – er findet in faschistischer Ideologie und Praxis ein systemimmanentes, barbarisches Ventil. Der sich in Hass wandelnde Druck, der den Faschismus Auftrieb, Legitimation verschafft, er kommt aus der Mitte der kapitalistischen Gesellschaft, nicht aus deren "Rändern". Charakteristisch für den Vorfaschismus ist gerade die faschistische Transformation der Mitte, die plötzlich empfänglich wird für Ansichten und Obsessionen, die zuvor noch als extremistisch galten.
Was befindet sich nun in der "Mitte" der spätkapitalistischen Arbeitsgesellschaften? Die zentrale Triebkraft des Aufstiegs der Neuen Rechten soll im Folgenden in der Gesellschaftssphäre verortet werden, die wie keine andere im Spätkapitalismus ideologisch überhöht wird: in der Sphäre der Ökonomie mit ihren inneren, sich zuspitzenden Widersprüchen. Um den Faschismus eben als echtes Massenphänomen erklären zu können, muss der Fokus der Betrachtung auf die Tätigkeitsform der Massen innerhalb der Ökonomie gelegt werden, auf die individuelle wie gesamtgesellschaftliche Reproduktion mittels Lohnarbeit.
Dass der herrschenden Ideologie die Lohnarbeit immer noch - trotz der zunehmenden Diskussion um die Krise der Arbeitsgesellschaft - als eine unantastbare Konstante menschlicher Existenz gilt, machte gerade die Debatte um die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens deutlich, die in den vergangenen Jahren auch in der Bundesrepublik geführt wurde. Zahlreiche gesellschaftliche Akteure sprachen sich vehement gegen die Idee der Entkopplung von Arbeit und Reproduktion aus, die angesichts rasch voranschreitender Automatisierungs- und Rationalisierungstendenzen in der Ökonomie an Anziehungskraft gewinnt.
Der DGB stellte sich beispielsweise im April 2018 gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen, als öffentlich Alternativen zu den Hartz-IV-Arbeitsgesetzen diskutiert wurden.5 Er halte von solcherlei Ideen "gar nichts", erklärte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann gegenüber Medienvertretern: "Arbeit strukturiert Alltag, Arbeit bringt Identifikation, Kommunikation der Menschen." Der Chef der IG-Metall, Jörg Hofmann, erklärte in einem Zeitungsinterview, die Menschen in Deutschland würden "nicht glücklich, wenn sie daheimsitzen und alimentiert werden", sie wollten Arbeiten, "und zwar möglichst qualifiziert". Ende 2017 hatte Münchens Erzbischof Kardinal Reinhard Marx ein flammendes Plädoyer für die Lohnarbeit gehalten,6 die nach Ansicht des katholischen Würdenträgers nicht bloß "irgendwas" sei: "Es gehört zur Grundkonstitution des Menschseins, dass ich für mich und meine Familie etwas schaffe, das von Wert ist". Die Einführung eines Grundeinkommens, das dazu führen würde, dass Menschen sich "nicht gebraucht" fühlten, sei "demokratiegefährdend", so Kardinal Marx.
Die innige Liebe zur harten, "ehrlichen" Lohnarbeit, die insbesondere unter den hoch bezahlten Funktionseliten der Bundesrepublik grassiert, bringen aber immer wieder Vertreter der "Arbeitgeber" am besten auf den Punkt. "Arbeit hält gesund" - auf diesen Nenner brachte die Bild-Zeitung im September 2012 die Ausführungen des damaligen Präsidenten der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA), Dieter Hundt.7 Dieser hat in einem Gespräch mit dem Boulevardblatt behauptet, dass Lohnarbeit unter keinen Umständen psychisch krank machen könne. "Im Gegenteil: Berufstätigkeit schafft Selbstbestätigung und Anerkennung. Sie ist damit eine wichtige Basis für die psychische Gesundheit", so Hundt. Wenn Lohnabhängige dennoch psychisch erkrankten, dann seien sie selbst daran schuld, führte der BDA-Chef weiter aus: "Die wesentlichen Ursachen liegen dabei in genetischen (!) und entwicklungsbedingten Faktoren, im familiären Umfeld, im Lebensstil und im Freizeitverhalten."
Kranke Arbeitsgesellschaft
Dabei wandte sich Hundt mit dieser Intervention gegen eine Fülle von Studien und Berichten, die genau das bestätigen, was der Arbeitgeberpräsident so vehement verneint: Arbeit macht krank. Um 120 Prozent sei die Zahl der psychischen Erkrankungen unter Deutschlands "Arbeitnehmern" seit 1994 angestiegen, meldete etwa das Wissenschaftliche Institut der AOK (WidO) im August 2012.8
Aufgrund dieser Zunahme seelischen Leidens an den spätkapitalistischen Zuständen sind der AOK zufolge allein 2011 Kosten in Höhe von 9,5 Milliarden Euro entstanden sein. Diese Behandlungskosten seien binnen eines Jahres um eine Milliarde Euro angestiegen, lamentierte AOK-Vorstand Uwe Deh. Im Jahr 2011 befanden sich 130.000 Menschen allein wegen des Burnout-Syndroms in Behandlung, wobei hier die größten Steigerungsraten zu verbuchen waren: Zwischen 2004 und 2011 sind die auf Burnout zurückgeführten Krankheitstage um das Elffache auf 2,7 Millionen angestiegen.9
Dennoch sollten laut der Bundespsychotherapeutenkammer (BptK) 2011 die Depressionen zu der mit Abstand häufigsten psychischen Erkrankung gehört haben, die 73 Fehltage pro 100 Versicherten verursachte. Der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK) zufolge sind die psychischen Erkrankungen 2011 in etlichen Regionen sogar erstmals auf den "dritten Rang bei den Fehlzeiten" vorgerückt. Knapp 14 Prozent aller Ausfalltage der Versicherten der DAK sind auf Depressionen oder Angstzustände zurückgeführt worden, die allein 2011 um zehn Prozent zugenommen hätten.10 "Die psychischen Erkrankungen arbeiten sich nach vorne", kommentierte 2012 Bärbel Löhnert von der klientenzentrierten Problemberatung in Dachau gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Vor wenigen Jahren seien diese Krankheitsbilder in den Statistiken noch "weit hinten" anzutreffen gewesen.
Neuere Zahlen zeigten eindeutig, dass der Trend zu Burnout und Depression in Deutschland - der nicht zufällig mit der Durchsetzung der Hartz-IV-Arbeitsgesetze so richtig in Schwung kam - über einen längeren Zeitraum anhielt. Die DAK-Gesundheit meldete etwa 2016 einen neuen Höchststand bei den Fehltagen ihrer Versicherten, die durch psychische Erkrankungen ausgelöst worden sind. Die Krankenkasse zählte 246 Ausfalltage je 100 Versicherte, wobei Frauen weitaus häufiger betroffen waren als Männer. Damit habe sich die Zahl der Fehltage binnen der letzten zwei Dekaden "mehr als verdreifacht".11 Auch die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) meldete für das Jahr 2016 einen "drastischen Anstieg" des Burnout-Syndroms unter ihren Versicherten, von denen 26 000 betroffen waren.12 Innerhalb eines Jahrzehnts sei die Zahl der Burnout-Fälle um 134 Prozent angestiegen, wobei die Altersgruppe der 45- bis 59-Jährigen überdurchschnittlich stark betroffen sei: hier wurde ein Anstieg von 150 Prozent konstatiert. Insgesamt habe die Zahl der Fehltage aufgrund psychischer Leiden in Deutschland binnen zwei Dekaden mehr als verdreifacht, meldete 2017 der Tagesspiegel unter Berufung auf Analysen der Krankenkasse DAK-Gesundheit.13
Nicht nur die Burnout-Republik Deutschland ist hiervon betroffen. Auch in der "Wohlstandsinsel" Schweiz brennen Lohnabhängige aufgrund des ansteigenden Leistungsdrucks immer öfter aus, wie es aus Zahlen der Krankenversicherung Swica im April 2918 ersichtlich wurde.14 Demnach haben die Arbeitsausfälle aufgrund psychischer Erkrankungen innerhalb der Swica-Versicherten innerhalb von fünf Jahren um 35 Prozent zugenommen. Viele Lohnabhängige kämen "mit dem steigenden Arbeitsdruck nicht mehr klar", kommentierte Adrian Wüthrich, Präsident des Gewerkschaftsdachverbands Travailsuisse, den Anstieg. Pierre Vallon, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, pflichtete dem bei: "Die Angestellten sind immer stärker unter Druck, müssen permanent Top-Leistungen erbringen und Überstunden leisten."
Für viele Lohnabhängige wird dieser Druck immer öfter schlicht unerträglich. Nicht nur in ökonomisch verheerenden Krisenländern wie Griechenland, die durch das deutsche Krisendiktat in den sozioökonomischen Kollaps getrieben wurden, klettert die Selbstmordrate auf immer neue Höchststände.15 Auch in den USA16 steigt die Suizidrate immer weiter an. 2016 haben sich 45 000 US-Bürger das Leben genommen, was einen Anstieg von 28 Prozent gegenüber dem Jahr 1999 gleichkommt. Ein Faktor, der zu diesem steilen Anstieg beigetragen habe, seien die Folgen der "großen Rezession", die vor 2008-09 die USA heimsuchte, erklärten Soziologen gegenüber der Washington Post.
Der mitunter letale Druck nimmt immer weiter zu – in der gesamten kapitalistischen "Arbeitsgesellschaft". Folglich sind nicht nur die klassischen Arbeiter und Angestellten, sondern auch die Funktionsträger im mittleren Management von dieser Zunahme psychischer Erkrankungen betroffen, so das Ergebnis Studie des Instituts für angewandte Innovationsforschung (IAI) der Ruhr-Universität-Bochum.17 Jeder vierte deutsche Manager sei burnoutgefährdet, auch das Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, sei in dieser Gruppe deutlich höher. Thomas Kley, einer der Studienautoren, erklärte gegenüber Medienvertretern: "Vor allem Führungskräfte aus dem mittleren Management haben ein deutlich höheres Risiko, einer vitalen Erschöpfung zu erliegen. Sie sind die sogenannten Umsetzer in den Unternehmen, sie müssen Zusatzarbeit stemmen und Schwierigkeiten beseitigen. Aber auch die nächsttiefere Hierarchieebene - die passiv Betroffenen - kämpfen am Limit." Auch eine ähnliche Studie der SRH Hochschule Heidelberg kam 2015 zum gleichen Ergebnis: "Deutschlands Chefs haben ein größeres Risiko, psychisch krank zu werden als Otto-Normal-Bürger."18
Und es herrscht mittlerweile weitgehende Einigkeit darüber, dass es die – krisenbedingte - Verschärfung und Entgrenzung des Arbeitslebens ist, die zu dieser Konjunktur psychischer Deformationen bei immer mehr Lohnabhängigen wie Funktionsträgern der Kapitalverwertung führt. Die "Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben" würden für Millionen von Lohnabhängigen immer stärker verschwimmen, beklagte beispielsweise die AOK schon 2012, sodass die Betroffenen in einem Zustand ständiger Arbeitsbereitschaft verharren und kaum noch abschalten könnten.19
Der DGB berichtete wiederum, dass nahezu 70 Prozent seiner Mitglieder mit Wochenendarbeit konfrontiert seien: "35 Prozent arbeiten demnach regelmäßig, 33 Prozent ab und zu an Samstagen und Sonntagen." Hierbei handele es sich um eine "Zunahme um rund zwei Drittel innerhalb von zwei Jahrzehnten".20 Hinzu kommt die Intensivierung der Ausbeutung der "Ware Arbeitskraft", die durch eine Prekarisierung des Arbeitslebens und durch eine Verinnerlichung der Kapitalimperative erreicht wird. Frecherweise gilt ausgerechnet das als "gelebte Freiheit". Rund ein Drittel aller Lohnabhängigen kann inzwischen die Arbeitszeit "selbst bestimmen", meldete die AOK. Da diese "Selbstbestimmung" in der Krisenkonkurrenz zu anderen Lohnabhängigen geschieht, wächst das Arbeitspensum aller Betroffenen bis ins Unerträgliche an.
Die "Arbeitnehmer" arbeiteten deswegen "aus sich selbst heraus deutlich über ihre Leistungsgrenzen hinaus", konstatierte Antje Ducki, eine Mitherausgeberin des AOK-Reports. Es fände eine enorme Identifikation der Betroffenen "mit ihrer Arbeit und ihren jeweiligen Projekten" statt. Zudem habe sich längst der "Selbstständige Freelancer" als ein "Prototyp" des Berufslebens durchgesetzt. Somit erweist sich die "Marktfreiheit" mal wieder als der sicherste Weg, die lohnabhängigen Monaden bis weit über die Grenzen ihrer psychischen Belastungsfähigkeit gegeneinander zu hetzen.
Diese beständige Intensivierung der Krisenkonkurrenz äußert sich wiederum in einer Zunahme des Mobbings, der Schikanen und des Psychoterrors am Arbeitsplatz. Bei einer 2008 durchgeführten Umfrage gaben zwölf Prozent der befragten Angestellten an, schon mal selbst Opfer einer Mobbing-Attacke gewesen zu sein. Zeuge eines Mobbings an Kollegen war rund ein Drittel der Umfrageteilnehmer. Rund zehn Jahre Später, im März 2018, berichteten rund 30 Prozent der Teilnehmer einer Mobbingstudie von entsprechenden Erfahrungen, rund zwei Drittel der Befragten gab an, Zeuge von Mobbingattacken geworden zu sein.21 Diejenige Gruppe, die überdurchschnittlich oft gemobbt wurde, bestand aus älteren Lohnabhängigen. Hierbei handelt es sich somit zumeist um Leistungsterror, der sich gegen vermeintlich oder tatsächlich Schwächere richtet. Ein großer Teil der Depressionen, die in den genannten Studien konstatiert wurde, ist gerade auf diese Zunahme der Krisenkonkurrenz zurückzuführen.
Zwischenfazit: Offensichtlich ist das herrschende kapitalistische Wirtschaftssystem dermaßen "widernatürlich", dass die Menschen in wachsendem Ausmaß an dessen eskalierenden Widersprüchen mental und physisch zerbrechen. Es macht übrigens nur dann Sinn, von einer menschlichen "Natur" zu sprechen, wenn von den menschlichen Bedürfnissen die Rede ist - und genau diese Bedürfnisse kann der Kapitalismus nicht einmal ansatzweise mehr befriedigen. Immer mehr Lohnabhängige gehen an der eskalierenden Krisenkonkurrenz zugrunde, anstatt in ihr aufzuleben, wie es die offizielle neoliberale Ideologie predigt, die den Menschen als des Menschen Wolf imaginiert. Diese krisenbedingte Epidemie des Irrsinns, die immer schneller um sich greift, blamiert folglich auch die herrschende Ideologie, in der das kapitalistische System zu einem Naturzustand verklärt wird, der gerade aus den natürlichen Veranlagungen, aus einer unabänderlichen "Natur" des Menschen resultieren soll.
Hass als Ventil
All der ansteigende Druck, der auf den Lohnabhängigen lastet, er verlangt nach einem Ventil. Und dieses Ventil liefert der ausgebrannten Mitte der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft die Neue Rechte. Der krisenbedingt zunehmende Druck auf Lohnabhängige führt zur Etablierung eines "autoritären Kreislaufs" in all jenen Gesellschaftsmitgliedern, die sich eine Alternative zur kapitalistischen Dauerkrise nicht vorstellen können. Der Sozialpsychologe Oliver Decker hat diesen irrationalen Konstitutionsprozess autoritärer und rechter Ideologien in der gegenwärtigen Krise präzise auf den Punkt gebracht:22
"Die ständige Orientierung auf wirtschaftliche Ziele - präziser: die Forderung nach Unterwerfung unter ihre Prämissen - verstärkt einen autoritären Kreislauf. Sie führt zu einer Identifikation mit der Ökonomie, wobei die Verzichtsforderungen zu ihren Gunsten in jene autoritäre Aggression münden, die sich gegen Schwächere Bahn bricht."
Dieses "ins Extrem-Treiben" des krisenbedingt zunehmenden Terrors der Ökonomie, den sich die Lohnabhängigen verstärkt ausgesetzt sehen, ging dem Aufstieg des politischen Extremismus voraus. Decker spricht ausdrücklich von einer "Landnahme der Ökonomie in allen gesellschaftlichen Bereichen", die "handfeste, entdemokratisierende Wirkungen" zeitige. Alle rechte Ideologie baut auf eben dieser autoritären Aggression gegenüber Schwächeren oder Sündenböcken, zumeist Krisenopfern, auf.
Somit waren es gerade die Arbeitsmarktreformen um die Jahrtausendwende, oftmals durchgesetzt von neoliberalen Sozialdemokratien wie der SPD Gerhard Schröders (Agenda 2010) oder den US-Demokraten Clintons ("Workfare"), die das sozioökonomische Fundament für den Aufstieg der Neuen Rechten legten – in Form der Entrechtung der Lohnabhängigen und der Verrohung des Arbeitslebens vermittels eskalierender Krisenkonkurrenz. Diese neoliberale Politik war flankiert durch den Aufbau eines autoritären, strafenden Staates, der die zunehmenden sozialen Widersprüche durch stärkere staatliche Repression zu bekämpfen sucht – und etwa den USA die höchste Gefängnispopulation aller entwickelte kapitalistischen Länder verschaffte. Gerade diese Tendenzen zum härteren Staatlichen "Durchgreifen" haben ebenfalls zur Ausbildung der opportunistischen Rebellion der Neuen Rechten beigetragen.
Die von "Rot-Grün" durchgesetzte Agenda 2010 samt den Hartz-IV-Arbeitsgesetzen kann im Fall Deutschlands als die eigentliche Geburtsstunde der neuen deutschen Rechten bezeichnet werden. Die neue Rechte ist ein Produkt des Neoliberalismus. Die neoliberale Verzichtspolitik, die nach Ausbruch der Eurokrise von Schäuble europaweit exportiert wurde, förderte somit die autoritäre Aggression gegen die Krisenopfer, auf der rechtspopulistische wie rechtsextremistische Ideologien gleichermaßen beruhen. Der Rechte treibt nur die staatlich forcierte autoritäre Politik der Exklusion ins rassistische Extrem.
Fazit: Je größer der Druck von "oben", etwa am Arbeitsplatz oder auf dem Amt, desto größer der Hass auf die Krisenopfer unter all den Gesellschaftsmitgliedern, die die entsprechenden autoritären Dispositionen aufweisen. Die absurd scheinende, sich gegen Migranten richtende "Opferrhetorik" der extremen Rechten, etwa in Gefolge der pogromartigen Ausschreitungen von Chemnitz im Sommer 2018, hat ihre Ursache gerade in diesem uneingestandenen Leiden an den wachsenden Zumutungen der spätkapitalistischen Arbeitsgesellschaft. Der Unwille, sich gegen den Druck der verhärtenden Machtstrukturen zu wehren, führt somit zur autoritären Aggression gegen diejenigen, die machtlos sind. Der Masochismus des Untertanen, der sich gegen die zunehmenden Zumutungen nicht wehren will, verlangt nach sadistischer Satisfaktion. Dies wurde vor allem während der Eurokrise evident. Deswegen avancierte etwa der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble just dann zum beliebtesten Politiker Deutschlands, als er 2015 Griechenland leidenschaftlich demütigte und drangsalierte.
Es ist somit die auf allen Ebenen der spätkapitalistischen Gesellschaften zunehmende Krisenkonkurrenz, die den Faschismus seinen Massenanhang verschafft - mittels der unbewussten Identifikation der "Mitte" mit der amoklaufenden und widerspruchszerfressenen "Ökonomie", die zur Ausbildung autoritärer Aggressionen gegen Krisenverlierer oder "Sündenböcke" führt. Auf dieser ideologischen Kontinuität baut alle rechtspopulistische und letztendlich faschistische Ideologie auf. Es findet bei diesem Extremismus der Mitte kein ideologischer Bruch statt, sondern ein beständiges, graduelles Abdriften ins Barbarische. Es ist bequem, es ist einfach, er verschafft die Illusion der Rebellion.
Der im Zeitalter der neoliberalen Globalisierung beständig zunehmende Konkurrenzdruck, der marktvermittelte Terror der Ökonomie durchdringt die spätkapitalistischen Gesellschaften. Nicht nur die Lohnabhängigen, auch Unternehmen, auch Volkswirtschaften, Städte, Regionen mussten in Form der Markt- und Standortkonkurrenz auf den zunehmenden ökonomischen Druck reagieren. Dieser Krisendruck wurde praktisch durch alle Hierarchien des Systems hindurch auf Lohnabhängige als die untersten Glieder der kapitalistischen Nahrungskette abgewälzt.
Die Krise kurz erklärt
Die zentrale Frage lautet folglich: Wer oder was ist es, das diesen Druck beständig ansteigen lässt? Wieso zieht sich die Schlinge immer fester zu um den Nacken der Lohnabhängigen, wieso wird in der Wirtschaft, insbesondere im "Arbeitsleben", mit immer härteren Bandagen gekämpft? Die Antwort darauf fällt zuerst scheinbar unbefriedigend aus, da tatsächlich Niemand die "Schuld" am Krisenausbruch trägt. Es sind die zunehmenden inneren Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise, die das globale kapitalistische System in die Krise treiben – und den barbarischen Kern kapitalistischer Vergesellschaftung in Gestalt der "Neuen Rechten" offen zutage treten lassen.
Im Kern ist der Kapitalismus schlicht zu produktiv für sich selbst geworden. Die Produktivkräfte sprengen somit die Fesseln der Produktionsverhältnisse, wie es Marx formulierte. Dieses System stößt somit in einem langfristigen, dekadenlangen Prozess an eine innere Schranke seiner Entwicklungsfähigkeit. Es scheitert an sich selbst, an seiner betriebswirtschaftlichen Effizienz: Die immer schneller um sich greifende Rationalisierung und Automatisierung führt dazu, dass immer mehr Waren in immer kürzerer Zeit durch immer weniger Arbeitskräfte hergestellt werden können. Neue Industriezweige wie die Mikroelektronik und die Informationstechnik beschleunigten diese Tendenz noch weiter. Diese neuen Technologien schufen weitaus weniger Arbeitsplätze, als durch deren gesamtwirtschaftliche Anwendung wegrationalisiert wurden. In der globalen Tendenz entsteht so eine ökonomisch überflüssige Menschheit, die gerade die Fluchtbewegungen in die Zentren des Weltsystems verstärkt.
Je größer das Automatisierungspotenzial ist, je weniger Menschen global gebraucht werden, um in immer kürzerer Zeit immer größere Warenmassen zu produzieren, desto stärker bildet sich - vermittelt durch den Weltmarkt - der Druck aus auf all diejenigen Menschen, die in der Arbeitsgesellschaft noch eine Verwendung finden, desto brutaler werden auch die Schikanen gegen die Masse derjenigen, die vom kriselnden Prozess der Kapitalverwertung bereits ausgespien worden sind. Der dem kapitalistischen System innewohnende Wahnwitz entfaltet sich in der Krise zur vollen Kenntlichkeit: Der potenzielle materielle Überfluss, der den durch den Kapitalismus hervorgebrachten Produktivkräften innewohnt, verwandelt die Arbeitswelt in ein wahres Irrenhaus - für den depressiven Angestellten genauso wie für den vom Herzkasper bedrohten Manager.
Diese Entwicklung kennzeichnet einen fundamentalen Widerspruch der kapitalistischen Produktionsweise. Die Lohnarbeit bildet die Substanz des Kapitals - doch zugleich ist das Kapital bemüht, durch Rationalisierungsmaßnahmen die Lohnarbeit aus dem Produktionsprozess zu verdrängen. Marx hat für diesen selbstwidersprüchlichen Prozess die geniale Bezeichnung des "prozessierenden Widerspruchs" eingeführt. Dieser Widerspruch kapitalistischer Warenproduktion, bei dem das Kapital mit der Lohnarbeit seine eigene Substanz durch Rationalisierungsschübe minimiert, ist nur im "Prozessieren", in fortlaufender Expansion und Weiterentwicklung neuer Verwertungsfelder der Warenproduktion aufrechtzuerhalten. Derselbe wissenschaftlich-technische Fortschritt, der zum Abschmelzen der Masse verausgabter Lohnarbeit in etablierten Industriezweigen führt, ließ auch neue Industriezweige oder Fertigungsmethoden entstehen.
Aus dem erläuterten "prozessierenden Widerspruch" der Warenproduktion resultiert ein industrieller Strukturwandel, bei dem alte Industrien verschwanden und neue hinzukamen, die wiederum Felder für Kapitalverwertung und Lohnarbeit eröffneten. Über einen bestimmten Zeitraum hinweg besaßen bestimmte Industriesektoren und Fertigungsmethoden die Rolle eines Leitsektors, bevor diese durch andere, neue Industriezweige abgelöst wurden: So erfahren wir seit dem Beginn der Industrialisierung im 18. Jahrhundert einen Strukturwandel, bei dem die Textilbranche, die Schwerindustrie, die Chemiebranche, die Elektroindustrie der Fahrzeugbau, usw. als Leitsektoren dienten, die Massenhaft Lohnarbeit verwerteten.
Doch genau dieser Strukturwandel funktioniert seit den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts immer weniger, nachdem die Lohnarbeit aufgrund der Rationalisierungsschübe der mikroelektronischen Revolution sich innerhalb der Warenproduktion zunehmend verflüchtigt - und die Wegrationalisierung nicht mehr durch eine Einsaugung zusätzlicher Lohnarbeit in neuen Industriesektoren kompensiert werden kann. Die Krisenperiode der späten 70er und frühen 80er-Jahre ("Stagflation"), als der "Nachkriegsaufschwung" auslief, markiert gerade das Scheitern dieses industriellen Strukturwandels. Und gerade deswegen setzte sich ab den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts der finanzmarktgetriebene Neoliberalismus durch: in politischer Gestalt von General Pinochet (Chile), Margret Thatcher (Großbritannien) und Ronald Reagan (USA). Die Ausbildung eines gigantischen Finanzsektors und des korrespondierenden riesigen Schuldenbergs im globalen Maßstab, die das von Lohnstagnation geprägte neoliberale Zeitalter charakterisierte, kann folglich als eine Systemreaktion auf einen nicht mehr erfolgreich stattfindenden Strukturwandel aufgefasst werden. Die Krise ist somit schon längst da: sie frisst sich in einem dekadenlangen Prozess schubweise von der Peripherie in die Zentren des Weltsystems.
Fazit: Schwerwiegende Systemkrisen setzen im Kapitalismus somit immer dann ein, wenn dieser Prozess des "industriellen Strukturwandels" ins Stocken gerät. Das System bildet dann in Reaktion auf diese Verwertungskrise der "realen", warenproduzierenden Wirtschaft einen überdimensionierten Finanzsektor aus, der mittels Finanzblasen eine Verschuldungsdynamik entfacht und damit einen Kollaps der „Realwirtschaft“ hinauszögert. Dies war zuletzt in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts der Fall, bis diese Spekulationsexzesse 1929 platzten - und die anschließende verheerende Weltwirtschaftskrise dem Nationalismus und Faschismus den Weg bereitete. Und in einer ähnlichen Situation befindet sich das spätkapitalistische Weltsystem auch heute. Es fehlt ein neues globales "Akkumulationsregime", in dem Lohnarbeit massenhaft verwertet würde. Das kapitalistische Weltsystem befindet sich somit in einer strukturellen Überproduktionskrise, deren manifester Ausbruch durch einen beständig schneller als die Weltwirtschaftsleistung wachsenden Schuldenberg verzögert wird.23
In den folgenden Texten dieses Kapitels soll die Wechselwirkung zwischen diesem hier grob skizzieren, historischen Krisenprozess und dem Aufstieg der Neuen Rechten genauer dargelegt werden. Hierbei spielt aber nicht nur diese sich immer stärker global manifestierende innere Schranke des Kapitals eine zentrale Rolle, sondern auch dessen "äußere", ökologische Schranke. Die ökologische und die ökonomische Krise bilden nur zwei Momente desselben Krisenprozesses. Das Kapital als prozessierender Widerspruch, das eine ökonomisch überflüssige Menschheit produziert, verbrennt in seinem Wachstumszwang auch die Ressourcen und ökologischen Lebensgrundlagen der Menschheit.
Entscheidend für die Genese des Neuen Rechten im gegenwärtigen Krisenprozess ist aber die fetischistische Eigendynamik des Kapitals auf gesamtgesellschaftlicher und globaler Ebene: Der Krisenprozess, der durch eskalierende innere Widersprüche des an Widersprüchen und Absurditäten nun wahrlich nicht armen Kapitalverhältnisses angefeuert wird, äußert sich den einzelnen Akteuren, seien es nun Lohnabhängige, Manager, Unternehmen oder Staaten, in Form zunehmender und sich zuspitzender "Sachzwänge", also in Form von Zwängen, die von "Sachen" ausgehen. Allein schon in dieser Formulierung kommt der fetischistische, durch Vermittlungsebenen konstituierte Charakter kapitalistischer Vergesellschaftung voll zum Ausdruck, da die Sachen über die Menschen zu herrschen scheinen, diese den Wechselfällen und Erschütterungen der "Märkte" und Krisen ohnmächtig ausgesetzt sind, als ob es sich um Naturgesetze handelte.
Dabei sind es gerade die Marktsubjekte, die diese Dynamik - die einem Verhängnis gleich über sie zu herrschen scheint - alltäglich buchstäblich erarbeiten. Dieser Zwiespalt zwischen subjektiven Akteuren auf Markt- oder Politikebene und den objektiven Sachzwängen kapitalistischer Vergesellschaftung ergibt sich aus der blinden Marktvermittlung des gesamten Produktionsprozesses im Kapitalismus. Jeder Marktteilnehmer produziert, obwohl die marktvermittelte Arbeitsteilung immer komplexer wird, isoliert und in Konkurrenz zu allen anderen Marktteilnehmern zum Selbstzweck möglichst hoher Renditen für den anonymen Markt. Deswegen konstituiert sich, angetrieben von dieser Maxime höchstmöglicher Profiterzielung, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene "hinter dem Rücken der Produzenten" (Marx) eine Eigendynamik dieses Verwertungsprozesses des Kapitals, die einem "automatischen Subjekt" (Marx) gleich eben diesen Marktsubjekten als eine fremde, "naturwüchsige" Macht entgegentritt, die sie selber - unbewusst, da marktvermittelt - hervorbringen.
Erst jetzt wird deutlich erkennbar, wie die allseitige "subjektive" Krisenkonkurrenz mit dem "objektiven" Krisenprozess verschmolzen sind: Die Subjekte - vom Lohnabhängigen, über Unternehmen bis zum Staatssubjekt - reagieren auf diese "Verhärtungen" mit dem Bemühen, die Krisenfolgen auf die Konkurrenz abzuwälzen. Die Neue Rechte brütet unbewusst die ideologische Legitimierung dieses Prozesses aus, der mittels Rassismus, Kulturalismus, Sozialdarwisnismus und – dies ist zentral – Antisemitismus legitimiert wird. Und dies ist letztendlich das Geheimnis ihres Erfolgs: Sie legitimiert die widerspruchsgetriebene Eigendynamik des Spätkapitalismus, der in seiner Krise in die manifeste Barbarei abdriftet. Die Rechte bildet somit letztendlich einen unbewussten Fetischkult aus, bei dem die zunehmende Krisenkonkurrenz ideologisch legitimiert und praktisch verschärft wird. Die folgenden Texte sollen etliche Facetten dieser Wechselwirkung aus sich verschärfender kapitalistischer Krisendynamik und dem Ins-Extrem-Treiben rechter Ideologie genauer darlegen.
2.2 Die Nation in der Krise
30.09.2015
Die eskalierende Krisendynamik hinterlässt bösartige ideologische Verfallsformen von Nationalismus und Rechtsextremismus.
Auch ein blindes Wirtschaftshuhn findet mal ein Körnchen Wahrheit. Henrik Müller, Spiegel-Online Wirtschaftskolumnist und ehemaliger Chefredakteur des Manager Magazin, setzte sich im September 2015 anlässlich einer Neuwahl in Griechenland mit einer Illusion auseinander: mit der Illusion nationaler Souveränität.24 Die nationale Politik benehme sich überall auf der Welt so, "als ob sie ihre Geschicke selbst bestimmen" könne, was sich angesichts der jüngsten Ereignisse in Griechenland und auch in den USA als Illusion erweise. Müller nennt in diesem Zusammenhang nicht nur das Berliner Krisendiktat gegenüber Athen, sondern auch das Zurückschrecken der US-Notenbank vor einer Leitzinserhöhung.
Griechenland hätte sich den "Vorgaben der Gläubiger" ebenso beugen müssen wie die Fed der angespannten Wirtschaftslage in China, um so "eine weltweite Kettenreaktion" zu verhindern. Man könne kaum noch von nationaler Souveränität sprechen, wenn die "Notenbanker der größten Volkswirtschaft der Erde" nicht mehr "souverän über ihre Währung zu gebieten," so Müller.
Die "wechselseitigen Einflüsse" seien im Rahmen der Globalisierung inzwischen derartig angewachsen, dass eine nationale Regierung "kaum noch irgendetwas entscheiden kann, ohne andere Länder damit zu beeinträchtigen". Überall, wo Nationen es dennoch versuchten, "richten sie großen Schaden an". Und dennoch scheine das Denken in nationalen Kategorien wieder eine Renaissance zu erleben, wunderte sich Müller:
"Die einzelnen Nationen können kaum noch etwas gestalten. Trotzdem bestimmt das überkommene Prinzip nationaler Souveränität nach wie vor die Politik. Ja, es ist sogar seit einigen Jahren wieder im Aufwind…"
Und tatsächlich findet eine krisenhafte Zuspitzung dieser beiden gegenläufigen Tendenzen statt. Die Nationen, das nationale Prinzip scheint auf dem Vormarsch in einer krisengeschüttelten Zeit, in der der Prozess der kapitalistischen, negativen Globalisierung auf die Spitze getrieben scheint. Niemals zuvor in der Geschichte des Kapitalismus war die transnationale wirtschaftliche Verflechtung so eng wie derzeit, 2015. Das gilt vor allem für die Bundesrepublik, die alljährlich extreme Handelsüberschüsse erwirtschaftet.
Doch zugleich nehmen die nationalen und geopolitischen Spannungen weltweit zu, gewinnen nationalistische und rechtsextreme Bewegungen rasant an Zulauf. Es scheint, als ob der Drang zur globalen Vergesellschaftung, der der negativen, rein konkurrenz- und marktvermittelten Globalisierung innewohnt, zugleich all die Zentrifugalkräfte hervorbringen würde, die dieser Globalisierungstendenz entgegenwirken.
Während die globalen Handelsströme - und die globalen Ungleichgewichte! - zunehmen, gewinnen nationalistische und separatistische Bewegungen an Zulauf. Auch und gerade beim Exportweltmeister Deutschland, im Land von Pegida und AfD. Zudem nehmen die nationalen Auseinandersetzungen tatsächlich zu, wie es während der langjährigen Griechenlandkrise offensichtlich wurde, in deren Verlauf die Bundesrepublik das Mittelmeerland in den sozioökonomischen Kollaps treib.
Auch die widerlichen und menschenverachtenden geopolitischen Machtspiele um die Ukraine nach dem Umsturz 2014, das nicht enden wollende Gemetzel im arabischen Raum oder das "Great Game" zwischen den USA und China in Ostasien belegen die zunehmende geopolitische Instabilität des wirtschaftlichen Globalisierungsprozesses.
Der fehlende nationale ökonomische Bezugsrahmen
Je stärker die wirtschaftliche Verflechtung, desto stärker die nationale Konkurrenz. Dieser Eindruck stellt sich deswegen ein, weil beide gegenläufigen Tendenzen Teil der krisenbedingt zunehmenden Widerspruchsentfaltung im Spätkapitalismus sind. Alles im Spätkapitalismus drängt zur regelrechten Flucht in die Globalisierung, doch zugleich lässt das sich immer deutlicher abzeichnende Scheitern dieser krisenhaften kapitalistischen Globalisierung all die ideologisch absolut dysfunktionalen neo-nationalistischen Ideologien aufkommen, denen die ökonomische Basis - die nationale Volkswirtschaft - längst abhandengekommen ist.
Die nationale Politik ist machtlos, weil sie keinen einigermaßen geschlossenen nationalen ökonomischen Bezugsrahmen mehr vorfindet: Stattdessen agieren die Staaten - und auch viele Regionen innerhalb der Nationalstaaten - als bloße Wirtschaftsstandorte im globalen Wettbewerb, wobei die alten nationalökonomischen Verflechtungen zusehends durch globale Fertigungsketten und Absatzmöglichkeiten zersetzt werden.
Für die avancierte Industrie in Bayern ist beispielsweise China wichtiger als Mecklenburg-Vorpommern. Die nationale "Volkswirtschaft" ist in Auflösung begriffen, die Nation stellt nur noch einen Hohlkörper dar, an den sich brandgefährliche Krisenideologien klammern.
Die Globalisierung selbst stellt ein Krisenphänomen dar, sie ist Ausfluss der Tendenz des Kapitals, vor seinen inneren Widersprüchen in eine - globale - Expansion zu flüchten. Konfrontiert mit der sich immer stärker abzeichnenden Krise der - nationalen - Arbeitsgesellschaft nahm die internationale wirtschaftliche Verflechtung des Kapitals ab den 90er-Jahren des 20. Jahrhunderts eine neue Qualität an. Im Rahmen der sich verschärfenden Krisenkonkurrenz gingen Unternehmen und Konzerne dazu über, unter Ausnutzung neuer technologischer und logistischer Möglichkeiten globale Fertigungsketten aufzubauen und immer neue arbeitsintensive Fertigungsschritte in Billiglohnländer auszulagern, um von dem enormen globalen Lohngefälle zu profitieren.
Krisenfolgen auf andere abwälzen
Der rasche Aufstieg der Schwellenländer - hier insbesondere Chinas - ist gerade Folge dieses ungeheuren Schubs globaler ökonomischer Verflechtung, in dessen Verlauf die Illusion einer nachholenden Industrialisierung in der Semiperipherie des kapitalistischen Systems aufkam. Die Schwellenländer galten der Wirtschaftswissenschaft lange Jahre als künftige Lokomotiven der Weltwirtschaft, die eine neue Ära der Prosperität einleiten würden. Die Lohnabhängigen in den Zentren des Weltsystems, in den USA wie in Westeuropa, konnten so trotz eines stagnierenden Lohnniveaus mit billigen Warenströmen versorgt werden.
Dennoch handelte es sich beim Boom der Schwellenländer um eine kreditfinanzierte Illusion. Die Globalisierung wurde maßgeblich durch die sich intensivierende Konkurrenz befeuert, doch ihre jahrzehntelange Dynamik ist nur unter Berücksichtigung der zunehmenden globalen Ungleichgewichte in den Handels- und Leistungsbilanzen zu verstehen.
Die diesen Ungleichgewichten zugrunde liegende Verschuldungsdynamik ermöglichte erst die lang anhaltende Globalisierungsperiode, bei der exportorientierte Volkswirtschaften (etwa die BRD und China) ihre Handelsüberschüsse in sich immer weiter verschuldende Zielländer (hier vor allem die USA, aber auch eine Zeit lang Europa) ausführten.
Die Globalisierung mit ihrer Tendenz zur Schaffung größerer einheitlicher Wirtschaftsräume und Freihandelszonen ermöglichte gerade diese ungeheure, globale Dynamisierung der krisenbedingten Verschuldungsprozesse des spätkapitalistischen Weltsystems.
Unterm Brennglas ist dies in der Eurozone nachzuvollziehen, wo die Einführung des Euro der südlichen Peripherie die Kreditkonditionen des nördlichen Zentrums gewährte - und bis zum Platzen der hiernach einsetzenden europäischen Schuldenblasen allen Beteiligten eine gute Defizitkonjunktur verschaffte. Das brutale Machtspiel um die Macht in der erodierenden Eurozone setzte erst nach dem Krisenausbruch ein - als es darum ging, die Krisenfolgen auf andere abzuwälzen.
Die zunehmende Verdrängungskonkurrenz auf den "enger" werdenden Märkten trieb somit die Konzerne in die Globalisierung, die zudem die Kreditausweitung auf den Finanzmärkten zusätzlich befeuerte. Nachdem die Zentren des Weltsystems 2008 ihre großen Schuldenkrisen durchlebten, verlagerte sich die Verschuldungsdynamik in die Schwellenländer. Ein Paradebeispiel hierfür ist ja gerade China, das bis zur Weltwirtschaftskrise 2008 gigantische Handelsüberschüsse mit den - sich immer weiter verschuldenden - USA und Europa erwirtschaftete, um hiernach, ab 2009, selber die Defizitkonjunktur auszubilden.
Der globalisierte Verschuldungsprozess stößt somit immer deutlicher an seine Grenzen. Und es ist gerade diese sich immer deutlicher abzeichnende "innere Schranke" (Robert Kurz) des Kapitals, die all die von Henrik Müller beklagten Tendenzen überhandnehmen lässt: die zunehmenden nationalen Auseinandersetzungen samt ihren nationalistischen Absonderungen. Müller klagt:
"So wirbt in der EU kaum noch ein Politiker für die Überwindung nationaler Strukturen. Stattdessen herrscht ein großes, hässliches Gerangel nationaler Interessen."
Das Gefühl der Heteronomie, des Ausgeliefertseins an übermächtige Sachzwänge und Verwerfungen einer amoklaufenden Ökonomie, die einer Naturgewalt gleich ganze Regionen und Länder sozioökonomisch verwüstet, geht mit der Tendenz einher, die Krisenfolgen auf andere abwälzen zu wollen.
Der sich abzeichnende "objektive" Zerfall des kapitalistischen Weltsystems, der immer größere sozioökonomische Zusammenbruchsregionen hinterlässt und letztendlich zum Staatszerfall oder zu einer autoritären, faschistischen Krisenverwaltung führt, wird gerade in Form der zunehmenden "subjektiven" Auseinandersetzungen zwischen Nationen oder Regionen ausgetragen. "Wer steigt ab?" - das ist der Kern dieser negativen Krisenkonkurrenz, bei der ganze Regionen und Länder im Elend und Zerfall versinken.
Ein gutes Beispiel hierfür bietet gerade die Eurokrise mit den besagten jahrelangen Auseinandersetzungen zwischen Berlin und Athen. Auf der geopolitischen Oberfläche erscheint diese "subjektive" Auseinandersetzung als ein wirtschaftlicher und letztendlich geopolitischer Machtkampf, bei dem Berlin seine ökonomische Dominanz ausspielte, ein abschreckendes Exempel statuierte und hierdurch seine Hegemonie in der Eurozone festigte.
Doch objektiv betrachtet wurde auf der systemischen Ebene durch diese Auseinandersetzung - wie durch das gesamte verheerende deutsche Spardiktat in der Eurozone - die Krisendynamik exekutiert, bei der weite Teile der südlichen Peripherie der Eurozone einen massiven, langfristigen sozioökonomischen Abstieg erfuhren.
Auch Deutschland Konjunktur läuft somit "auf pump" – nur werden diese Schuldenberge mittels Handelsüberschüssen exportiert. Die durch ausartende Handelsüberschüsse aufrechterhaltene Illusion einer heilen Arbeitsgesellschaft in der BRD konnte nur durch die Deindustrialisierung, Verelendung und Marginalisierung der Peripherie aufrechterhalten werden.
Die deutsche Beggar-thy-neighbor-Politik, die auf möglichst hohe Außenhandelsüberschüsse abzielt, stellt einen Moment der ausartenden globalen Ungleichgewichte in den Handelsbilanzen dar, die durch die Globalisierungsschübe ermöglicht wurden. Hierbei können durchaus Parallelen zu der Weltwirtschaftskrise der 30er-Jahre gezogen werden (Damals wurde der Begriff Beggar-thy-neighbor geprägt), die ebenfalls mit einer Zunahme nationaler Spannungen und nationalistischer und faschistischer Bewegungen einhergingen.
Der große Unterschied zwischen den nationalen Wirtschaftskriegen der 1930er Jahre und der heutigen Lage besteht aber darin, dass die Globalisierung eine derartig enge globale Wirtschaftsverflechtung hervorbrachte, dass eine Schließung der Grenzen für die Warenströme und die Einführung von Schutzzöllen - wie in den 30ern üblich – für die neoliberalen Funktionseliten aus Politik und Wirtschaft jahrelang unvorstellbar war (Dies änderte sich erst mit der Amtsübernahme durch Turmp). Stattdessen wurden nach dem Krisenausbruch 2008 die nationalen Wirtschaftskriege in Form von Währungskriegen ausgetreten, bei denen Währungsabwertungen den Exportindustrien Vorteile auf den Weltmarkt verschaffen sollen.
Diese nationale Krisenkonkurrenz zwischen den längst von Zerfallserscheinungen (etwa zunehmender Korruption) ergriffenen Staatsapparaten vollzieht sich nicht nur auf wirtschaftlicher, sondern auch auf geopolitischer oder militärischer Ebene. Dies gilt vor allem für die Ukraine, die ja nur deswegen ab 2014 Objekt des neoimperialen Great Game zwischen Ost und West wurde, weil sich Kiew einer eskalierenden Wirtschaftskrise gegenüber sah. Die Ukraine war als ein eigenständiger Staat schlicht nicht mehr ökonomisch überlebensfähig, weswegen sich die ostukrainische Oligarchie, deren politischer Vertreter Janukowitsch war, zwischen der Einbindung in eins der um die Ukraine konkurrierenden Machtzentren entscheiden musste. Janukowitsch entschied sich für Moskau, was die vom Westen massiv unterstützte Protestbewegung erst initiierte.
Imperiale Interventionen
Auch in den Zusammenbruchsgebieten des Weltmarkts, im arabischen Raum und im subsaharischen Afrika, sind imperiale Interventionen an der Tagesordnung, die den objektiven - hinter dem Rücken der Akteure ablaufenden - Krisenprozess exekutieren. Der Krisenimperialismus beschleunigt den Zerfall der Nationalstaaten der Peripherie. Um den Leichnam Syriens oder des Irak raufen sich jahrelang gleich reihenweise die regionalen und globalen "Mächte", wie die Türkei, die arabischen Golfdespotien, die USA oder Russland, die jeweils ihre Fraktionen im nicht enden wollenden Gemetzel unterstützten.
Dennoch ist es ein immer wieder - auch in der Linken - begangener Fehler, die militärischen Interventionen des Westens für den offenen Zerfall der Nationalstaaten verantwortlich zu machen. Die imperialen Großmächte tun gewissermaßen genau dass, was sie seit der Etablierung und Expansion des kapitalistischen Weltsystems schon immer machten, sie verhalfen der "unsichtbaren Hand" des Weltmarktes notfalls mit dem eisernen Handschuh ihrer Militärmaschinerie zur Geltung - etwa bei den Opiumkriegen des britischen Empire gegen China.
Doch inzwischen funktioniert dieser Krisenimperialismus nicht mehr. Der Westen kann die Kriege gegen die morschen Staatsapparate der Periphere gewinnen, doch er verliert immer wieder den Frieden. Die nationalen Staatsapparate zerfallen und die ehemaligen Nationalstaaten lösen sich in Chaos und Anomie auf, ohne dass es den Interventionsmächten noch gelingt, ein höriges Marionettenregime zu installieren. (siehe hierzu: Robert Kurz: Weltordnungskrieg – Das Ende der Souveränität und die Wandlungen des Imperialismus im Zeitalter der Globalisierung, Bad Honnef 2003.)
Alle militärischen Interventionen der vergangenen zwei Dekaden haben sich trotz militärischer Erfolge als kolossale Fehlschläge erwiesen, die Billionen von US-Dollar verschlangen, ohne die angepeilten Ziele auch nur ansatzweise zu erreichen: von Afghanistan, über den Irak, bis hin zu Libyen. Ein Desaster folgt dem nächsten. Und wieder: die "subjektive", von einem imperialistischen Interessenkalkül geleitete, Intervention beschleunigt nur den systemischen Zerfalls- und Krisenprozess des kapitalistischen Weltsystems, der sich in einem dekadenlangen Prozess schubweise von der Peripherie in die Zentren frisst. Es wird nur das umgestürzt, was ohnehin im Fallen begriffen ist.
Es gibt keinen Irak, kein Afghanistan, Libyen mehr. Diese Länder stellten schon vor den Interventionen bloße Modernisierungsruinen dar, in denen Kapitalverwertung nicht im ausreichenden Ausmaß stattfand, um eine funktionsfähige "Volkswirtschaft" aufrechtzuerhalten. Will man der Zukunft der Nation innerhalb des sich auflösenden spätkapitalistischen Weltsystems ansichtig werden, so reicht hierfür ein Blick gen Süden. Zusammenbruchgebiete wie Somalia, Kongo oder Afghanistan wechseln sich ab mit archaisch-despotischen Regimes wie Eritrea oder Nord Korea.
Die historische Zeit des Nationalstaates, dem die krisenhafte Globalisierung das ökonomische Fundament entzogen hat, ist somit tatsächlich abgelaufen. Bei den Nationen handelt es sich ohnehin um ein relativ junges und offensichtlich vergängliches Phänomen, das sich erst im 19. Jahrhundert ausformte (zusammen mit den meisten Landessprachen, wie etwa dem Hochdeutschen).
Die offenen, evidenten nationalstaatlichen Zerfallsprozesse in der Peripherie oder Semiperipherie des kapitalistischen Weltsystems wirken auch in dessen Zentren - nur sich sie dort noch nicht so weit vorangeschritten. Wie hohl das nationalstaatliche Gerüst in den USA ist, machte die brutale und hilflose Reaktion der Staatsmacht auf die Naturkatastrophe in New Orleans deutlich, als der Hurrikan Katharina diese Region für Wochen in ein diktatorisches Dritte-Welt-Land verwandelte. Auch Russland Staatsapparat, der sich nun in Syrien engagiert, gilt als einer der korruptesten der Welt.
Endtimes
Es ist somit überdeutlich absehbar, dass die Zeit der Nation abgelaufen ist und die Nationalstaaten in Auflösung übergehen. Offensichtlich wird dies in der anhaltenden Flüchtlingskrise, die ja gerade durch die ökonomischen und staatlichen Zerfallsprozesse in der Peripherie und Semiperipherie ausgelöst wurde. Die Fluchtbewegungen sind Folge des um sich greifenden Weltbürgerkrieges, der dem Kollaps der Märkte und Staaten in immer größeren Zusammenbruchregionen folgt.
Die ökonomisch "überflüssigen" Menschen fliehen folglich aus diesen Regionen in die verbliebenen, beständig schrumpfenden Inseln der scheinbaren Stabilität, die aber den Anschein einer funktionierenden nationalen Arbeitsgesellschaft nur noch auf Kosten der kollabierenden Peripherie aufrechterhalten können - auch wenn in den Zentren die Fassaden ebenfalls zunehmend bröckeln.
Dies gilt nicht nur für die USA mit dem US-Dollar als Weltleitwährung, die gerade die Krise der Schwellenländer befeuert, sondern auch und vor allem für die BRD, die mittels neo-merkantilistischer Politik und ungeheurer Handelsüberschüsse nicht nur Schulden exportiert, sondern auch Arbeitslosigkeit. Insofern ist es nur konsequent, dass die Massen der ökonomisch "Überflüssigen" sich gerade den Exportüberschussweltmeister BRD als Zufluchtsort aussuchen.
Eine "Rückkehr" in frühere - heute gern idealisierte - kapitalistische Formationen, wie den Sozialstaat der 70er oder die Wirtschaftswunderwelt der 50er ist angesichts der dargelegten irreversiblen Krisendynamik absolut illusionär. Jeder Appell, der eine Rückkehr zur Nation als Krisenantwort propagiert, führt ins sozioökonomische wie politische Desaster und kann nur als erzreaktionär bezeichnet werden. Die auch von Teilen einer konservativen Linken propagierte Rückkehr zur Nation kann angesichts der Krisenreife nur einen weiteren Schritt in die Barbarei gleichkommen.
Hieraus, aus eben diesem systemischen, systemimmanent unkontrollierbaren Krisenprozess, resultieren die von Müller eingangs beklagten widersprüchlichen Erscheinungen, wo eine ökonomisch ohnmächtige nationalistische Politik massenhaften Zulauf und Aufwind erhält, während die globale ökonomische Verflechtung den Nationalstaat eigentlich obsolet macht. Doch zugleich kann der Kapitalismus nicht aus seiner nationalstaatlichen Hülle heraus, da die politische Konkurrenz der Staatsapparate nur die Fortsetzung der allgemeinen ökonomischen Konkurrenz darstellt, die ja konstitutiv für den Kapitalismus ist.
Deswegen klagt beispielsweise Müller, dass die "europäische Integration" auf "halbem Wege stecken geblieben" sei, da es tatsächlich keine nennenswerten europäischen Machtzentren gibt, die als trans- oder postnational bezeichnet werden könnten. Brüssel ist kein europäischer Machtfaktor, die Entscheidungen fallen seit Krisenausbruch explizit in den Hauptstädten - insbesondere in Berlin.
Die EU war schon immer eine durch den Krisenprozess befeuerte Kampfarena, auf der wechselnde europäische Nationalkoalitionen ihre Interessen durchzusetzen versuchten. Solange die europäische Verschuldungsdynamik aufrechterhalten werden konnte, die erst die Eurozone ermöglichte, fiel dies der breiten Öffentlichkeit nicht auf, weil die entsprechenden Defizitkonjunkturen allen Beteiligten das Gefühl verschafften, an einem allgemein vorteilhaften "Integrationsprozess" beteiligt zu sein. Die nationalen Machtkämpfe, die vor dem Ausbruch der Eurokrise hinter geschlossenen Brüsseler Türen abliefen, traten mit der Eskalation der Krisenkonkurrenz nach Ausbruch der Eurokrise mit voller Wucht an Tageslicht.
Eine Überwindung der kollabierenden Nationalstaaten, die in ihrer Agonie sich wechselseitig an die Gurgel zu gehen versuchen, ist aber nur jenseits des Kapitalismus, jenseits der kollabierenden Kapitalvergesellschaftung mit all ihren Vermittlungsebenen möglich. Es mag illusionär erscheinen, die Nation, den Markt, das Geld, den Staat überwinden zu wollen, aber rein negativ ist dies längst der Fall. Die Krise des Kapitals lässt all diese durch das Kapital hervorgebrachten Formen der negativen Vergesellschaftung zerfallen. Wiederum hilft hier ein Blick gen Süden. Die Staaten, die nationalen "Volkswirtschaften" und Märkte sind in den Failed States der Periphere längst in Geschichte übergegangen.
Dabei treten im Krisenprozess autoritäre Tendenzen und zunehmende, von Seilschaften und Rackets betriebene Krisenkonkurrenz in eine Wechselwirkung, die gerade in faschistischen Bewegungen ihre organisatorische Ausdrucksform findet: Der Leviathan und das Racket bilden die beiden Mahlsteine, die im kapitalistischen Barbarisierungsprozess die zivilisatorischen Errungenschaften der letzten 10.000 Jahre zu zermahlen drohen. Die - bisherigen - Endpunkte dieser Entwicklung sind in Nordkorea und Somalia zu finden. 1984 oder Mad Max? Dies ist die Wahl, die der Krisenprozess systemimmanent den Insassen der zusammenbrechenden kapitalistischen Tretmühle lässt.
Das historische Ende der - von der herrschenden Ideologie für Naturgesetze gehaltenen - anachronistischen Formen kapitalistischer Vergesellschaftung ist somit unvermeidlich, da es aus den inneren Widersprüchen des Kapitals resultiert; es stellt sich nur die Frage, ob dies auch in den Zentren in der Form eines barbarischen Zusammenbruchs oder einer totalitären Formierung sich vollziehen wird, oder vermittels emanzipatorischer Aufhebung und Transformation in eine postnationale und postkapitalistische Gesellschaftsformation überführt werden kann - was nur durch eine breite antikapitalistische Bewegung möglich wäre, die den kategorialen und praktischen Bruch mit der Kapitalvergesellschaftung wagen würde.