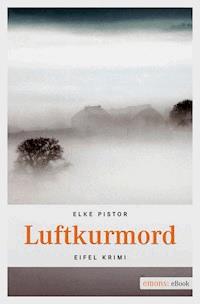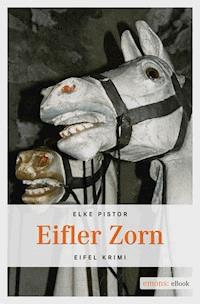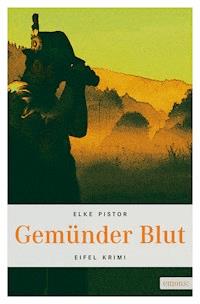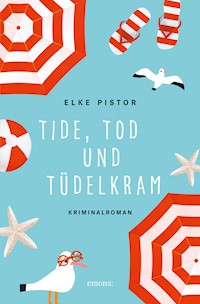Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tiefschwarzer Humor von seiner weihnachtlichsten Seite. Auch eine gut aufgeräumte Leiche ist eine Leiche und erfordert die Anwesenheit der Polizei, beschließt Janne Glöckchen, als sie eine Tote zwischen ihren farblich sortierten Mülltonnen findet. Wohl fühlt sie sich allerdings nicht dabei, liegt doch in ihrem Keller bereits ihre verstorbene Chefin Irmgard Kling auf Eis. Aber schlimmer geht immer: Ein junger Mann mit unlauteren Absichten und eine dritte Leiche machen die Aussicht auf eine stilvolle Vorweihnachtszeit für Janne vollends zunichte . . .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elke Pistor, Jahrgang 1967, studierte Pädagogik und Psychologie. Seit 2009 ist sie als Autorin, Publizistin und Medien-Dozentin tätig. 2014 wurde sie für ihre Arbeit mit dem Töwerland-Stipendium ausgezeichnet und 2015 für den Friedrich-Glauser-Preis in der Kategorie »Kurzkrimi« nominiert. Elke Pistor lebt mit ihrer Familie in Köln.
www.elke-pistor.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: shutterstock.com/SunshineVector
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Marit Obsen
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-783-5
Ein Weihnachtskrimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Autoren- und Verlagsagentur Peter Molden, Köln.
Weihnachten ist, wenn die besten Geschenkeam Tisch sitzen und nicht unterm Baum liegen.
Netzfund, Verfasser/-in unbekannt
Kapitel 1
Jemand hatte meine am Vorabend mühevoll hergestellte Ordnung zunichtegemacht. Mutwillig und mit Vorsatz, wie es schien. Die Mülltonnen standen kreuz und quer über den Hinterhof verteilt, statt sich nach ihren Farben sortiert an der Wand aufzureihen. Mehrere waren sogar umgestürzt. Ihr Inhalt lag auf dem Boden. Wobei »auf dem Boden« nicht ganz korrekt war. Denn zwischen dem Müll und dem Asphalt befand sich ein Körper, dessen absolute Reglosigkeit den Schluss nahelegte, dass es sich hierbei um eine Leiche handelte. Der Neuschnee, der große Teile des Gesichts und andere Körperteile bedeckte, unterstrich diesen Eindruck.
Mein erster Impuls war, den Müll wieder zurück in die entsprechenden Tonnen zu sortieren, denn wenn auch nur eine Plastiktüte im Altpapier landet, weigert sich die Müllabfuhr, die Tonnen mitzunehmen. Und überfüllte Abfallbehälter wollte ich auf keinen Fall riskieren. Dann wurde mir klar, dass selbst eine sehr gut aufgeräumte Leiche immer noch eine Leiche war und als solche eigentlich nicht an einen Ort wie diesen hier gehörte, weshalb ich besser die Polizei informieren sollte.
Ich riss mich also los, ging zurück in den Laden und griff zum Hörer. Die hiesige Ordnungshüterschaft machte einen nur halb begeisterten Eindruck, was ich der frühen Tageszeit zurechnete, versicherte mir aber, einen Wagen vorbeizuschicken. Ich sah auf die Uhr. Um kurz vor halb sechs waren die Straßen meist frei, und es dürfte daher nicht allzu lange dauern, bis die Damen und Herren in Blau erscheinen würden.
Ich fragte mich, ob sie sich an die herrschende Einbahnstraßenregelung halten würden, die die Stadt hier seit Neuestem eingeführt hatte. Rund um unseren hübschen Altstadtkern aus historischen Fachwerkhäusern führte die Ringstraße nur in eine Richtung. Und obwohl die Polizeistation lediglich wenige hundert Meter von meinem Ladengeschäft entfernt war, müssten sie entweder einmal die komplette Runde absolvieren oder das Gesetz brechen und gegen die Einbahnstraße fahren. Ich zog mir eine Jacke über und ging zur Vordertür, um Ausschau zu halten.
Das gelbe Licht der Straßenleuchten ließ den Schnee unappetitlich aussehen. Dabei mochte ich die unberührte Reinheit einer neuen Schneedecke sehr. Sie beruhigte mich. Von Blaulicht allerdings keine Spur. Sie hielten sich also an die Regeln.
Um die Wartezeit zu überbrücken und meine aufkeimende Neugierde zu befriedigen, ging ich zurück in den Hinterhof, intuitiv nach meinem Handy greifend. Eine Leiche ist ja nun mal kein alltägliches Ereignis. Das schrie nach einem Foto. Was, wenn die Tote – und dass es sich um eine Frau handelte, konnte auch der Müll nicht verbergen – was, wenn sie berühmt war? Ein Filmstar? Eine Sängerin? Der Spross einer verarmten Adelsfamilie? Ich sah schon die Schlagzeilen vor mir: »Letzte Bühne Müllcontainer, Abgesang im Hinterhof« oder »Adel: recycelt«.
Ich betrachtete die Tote. Die erkennbaren Teile des Gesichts sahen nicht schlecht aus. Ebenmäßige Züge, glatte Haut. Ihr Haar war lang. Welche Farbe es genau hatte, konnte ich nicht erkennen. Irgendwie schien es am Kopf dunkler zu sein als an den Haarspitzen. So etwas kannte ich von einigen meiner Kundinnen und fand es nicht unattraktiv, wenn auch für meine Haare eher ungeeignet. Zumal bei dieser Farbgestaltung nicht Mutter Natur, sondern eine geschickte Haarkünstlerin den Pinsel geführt hatte. Auch ihre Kleidung machte, abgesehen vom Müll natürlich, aber den hatte sie sich ja nicht mit Absicht übergeschüttet, einen sehr adretten Eindruck. Dunkelblaue Hose samt passendem Blazer, dazu eine hellblaue Bluse. Das gefiel mir sehr gut, auch wenn ich es jahreszeitlich nicht ganz passend fand.
Vielleicht schrieben die Zeitungen dann ja auch über mich? »Dianne G. aus D.: So schicksalhaft war ihre Begegnung mit dem Tod.« Dann läge ich in allen Arztpraxen, Friseursalons und sämtlichen Wartezimmern des Ortes aus. Ob die Leute mich erkennen würden? Die Vorstellung war mir unangenehm. Es reichte mir schon, wenn unsere Kunden mich mit Namen begrüßten.
Um mich zu beruhigen, griff ich doch zum Kehrblech. Der Müll lag auch in den hintersten Ecken, einige Meter weit weg von der Leiche. Das war für die Polizei sicher nicht interessant. Ich bückte mich und sammelte einige Papierfetzen und anderen Dreck auf. Ganz hinten an der Mauer lag etwas, das ich zuerst für ein Lederarmband hielt. Ich bückte mich, hob es auf und wischte den matschigen Schnee ab. Dunkelrotes Leder, kleine Strasssteine und ein funkelnder goldener Anhänger, der sich als kleine Kapsel herausstellte. Ich drehte daran, und die Kapsel öffnete sich. Ein kleiner Zettel fiel heraus. Fast wäre er mir entglitten, aber ich fing ihn auf, bevor er auf die nächste Schneewehe segelte.
Mein Name ist Ronald Egidius von Xanten. Am besten höre ich aber auf »Rex«. Wenn Sie mich finden, rufen Sie bitte diese Nummer an.
Dann folgte eine Handynummer.
Ich überlegte kurz, ob ich die Nummer anrufen sollte, verwarf den Gedanken aber wieder, da kein Kausalzusammenhang zwischen Anruf und Lederband zu erkennen war. Vermutlich bezog sich die Aufforderung ja nicht auf das Halsband, sondern auf das Tier, das im Normalfall darin stecken sollte. Obgleich der Name Rex Assoziationen von Hunden in Kalbsgröße mit dem dazugehörigen Karnivorengebiss in mir hervorrief, war mir klar, dass das in diesem Fall nicht stimmen konnte. Dieses Lederband ließ sich im Höchstfall um den Hals einer Katze schlingen. Oder, sollte es doch für einen Hund bestimmt sein, um den eines kleinen Hundes. Eines sehr kleinen Hundes. Einer von denen, die gern von irgendwelchen Frauen in quietschbunten Handtaschen herumgetragen wurden, nur dass sie dabei nicht sehr glücklich aussahen. Die Hunde, nicht die Frauen. Wobei ich nicht abschätzen konnte, ob sie das wegen ihrer aktuellen oder der grundsätzlichen Lage taten. Vermutlich war es weder angenehm, in einer Handtasche zu stecken, noch, so klein zu sein, dass dies überhaupt möglich war.
Ich steckte das Halsband ein. Es war viel zu schade, um hier im Dreck zu vergammeln. Wenn ich die Kapsel ein bisschen polierte, passte es wunderbar ins Warensortiment und würde bestimmt einen Abnehmer finden.
Die anrückende Polizei vergrößerte die ohnehin schon bestehende Unordnung noch. So viele Menschen in unserem eher überschaubaren Hinterhof, die Tonnen, der Müll und die Leiche. Zum Glück nahm eine freundlich lächelnde Polizistin die Gelegenheit wahr und bugsierte mich in das Ladenlokal. Hier allerdings fiel die Freundlichkeit wie schlecht geklebter Glitzer von ihr ab, und sie begann, mich ernst zu befragen. Wer ich denn sei – Dianne Glöckchen –, wie meine Daten lauteten – neunundzwanzig Jahre, ledig, keine Kinder –, warum ich zu dieser frühen Stunde überhaupt schon im Laden sei – weil ich hier wohne. Also, temporär.
An dieser Stelle unseres Gesprächs verspürte sie wohl das Bedürfnis nach mehr Tiefe und bat mich, mit auf die Polizeistation zu kommen. Hier wurden die Fragen aufdringlicher. Aber es half ja nichts. Schließlich hatte ich das Opfer – so nannte die Polizistin die Leiche, seit sich herausgestellt hatte, dass eine große Kopfverletzung deren Ableben mutmaßlich Vorschub geleistet hatte – gefunden.
Kurz erwog ich, ihr den sehr unwahrscheinlichen Zusammenhang zwischen meiner Zeugen- und einer möglichen Täterschaft zu erläutern, nahm aber schnell davon Abstand. Sie hätte mir, schon aus rein berufsethischen Gründen, sowieso nicht vorbehaltlos glauben dürfen. Also stellte ich mich den Fragen und lieferte Antworten, angefangen mit meiner Wohnsituation.
Dazu muss man wissen, dass das »Kling und Glöckchen«, der Laden, in dem ich arbeitete, nicht mein Laden war, sondern der verwirklichte Lebenstraum von Irmgard Kling, nach eigenen Angaben ihres Zeichens die größte Liebhaberin von Weihnachtsschmuck aus aller Welt. Und weil sie ebenso auch alle Welt an ihrer Liebhaberei teilhaben lassen wollte, hatte sie vor vielen Jahren das »Kling und Glöckchen« eröffnet und brachte seitdem ihre Schätze unters Volk. Krippen in allen Größen, Farben und Materialien, Baumschmuck in jeglicher Form mit und ohne Glitzer, Deko aus Glas, Holz, Metall und etwas, das mich entfernt an die Sandkuchen meiner Kindheit erinnerte, T-Shirts, Mützen, Schürzen und Kleider mit Weihnachtsmotiven, Schmuck, Poster, Bilder, Bücher, Kerzen und, und, und. Mein persönlicher Favorit war ein in einen weißen Mantel gehüllter Elefant mit Weihnachtsmütze aus Glas, der aussah wie Udo Jürgens bei seiner letzten Zugabe. Die Gesamtlänge aller vorrätigen Lichterketten reichte vermutlich dreimal um das gesamte Fachwerk-Altstadt-Arrangement von Dieckenbeck herum, wenn nicht noch weit darüber hinaus.
Mich hatte Irmgard Kling ursprünglich Ende Oktober als Aushilfe für den zu erwartenden hauptsaisonalen Ansturm eingestellt. Auf Stundenbasis, montags bis freitags von drei bis sieben, samstags von neun bis Ladenschluss. Sie ging inzwischen auf Mitte siebzig zu und wollte ein bisschen kürzertreten. Anfangs war sie skeptisch gewesen, ob ich diesem Job gewachsen war. Ich hatte sie im Verdacht, dass sie mich nur wegen meines Namens eingestellt hatte. Besser ginge es mir mit dem Gedanken, ich hätte sie mit meinen Qualifikationen und meiner absoluten Begeisterung von mir überzeugen können. Dabei war es der Mangel an Ersterem, was sie hatte zweifeln lassen. Immerhin konnte ich mit einem abgeschlossenen Germanistikstudium und einer Menge anderweitiger praktischer Erfahrung in unterschiedlichen Berufsfeldern aufwarten.
Gut, die praktischen Erfahrungen hatten in dem jeweiligen Berufsfeld nie länger als drei Monate betragen. So lange, wie ein Praktikum nun mal eben dauert. Aber dafür hatte ich viele mögliche Arbeitsstellen kennengelernt. In Verlagen, bei Zeitungen, in Werbeagenturen, in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit einer großen Firma, in einem Jugendtreff, in einem Theater, einer Bibliothek und einem Museum. Sogar ein großes Bestattungsinstitut war darunter gewesen. Leider war aus diesen möglichen Arbeitsplätzen nie ein tatsächlicher geworden, und ich sah mich schließlich gezwungen, mir eine Arbeit zu suchen, die mir die Miete, das Essen und ab und an einen neuen Pulli finanzierte.
Aber auch dieses Unterfangen stellte sich als nicht ganz leicht zu bewerkstelligen heraus. Regale im Lebensmittelladen einräumen, einfache Bürotätigkeiten ausüben, Nachtdienst an einer Tankstelle. All das hätte die Essenskasse gefüllt, das stimmt. Aber wenn ich schon eine andere und deutlich schlechter bezahlte Arbeit ausüben sollte als die, für die ich mich durch mein Studium qualifiziert hatte, dann sollte sie wenigstens Spaß machen. Oder mir »etwas geben«, wie es immer so schön hieß. Da kam mir der Job in Irmgard Klings Laden wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk vor. Mit extragroßer roter Schleife.
Ich liebte Weihnachtsdekoration. Immer schon. Ich war verrückt nach Weihnachtsdekoration. Ich konnte mich in weihnachtlichen Pomp immer wieder aufs Neue hineinsteigern. Oft hatte ich mich gefragt, ob nicht einer meiner Vorfahren aus den USA stammte. Irgendwoher musste ich das Weihnachtskitsch-Gen doch haben. Denn eigentlich widersprach die Vorstellung, Dinge nur zu kaufen, um sie im Anschluss herumstehen zu lassen, meinem inneren Wunsch nach Klarheit, Sauberkeit, Ordnung und Struktur zutiefst. Blumentöpfe – Fehlanzeige. Kleine Figuren, Trockensträuße, Häkeldeckchen – auf keinen Fall. Bilderrahmen mit Fotos näherer und ferner Freunde oder Verwandter – niemals. Abgesehen davon hätte ich mangels Masse nicht gewusst, welche Freunde ich denn in die Bilderrahmen hätte packen sollen. Es wäre wohl bei den bereits vorgedruckten Familienglückabbildungen geblieben. Gut also, dass die mir ohnehin nicht ins Haus kamen. Ganzjährige Dekorationsartikel waren wie Haustiere. Sie kosteten Geld, nahmen Platz weg und machten Dreck. Nur bei der Weihnachtsdeko eskalierte ich hemmungslos. Sechs Wochen lang mutierte meine ansonsten der gestrengen Logik eines Mister Spock folgende Wohnung zu einem Winter Wonderland mit allem, was man sich vorstellen konnte. Glitzer, Lichter, Tannengrün.
Hier zu arbeiten, fühlte sich für mich von der ersten Sekunde wie ein Sechser im Lotto an. Mit Zusatzzahl.
Deswegen freute es mich auch, als Irmgard Kling mir nach der ersten Woche eröffnete, ich könne mehr Stunden kommen. Dann jedoch geschahen zwei Dinge beinahe gleichzeitig, mit denen wir beide nicht gerechnet hatten.
Als Erstes explodierte mein Nachbar. Genau genommen sein Gasherd, bei dessen Bedienung ihm anscheinend gröbere Fehler unterlaufen waren. Ob mit Absicht oder aus Unwissenheit, konnte ich nicht sagen, denn so gut kannte ich ihn nicht. Letztlich war das auch unerheblich für die daraus resultierende Situation: Das Haus, in dem ich eine Zwei-Zimmer-Wohnung gemietet hatte, wurde renoviert, und ich musste so lange aus meiner Wohnung raus. Nur wusste ich nicht, wohin. Dieckenbeck war eine kleine Stadt mit einer mittelgroßen Universität. Die Chance auf eine freie Single-Wohnung war in etwa genau so groß wie die, ein Lichterkettenknäuel mit einmal irgendwo Ziehen zu entwirren.
Als Nächstes stürzte Irmgard Kling die Treppe zum Keller des Geschäfts hinunter. So etwas ist immer gefährlich, auch wenn dabei manch einer Glück im Unglück hat, besonders gefährlich aber ist es, wenn die stürzende Person schon etwas älter und körperlich nicht mehr ganz auf der Höhe ist. Deswegen raten Sicherheitsexperten auch immer zu einer ausreichenden Beleuchtung der brisanten Stellen im Haus, um Gefahrenquellen auszuschalten. Irmgard Kling hatte beides nicht. Weder die ausreichende Beleuchtung noch das Glück im Unglück. Irmgard Kling fiel ganz einfach im Dunkeln die Treppe hinunter, brach sich den Oberschenkel und verblutete an einer durch den Bruch verletzten Arterie.
So zumindest stellte sich die Situation für mich dar, als ich gestern Morgen in den Laden kam und Nachschub für die Filzwichtel in Regenbogenfarben holen wollte. Beim Anblick meiner Chefin war mir sehr schnell klar – anscheinend war das Praktikum beim Bestattungsunternehmen doch nicht ganz umsonst gewesen –, dass sie schon seit mehreren Stunden tot war.
Ich war geschockt und musste mich erst einmal setzen, um nachzudenken. Irmgard Kling war tot. Daran konnte auch der fähigste Arzt definitiv nichts mehr ändern. Die logische Schlussfolgerung aber lautete: Wenn Irmgard Kling tot war, würde das »Kling und Glöckchen« geschlossen. Erben hatte sie keine, das hatte sie mir erst vor Kurzem erzählt. Ihre Liebe zur Welt des Weihnachtsschmucks hatte in ihrem Leben keinen Platz für eine Familie gelassen. Wenn aber der Laden geschlossen würde, stünde ich wieder auf der Straße. Mehr noch. Wenn der Laden geschlossen würde, wäre ich meine absolute Lieblingsarbeitsstelle schneller wieder los, als ich sie ergattert hatte. Keine Strohsterne mehr. Keine Glitzerengel. Keine gepuzzelten Weihnachtskugeln. Keine singenden Plüschrentiere. Und kein Einkommen. Wobei ich das mit dem Geld in dem Moment als zweitrangig empfand. Den Laden schließen? Das durfte ich nicht zulassen. Zumal es auch sicherlich nicht in Irmgards Sinne wäre, hier kling- und glöckchenlos die Tür zuzuziehen.
Also zog ich stattdessen Irmgard in einen der hinteren Kellerräume, bettete sie dort behutsam auf einen alten, langen Holztisch, auf dem ich zuvor eine Decke ordentlich drapiert hatte, und öffnete das Fenster. Die Temperatur hier unten war definitiv im niedrigen einstelligen Bereich an der Grenze zum Nullpunkt. Das gab mir etwas Zeit für Überlegungen, wie ich weiter mit ihr verfahren sollte. Das Weihnachtsgeschäft würde sie sicher in halbwegs anständigem Zustand überstehen. Und danach konnten wir weitersehen. Offiziell wäre Irmgard spontan zu einer erkrankten Cousine gereist. Nur falls jemand fragen sollte.
Erfreulicherweise ermöglichte mir Irmgards spontanes Ableben die Lösung meines ersten Problems. Das »Kling und Glöckchen« verfügte nicht nur über einen sehr kalten Keller und einen großzügigen Lagerraum, sondern auch über eine mit Warenkartons zugestellte Duschkabine in der Toilette. In Irmgard Klings Wohnung zu ziehen, die ein Stockwerk höher lag, erschien mir dann doch zu übergriffig. Die Warenkartons hatte ich natürlich aus der Dusche geräumt, ordentlich zerkleinert und in der Papiertonne entsorgt. Die letzten heute Morgen. Und dabei war ich ja dann über die Leiche gestolpert. Meine zweite Leiche innerhalb von vierundzwanzig Stunden. Womit wir wieder beim Thema wären.
Natürlich verschwieg ich der Polizistin Irmgards wahren Aufenthaltsort. Ansonsten aber antwortete ich wahrheitsgemäß – wobei Verschweigen ja nicht gleich Lügen ist.
Nein, ich hatte nichts gehört.
Nein, ich hatte nichts gesehen.
Nein, ich kannte die Tote nicht.
Ja, ganz sicher, auch nicht, nachdem sie mir ein Foto von ihr im lebendigen Zustand unter die Nase geschoben hatte, wobei ich mich wunderte, wie schnell sie herausgefunden hatten, wer die junge Frau war.
Nein, ich konnte mir nicht vorstellen, was sie dort gesucht hatte.
Nein, als ich das letzte Mal am Abend im Hof gewesen war, um den Plastikmüll im gelben Sack zu entsorgen, war sie noch nicht da gewesen. Weder tot noch lebendig.
Das wäre mir aufgefallen. Ganz bestimmt.
Die Polizistin machte einen frustrierten Eindruck, und ich entwickelte ein gewisses Verständnis für sie. Es musste anstrengend sein, so ins Leere zu laufen, aber ich konnte ihr nun mal nicht weiterhelfen. Nachdem sie das nach einer Weile wohl endlich ebenfalls eingesehen hatte, entließ sie mich, jedoch nicht ohne mir vorher zu versichern, sie werde sich schon bald noch einmal bei mir melden.
Zurück im »Kling und Glöckchen« blieb mir lediglich eine halbe Stunde Zeit, bis ich das Geschäft öffnen musste. Das brachte mich in erhebliche Schwierigkeiten, denn nun meinen morgendlichen Routinen zu folgen, war damit so gut wie unmöglich geworden.
Im Normalfall frühstückte ich erst ausgiebig, zog mich an und räumte den Laden auf, bevor ich mit dem Staubwedel zu Felde zog. Diese Tätigkeit darf man in einem Laden wie dem »Kling und Glöckchen« weder vernachlässigen noch unterschätzen. Beides würde innerhalb kürzester Zeit den Reiz der ausgestellten Waren unter dicken Staubschichten verschwinden und sie unverkäuflich werden lassen. Irmgard Kling legte sehr großen Wert auf akribische Reinlichkeit im Verkaufsraum. Denn wer möchte schon einen Erzgebirge-Engel mit Staub- statt Lichterkrone mit nach Hause nehmen? Oder einen grau verschleierten Wichtel? Ganz zu schweigen von dem traurigen Anblick matt gewordenen Glitzers auf pinken Strohsternen. In diesem Punkt waren wir uns sehr schnell einig, und Irmgard Kling lobte meine Gründlichkeit in solchen Dingen.
Das freute mich wiederum sehr, denn Lob an sich war ich nicht gewohnt.
Meine Eltern hatten mich damit nicht gerade überschüttet. Genau genommen hatten sie sich grundsätzlich wenig mit mir beschäftigt. Sie waren das Musterbeispiel erfolgreicher Geschäftsleute. Von morgens bis abends in Sachen Business unterwegs. Termine, Meetings, Konferenzen. Eine Zeit lang dachte ich, mein Vater schliefe in seinen Maßanzügen, denn er kam damit morgens aus seinem Zimmer und trug sie, bis er am Abend ins Bett ging.
Meine Mutter sammelte Aktenkoffer wie andere Frauen Handtaschen. Sie hatte sie in allen Farben und Materialien. Immer passend zum Kostüm und zu den Schuhen. Beide jetteten ständig um die Welt. Wenn sie sich in unserem riesigen, kostspielig eingerichteten Haus begegneten, begrüßten sie sich wie Fremde. Mehr als einmal hatte ich mich gefragt, wie und vor allem warum sie mich überhaupt gezeugt hatten. Vermutlich, weil sie dachten, ein Kind im Lebenslauf fördere die Karriere.
Eine schwermütige Haushälterin namens Frau Olga Hundgeburth und ständig wechselnde Kindermädchen kümmerten sich um mich, bis mir Letztere im fortschreitenden Teenageralter auf die Nerven gingen und ich sie so konsequent vergraulte, dass meine Eltern sich damit abfanden und keinen Ersatz mehr suchten.
Irgendwann kam ein großer Wagen, und Männer in blauen Overalls luden die Maßanzüge meines Vaters und einige seiner Möbel in einen Lkw und fuhren damit davon. Er hätte eine Position im Ausland angenommen, klärte mich Frau Olga auf, und würde vermutlich in ein paar Jahren wieder zurückkommen. Oder auch nicht. Wer wisse das schon.
Auch meine Mutter wurde ans andere Ende des Landes versetzt und legte sich dort einen Wohnsitz zu. Für mich sei es jedoch besser, die restlichen vier Schuljahre in meinem gewohnten Umfeld zu verbringen.
Zu Beginn kam sie noch jedes Wochenende nach Hause, um, wie sie sagte, »Quality time« mit mir zu verbringen, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt schon andere Interessen. Zumindest gab ich vor, die zu haben, und erzählte ihr etwas von Freundinnen und Shoppingtouren und gemeinsamen Kinobesuchen. Dass ich von meinen Klassenkameradinnen in Wirklichkeit eher geduldet als gemocht wurde und bloß keine Lust auf ihre ewigen Fragen nach meinen Leistungen in der Schule (absolutes Mittelmaß) und meinen Plänen für die Zukunft hatte (auf keinen Fall so werden wie sie), bekam sie nicht mit. Vielleicht wollte sie es auch nicht sehen.
Aus den wöchentlichen Besuchen wurden vierzehntägige, dann kehrte sie nur noch einmal im Monat zurück. Irgendwann rief sie nur noch an und fragte nach mir. Mir machte es nichts aus. Frau Olga und ich kamen gut klar. Von ihr lernte ich eine Menge fürs Leben. Vorrangig über das Saubermachen und Ordnunghalten, aber es kamen auch andere Aspekte zum Tragen. Ab und an verschwanden Dinge. Kleine Skulpturen, Silberkannen und edle Vasen. Frau Olga wusste, dass ich wusste, dass sie dafür verantwortlich war, aber wir schwiegen darüber in einer Art gegenseitigem Stillhalteabkommen. Sie berichtete meinen Eltern nichts von meinen sich stetig verschlechternden Schulnoten, und ich hinderte sie nicht daran, ihr Gehalt auf kreative Art und Weise aufzubessern. Zumal so auch viel leichter Ordnung zu halten war.
Bis zum Tagesordnungspunkt Aufräumen hatte ich es heute Morgen geschafft, dann war die Leiche dazwischengekommen. Jetzt blieben mir dreißig Minuten für die Staubwedelei, die aber niemals ausreichen würden, denn ich musste auch noch das Wechselgeld zählen, den Boden kehren und die Postkartenständer auffüllen.
Zu allem Überfluss klopfte es jetzt an der Schaufensterscheibe. Vermutlich der Paketbote. Irmgard hatte im Sommer auf diversen Messen neue Waren bestellt und auch bereits bezahlt, weshalb nun täglich Pakete bei uns eintrudelten und die Regale nie leer wurden. Ich fand es wunderbar, welche Mengen an unterschiedlichen Dekorationsartikeln die Menschen kauften. Bei einigen unserer Stammkunden stellte ich mir oft vor, wie es in ihren Wohnungen aussah. Vermutlich glänzte, glitzerte und bimmelte es in allen Ecken. Oft war ich nahe dran gewesen, darum zu bitten, mir Fotos von den Einsatzorten der neu erworbenen Schätze zu senden, hatte mich aber bisher noch nicht getraut. Ich nahm mir fest vor, den Vorsatz heute in die Tat umzusetzen.
Es klopfte erneut, und ich eilte zur Ladentür, bereit, dem Paketmenschen gehörig den Kopf zu waschen, denn es hing ein deutlich lesbares Schild an der Tür mit dem Hinweis, die Waren am Hintereingang und nur zu den Geschäftszeiten abzuliefern.
Allerdings war es kein Paketbote, der da Einlass forderte. Vor der Tür stand ein großer, breitschultriger, um die dreißig Jahre alter Mann in Jogginghosen und Daunenjacke, dessen Lächeln durch einen kurzen blonden Bart blitzte. Ich starrte ihn an und spürte, wie ich rot wurde. Nur die Damenhandtasche unter seinem Arm irritierte mich.
Kapitel 2
Ich schüttelte heftig den Kopf, tippte von innen auf das Schild mit dem Hinweis und das darüber hängende Schild mit unseren Öffnungszeiten und hob dann mein Handgelenk, um auf meine nicht existierende Armbanduhr zu zeigen. Diese Geste hatte ich von Frau Olga übernommen, die immer, zu jeder Tages- und ich glaube auch Nachtzeit, eine schwere Armbanduhr aus rötlichem Gold mit glitzernden Steinchen trug. Einmal hatte ich sie gefragt, ob ich die Uhr auch einmal umbinden dürfe, aber sie hatte nur den Kopf bedächtig hin- und hergewiegt, das Schmuckstück liebevoll gestreichelt und was von Rentenversicherung gemurmelt. Natürlich durfte ich die Uhr nicht umbinden. Stattdessen hatte sie mich im nächsten Augenblick mit besagter Geste und dem Hinweis auf meine nicht erledigten Aufgaben aus der Küche gescheucht.
Ob es daran lag, dass der Mann vor meiner Ladentür Frau Olga und ihre goldene Uhr nicht kannte, oder ob er grundsätzlich etwas begriffsstutzig war, konnte ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall ließ er sich nicht abwimmeln. Er klopfte weiter beherzt an die Scheibe. Um deutlicher zu werden, drehte ich mich um, steuerte den hinteren Teil des Geschäftes an und stellte mich so neben ein Regal, dass ich ihn, aber er mich nicht sehen konnte.
Er ließ nicht locker. Als er schließlich sein Gesicht gegen die Scheibe presste und mit der flachen Hand neben sich ans Glas schlug, reichte es mir. So ein ungehobelter Klotz! Es würde mich mindestens zwanzig Minuten kosten, die Fettspuren seiner Haut vom Glas der Eingangstür zu putzen.
»Gehen Sie weg!«, schnauzte ich ihn an, noch während ich die Tür aufriss. »Können Sie nicht lesen?« Erneut tippte ich auf das Schild mit den Öffnungszeiten.
»Doch, ich –« Er brach ab, richtete sich zu voller Größe auf und schenkte mir das, was andere als strahlendes Lächeln bezeichnet hätten. Sicher war er es gewohnt, auf diese Weise seinen Willen zu bekommen. Ich war gespannt, wie er auf mein Nichtwollen reagieren würde.
»Kommen Sie in einer halben Stunde wieder. Jetzt habe ich keine Zeit, für was auch immer.« Ich schloss die Tür und drehte den Schlüssel um. Nur zur Sicherheit. Man weiß ja nie.
Kurz wirkte er komplett verdutzt. Dann wechselte sein Gesichtsausdruck zu flehentlich, und als auch das erkennbar nichts nutzte, lehnte er sich mit dem Rücken gegen die Scheibe und sank langsam in die Hocke, die Handtasche wie den Heiligen Gral umklammert.
Ich wandte mich ab, griff mit einer Hand zum Staubwedel und mit der anderen nach dem Postkartenständer. Erst mit links abstauben, dann mit rechts auffüllen. So ging es am schnellsten. Trotzdem machte mich das Wissen um seine Anwesenheit nervös. Nicht etwa, weil ich auf seine nicht zu übersehende Attraktivität reagiert hätte – dergleichen hatte ich mir schon vor vielen Jahren abgewöhnt. Mädchen beziehungsweise Frauen wie ich wurden von Angehörigen des männlichen Geschlechts im besten Fall ignoriert. Vermutlich entsprach ich nicht ihren irgendwelchen geheimen Regeln folgenden Kriterien. Was mir inzwischen aber nichts mehr ausmachte. Früher war das anders gewesen. Ich erinnerte mich an Dennis Selmenhorst, für den ich einst in frühpubertärer Liebe erblüht war und der mich, nachdem er mich einmal geküsst und meinen Busen gesucht, aber nicht gefunden hatte, am nächsten Tag in der Schule eiskalt abservierte und grinsend Lisa Kibulke den Arm um die Schulter legte. Das anschließende Gelächter und die hämischen Bemerkungen der Klasse hatten mir die schmerzvolle Erkenntnis gebracht, dass ich lediglich der Gegenstand einer Wette gewesen war.
Das war eine der seltenen Gelegenheiten gewesen, bei denen ich Einschneidendes erlebte, als meine Mutter zu Hause war und mein Elend zwischen zwei Telefonaten auch tatsächlich wahrnahm. Sie hatte mich tröstend in den Arm genommen – ein vollkommen ungewohntes Gefühl für mich –, mir über den Kopf gestrichen und selbigen dann an ihren im Gegensatz zu meinem in reichem Maße vorhandenen Busen gedrückt.
»Weißt du, Dianne, schöne Männer hat man nie für sich allein«, hörte ich sie sagen. »Deswegen habe ich auch deinen Vater geheiratet.«
Dass sie damit einen großen Teil zur genetischen Ursache meines Problems beigetragen hatte, war ihr vermutlich weder bei der damaligen Wahl ihres Partners noch in diesem Moment klar gewesen. Ein gut aussehender Vater wäre als Lieferant für mein Erbmaterial vermutlich die bessere Wahl gewesen, denn aus unserem Leben verschwunden war der andere ja auch.
Außerdem irritierte es mich, wenn sie mich Dianne nannte. Für alle außer Frau Olga war ich seit dem Kindergarten die Janne. Dort war ständig die Rede von »der Marit« und »dem Yannick« gewesen und dass »die Marit« jetzt doch bitte die Schaukel für »Dianne« freimachen sollte. »Die Dianne« war den Damen dann vermutlich doch zu zungenbrechend gewesen. Für die Kinder hörte sich »Dianne« aber wie »die Janne« an, und dabei war es dann geblieben. Ich war die Janne. Und die Janne ließ sich auf keinen Fall zu irgendetwas drängen.
Doch dieser Typ mit seiner Damenhandtasche saß immer noch dort draußen vor der Tür und schien jetzt sogar mit der Tasche zu sprechen.
Ich erbarmte mich und schloss die Tür auf. Sofort sprang er auf die Beine.
»Darf ich bitte reinkommen?«
Ich nickte, trat einen Schritt zurück und ließ ihn in den Laden.
»Was kann ich für Sie tun? Suchen Sie etwas Bestimmtes? Wir haben neue Einhorn-Anhänger bekommen. Als Figur und als Kugel.« Ich streckte die Hand aus und zeigte über seine Schulter hinweg in die pinke Abteilung des Ladens. Irmgard Kling hatte den Laden in Farbzonen eingeteilt. Die Einhorn-Sachen standen bei Pink, aber schon sehr nahe an der Grenze zum Elfenbein.
»Nein, ich wollte –« Er brach schon wieder ab. Dafür, dass er so hartnäckig war, konnte er seine Wünsche nicht allzu gut artikulieren. Er räusperte sich. »Ich wollte mit Ihnen sprechen.«
»Das tun Sie ja jetzt.«
»Über Laura.« Er sah mich erwartungsvoll an und schob, als er meinen Gesichtsausdruck der völligen Ahnungslosigkeit vollkommen richtig als völlige Ahnungslosigkeit einstufte, nach: »Meine Ex-Freundin.«
Nicht dass mir das weitergeholfen hätte. Ich überlegte angestrengt, ging verschiedene Möglichkeiten durch, kam aber immer zum selben Ergebnis.
»Ich kenne keine Laura.«
»Doch, also …« Er druckste herum. So langsam ging er mir mit seinen Sprechpausen und der Stotterei auf die Nerven. »Sie haben sie heute Morgen gefunden.«
»Ich habe keine Laura –«
Diesmal war ich es, die mitten im Satz abbrach. Die Tote. Sie hatte einen Namen. Laura. Und einen Ex-Freund.
»Wie heißen Sie?«, wollte ich von ihm wissen, obwohl das eigentlich nichts zur Sache tat.
»Ich bin der Elias.« Er hielt mir seine Hand hin und lächelte wieder dieses Lächeln, nur lag diesmal eine Prise Wehmut darin. Hatte er dieselbe Kindergärtnerin gehabt wie ich, der Elias?
Beinahe automatisch griff ich seine Hand und schüttelte sie. »Janne«, sagte ich.
Dass diese Höflichkeit ein großer Fehler gewesen war, wurde mir klar, als er die Handtasche fallen ließ und mich seitlich an sich heranzog. Was dann passierte, passierte sehr schnell. Zu schnell für mich und mit dem Ergebnis, dass mir erst schlecht und dann schwarz vor Augen wurde.
Ich wusste nicht, wie lange ich ohnmächtig gewesen war. Vor allem aber wusste ich nicht, warum ich das Bewusstsein verloren hatte. So schön war der Kerl nun wirklich nicht, dass ich bei der ersten Berührung vor Begeisterung zusammenklappte. Genau genommen war ich noch nie zusammengeklappt. Weder vor einem Mann noch vor einer Frau. Zusammenzuklappen passte überhaupt nicht zu mir. Deswegen irritierte mich die Situation sehr. Sie klärte sich etwas auf, als ich versuchte, mich zu bewegen.
Ich saß auf einem Stuhl im Büro. Das war zunächst nichts Ungewöhnliches. Hier hatte ich bereits öfter gesessen, mit und seit Kurzem ohne Irmgard, Geld zählend, Kaffee trinkend oder die kleinen Schleifen, mit denen wir die Geschenke verzierten, vorbereitend. Allerdings hatte ich bei den anderen Gelegenheiten ohne Probleme aufstehen und fortgehen können. In den Laden zum Beispiel oder zur Hintertür. Das ging jetzt nicht. Der freundliche junge Mann hatte meine Füße mit Kabelbinder an jeweils ein Stuhlbein und meine Hände aneinandergefesselt. Um meine Körpermitte herum sah ich zudem aus wie ein schlecht verpacktes Geschenk. Der Elias hatte mehrere Bahnen rotes Geschenkband um mich und die Stuhllehne gewickelt. Ob er auch eine schön aufgetuffte Schleife fabriziert hatte, konnte ich nicht sehen, denn die losen Enden befanden sich in meinem Rücken.
Das wiederum ließ den Schluss zu, dass die Ohnmacht nicht einfach so aus heiterem Himmel über mich gekommen, sondern gezielt von ihm herbeigeführt worden war. Jetzt erinnerte ich mich auch an seinen Arm, der sich von hinten um meinen Hals gelegt und zugedrückt hatte.
Aus dem Laden drangen Geräusche, die mich noch mehr beunruhigten als meine fixierte Lage.
Es raschelte, klackte, schabte. Dann ein Geräusch, als zöge jemand einen sich verweigernden Postkartenständer so lange über den Boden, bis dieser umfiel. Das Fluchen im Anschluss bestätigte meine Vermutung. Irgendetwas lief ganz und gar nicht so, wie mein Besucher es sich erhofft hatte. Wenn er nicht gerade jemand war, der unter Anwendung von Gewalt in fremde Geschäfte eindrang, um sodann seine höchstpersönlichen Vorstellungen eines gelungenen Shop-Konzeptes darin umzusetzen, suchte er etwas. Nur was?
Ich dachte nach. Um diese Uhrzeit Geld zu stehlen, wäre sehr unüberlegt. Am frühen Morgen lagen in den Kassen nur ein paar einsame Wechselgeldrollen. Dafür das Risiko eines Überfalls einzugehen, wäre mehr als dumm. Dabei hatte der junge Mann auf mich einen recht aufgeweckten Eindruck gemacht. Gut, die Stammelei und seine mangelnde Fähigkeit zur stringenten Kommunikation sprachen für ein einfacheres Gemüt. Aber das könnte auch Nervosität gewesen sein. Vielleicht war dies sein erster Überfall, und es mangelte ihm schlicht an Erfahrung.
Wollte er die Dekoartikel klauen? Das ließe sich doch ebenfalls einfacher bewerkstelligen. Zwar musste ich mich wegen meiner Aufmerksamkeit selbst loben – ich hatte in meiner kurzen Zeit hier bei Irmgard bereits vier Ladendiebe gestellt und war nicht zuletzt deswegen von meiner Chefin um mehr Arbeitsstunden gebeten worden –, aber alle erwischte ich sicher auch nicht.
Er hätte ja zumindest versuchen können, die Objekte seiner Begierde einfach in der Tasche verschwinden zu lassen. Dafür musste man doch nicht gleich rabiate Methoden anwenden.
Oder suchte er etwa nicht irgendwas, sondern irgendwen? War er vielleicht der Enkel, von dem Irmgard nie etwas erzählt hatte?
Sie hatte aber auch nicht von Söhnen oder Töchtern erzählt, und die galten ja gemeinhin als Voraussetzung für das Erscheinen von Enkelkindern. Noch nicht einmal von Cousinen oder Cousins hatte sie berichtet. Nein. Irmgard Kling hatte auf mich zu Recht einen komplett familienlosen Eindruck gemacht. Sonst hätte ich sie auch niemals an ihrem jetzigen Aufenthaltsort untergebracht. Also war der Elias … hatte er mir eigentlich seinen Nachnamen verraten? Ich glaube nicht. Also war der Elias kein Verwandter von Irmgard. Aber er war der Freund von Laura. Doch die war definitiv tot, und er wusste das. Da konnte er ja nicht erwarten, sie jetzt noch hier anzutreffen. Schließlich sammelte ich keine Leichen und bewahrte sie im Laden hinter dem Postkartenständer auf. Die eine im Keller reichte mir vollkommen. Das konnte ich ihm aber eher schlecht als Argument unterbreiten.
Im Laden war jetzt ein helles Klirren zu hören. Ich zuckte zusammen. So klang nur ganz dünnes Glas, wenn es zersplitterte. Ich hoffte, es wäre nur eine der einfacheren Kugeln und keine der Glasfiguren. Die waren meine absoluten Lieblinge im Sortiment. Vom Ballett tanzenden Nilpferd mit Flügelchen über Katzen mit Weihnachtsmützen und Totenköpfe mit kleinen Glöckchen in den Augen bis hin zu diversen Essenssachen wie Hamburgern, Petit Fours und Essiggurken hatten wir alles da, was man sich nur vorstellen konnte. Und der feine Herr Elias schien sich alle Mühe zu geben, möglichst viele meiner kleinen Schätze vorzeitig aus dem Weihnachtsgeschäft zu katapultieren.
Ich wurde wütend. Wie kam dieser dahergelaufene Totenfreund einfach dazu, meine Sachen zu zerstören? Zu allem Überfluss vernahm ich jetzt auch noch ein Geräusch, das ich nicht einordnen konnte. Ein hoher, dumpf keifender Ton.
Versuchsweise rieb ich meine Handgelenke aneinander, in der Hoffnung, eine meiner Hände befreien zu können. Fehlanzeige. Der Kabelbinder saß fest wie Schneespray an einer Fensterscheibe. Aber ich musste mich befreien. Die Frage war nur, wie.
Ein weiterer Umstand stützte meine Vermutung, dass der Elias kein Überfallprofi sein konnte. Die Kabelbinder um meine Beine und Arme waren eng genug, dass ich mich ohne Werkzeug nicht daraus befreien konnte, schnitten mir jedoch nicht die Blutzufuhr ab. So weit, so gut. Allerdings hatte er meine Hände vor meinem Bauch und nicht hinter dem Rücken zusammengeschnürt. Was sich jetzt als Vorteil erwies. Oder als Nachteil – je nachdem, welche Perspektive man einnahm.
In Irmgards Schreibtischschublade regierte das Chaos. Die Ordnungsliebe, die sie vor der Ladentheke walten ließ, hatte sie stets schlagartig verlassen, wenn sie die hinteren Räumlichkeiten betrat. Obgleich ich ihr zu ihren Lebzeiten mehrfach angeboten hatte, dieses Chaos für sie zu beseitigen, waren wir bisher noch nicht dazu gekommen. Hier würde ich mit Sicherheit eine Schere finden, mit der ich mich von meinen Fesseln befreien konnte. Im Anschluss würde ich mich mit einem größeren, festen Gegenstand wie zum Beispiel dem Besen oder dem Staubsaugerrohr bewaffnen und den Eindringling in Schach halten.
Wenn ich es mir recht überlegte, wäre es vermutlich sogar noch besser, wenn ich den heiligen Josef, von Irmgard Kling manchmal liebevoll Hejo oder »Jupp« genannt, zur Hilfe nahm. Die vierzig Zentimeter hohe Krippenfigur aus sehr festem Holz war auch schon in ihrer ursprünglichen Funktion sehr beeindruckend. Als Schlagwerkzeug in einer Notsituation würde sie mindestens ebenso hervorragend zur Geltung kommen.
Das einzige Hindernis, das zu bewältigen war, waren die zwei Meter zwischen mir und dem Schreibtisch. An sich kein Problem, sollte man meinen. Selbst unter Berücksichtigung meiner erschwerten Lage müsste die Strecke zu schaffen sein – wenn es sich denn um eine freie Strecke gehandelt hätte. Doch dem war nicht so. Zwischen mir und dem Schreibtisch stand der kleine Tisch mit der Kaffeemaschine und den ordentlich in die Höhe gestapelten Tassen, um den ich zunächst in aller Stille herumgelangen müsste, ehe ich den direkten Weg zum Ziel einschlagen konnte. Die zu erwartende Geräuschentwicklung bei einer eventuellen Berührung würde den Elias sicherlich alarmieren, und das galt es zu vermeiden.
Probeweise versuchte ich, den Stuhl in Bewegung zu setzen, indem ich so tat, als wollte ich langsam aufstehen. Das brachte gar nichts, außer einschneidenden Erlebnissen an den Fesselstellen. Wobei das Prinzip mir nicht verkehrt erschien. Ich musste nur mehr Schwung in die Bewegung bringen. Ich tat es und bereute es beinahe umgehend, da ich diesmal zu viel Kraft eingesetzt hatte. Der Stuhl löste sich ein Stückchen vom Boden, rutschte nach vorne und kippte bedrohlich auf die beiden vorderen Stuhlbeine. Nur mit Mühe gelang es mir, einen Sturz zu verhindern. Die Tassen auf dem Tisch klirrten, ich erstarrte und lauschte in den Laden hinein. Doch der Geräuschpegel dort blieb gleichbleibend hoch. Der Elias hatte sich anscheinend bis zu den Bleianhängern vorgearbeitet, die an einem Ständer hingen und bei jeder Bewegung gegen selbigen schlugen. Mich und die Tassen hatte er nicht gehört.
Ich fuhr fort. Diesmal mit mehr Gefühl. Es klappte schon besser. Ein weiterer Hüpfer, wieder drei Zentimeter. Wenn es in dem Tempo weiterging, brauchte ich nicht nur bis Silvester, bis ich mein Ziel erreichte, sondern könnte mich auch spätestens morgen vor Muskelkater nicht mehr bewegen.
Es bedurfte noch einiger zusätzlicher Anläufe, bis ich zu einer gut ausbalancierten Kombination aus Vorwärts- und Aufwärtsbewegung in der Lage war, die mich rascher vorankommen ließ. Nach der Hälfte der Strecke musste ich eine Pause machen. Zum einen, um wieder etwas zu Atem zu kommen. Zum anderen, um über die Bewältigung eines weiteren Hindernisses nachzudenken. Dieses Problem hätte ich auf meinem Weg zur Befreiung beinahe übersehen. An der rechten Seite des Büros stand ein Regal. Darin befanden sich neben diversen Ordnern einige unverkäufliche Stücke aus vergangenen Saisons, von denen Irmgard Kling sich nicht hatte trennen können. Das spezielle Stück, welches sich als mein nächster Gegner entpuppt hatte, war eine Art Gartenzwerg in Weihnachtsmannkluft aus Keramik, dem ein integrierter Bewegungsmelder innewohnte. Der Gartenzwergweihnachtsmann brach dann in ein gewaltiges »Meeeeeeerry Christmas« aus, eingeleitet und gefolgt von einem, wenn möglich, noch imposanteren »Hohoho«.
Irmgard hatte ihn so positioniert, dass er auf den Durchgang zwischen Laden und Büro zeigte, und er hohohote jedes Mal los, sobald wir die Räume wechselten. Im Laufe der Zeit hatte ich mich daran gewöhnt und ihn in der aus einigem Gebimmel und Gebammel bestehenden Geräuschkulisse des »Kling und Glöckchen« nicht mehr wahrgenommen. Jetzt aber musste er ausgeschaltet werden, wollte ich ihn nicht zum Verräter werden lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich ruckelte mich seitlich an ihn heran und versuchte behutsam, ihn mit meinen gefesselten Händen zu drehen. Auf seinem Rücken war ein Schalter. Was ich nicht bedacht hatte: Nicht nur eine Bewegung im Sensorradius vor dem Keramikmonster löste eine Lachsalve aus, sondern auch Unbewegtes, das durch Eigendrehung in sein Bewegungsmelder-Blickfeld geriet. Der Keramikweihnachtsmann legte los, kam aber nur bis zum zweiten Ho, bevor ich ihn mit meinen gefesselten Händen aus dem Regal riss und ihm mittels Schalter hektisch den Saft abdrehte. Das dritte Ho erstarb jämmerlich. Ich erstarrte. Im Laden wurde es still, bis auf den keifenden Stakkato-Ton. Dieser wurde lauter, hektischer und war jetzt deutlich weniger dumpf. Dann hörte ich den Elias fluchen.
»Verdammt!« Es folgte ein Rascheln. Dann wieder: »Verdammt!«
Der Elias hatte einen eher eingeschränkten Wortschatz. Sogar bei den Schimpfwörtern nutzte er mehrfach hintereinander dasselbe, wie mir am Rande auffiel. Mir blieb aber nicht allzu viel Zeit, um darüber nachzudenken. Denn im gleichen Moment kam etwas sehr Kleines ins Büro gerannt und flitzte unter meinem Stuhl hindurch, gefolgt von dem Elias. Er hielt seinen Blick gesenkt und bemerkte dabei nicht, dass ich mich nicht mehr an der Stelle befand, an der er mich zurückgelassen hatte. Dies war meine Chance, ihn außer Gefecht zu setzen. Sobald er meiner veränderten Position gewahr wurde und die richtigen Schlüsse daraus zog, würde er seine Fesseltechnik mit Sicherheit überdenken und im Anschluss verbessern.
Der Weihnachtsgartenzwergmann in meiner Hand wog schwer. Mit aller Kraft, die mir innewohnte, warf ich die Keramikfigur in Richtung seines Kopfes. Leider schränkten die Kabelbinder um meine Handgelenke nicht nur meine Koordinationsfähigkeit, sondern auch die Reichweite meiner Bewegung ein. Deswegen nahm die Figur eine gänzlich andere als die von mir geplante Flugbahn und plumpste dem Elias genau vor die Füße.
»Mistdreck!« Diesmal war es an mir zu fluchen, und ich nahm meine alternative Wortwahl mit Stolz zur Kenntnis. Aber mein großer Wortschatz half mir jetzt nicht weiter. Was mir half, war die Unachtsamkeit und, ich möchte fast sagen, Tölpelhaftigkeit meines Gegners. Der Elias stolperte über den Gartenmannweihnachtszwerg, verhedderte sich mit seinen Beinen und schlug der Länge nach auf den Boden. Allerdings erst, nachdem sein Kopf an der Kante des Tassentischs hart aufgeschlagen war und die Tassentürmchen zum Einsturz gebracht hatte. Deswegen bemerkte er auch nicht, wie diese auf ihn niederregneten. Zum Glück fielen sie weich und blieben unversehrt.
Ich betrachtete ihn eindringlich. War er tot? Eine dritte Leiche konnte ich so wenig brauchen wie bei der Lagerung angelaufenes und damit unverkäufliches Bleilametta. Eine der Tassen auf seinem Rücken verrutschte, glitt zu Boden, und der Henkel sprang mit einem leisen Klirren ab. Das war sehr ärgerlich, aber die Ursache beruhigte mich. Der Elias atmete noch. Immerhin. Aber der Tisch schien ihn wirklich hart getroffen zu haben. Denn auch das kleine, keifend kläffende Tier, das nun aus den hinteren Tiefen des Büros auf ihn zugelaufen kam und ihn ableckte, konnte ihn nicht wecken.
Kapitel 3
Im ersten Augenblick dachte ich, es sei eine ungewöhnlich kleine Katze oder eine besonders große Ratte. Aber beide Tiergattungen gaben für gewöhnlich nicht diese Laute von sich. Es dauerte einige Sekunden, bis mir klar wurde, woran mich das Tier und seine Geräuschabsonderungen erinnerten. An Hunde. Tatsächlich. Es bellte. Wenn auch mit sehr hoher Stimme – die aber, wenn man es recht bedachte, durchaus zu seinem Körpervolumen passte, das ja quasi nicht existent war. Nach einer weiteren Minute fiel mir auch wieder ein, was das für ein Hund sein konnte. Ein Chihuahua. Ein Handtaschenhund. Was Elias’ Handtasche und sein Gespräch mit eben dieser vor unserer Ladentür erklärte. Ich fragte mich ernsthaft, warum ein so stattlicher Mann wie Elias – und stattlich war er ohne Frage, sogar in seiner jetzt eher unglücklichen Lage – einen solchen Hund besaß. Aber gut. Die Menschen sind alle verschieden, und jeder soll so, wie er will. Warum also nicht als fast Zwei-Meter-Hüne einen Zwei-Kilo-Hund in einer Handtasche mit sich herumtragen. Einen Zwei-Kilo-Hund mit einem sehr schmalen Hals. So schmal, dass ihm nur ein sehr kleines Halsband passen würde. Zum Beispiel eines aus dunkelrotem Leder mit kleinen Strasssteinen und einem funkelnden goldenen Anhänger mit einem Papierzettel darin.
»Rex?«
Die Zierratte hob den Kopf, spitzte die Ohren und sah mich an, ehe sie sich wieder ihrem auf dem Boden liegenden Herrchen zuwandte.
Was sagt man in so einem Augenblick? Ich konnte auf keinerlei Erfahrung mit Haustieren im Allgemeinen zurückgreifen. Und mit Hunden im Speziellen schon gleich gar nicht. Aber meine Theorie schien zu stimmen. Deswegen versuchte ich es erneut.
»Rex! Sitz!«
Der Fellzwerg schaute abwechselnd mich und wieder den Elias an. Ich erkannte Zögern in seinem Blick. Schließlich entschied er sich für mich und ließ sich, nach einer erneuten Aufforderung meinerseits, auf seinen Hintern plumpsen. Erwartungsvoll schaute er zu mir hoch, nicht ahnend, in welche Unsicherheit er mich damit stürzte.
»Braver Junge«, sagte ich versuchsweise mit der sanftesten Stimme, zu der ich fähig war.
Es wirkte. Der Hund schwanzwedelte unter Einsatz seines gesamten Körpers auf mich zu. Er war ja erstaunlich schnell bereit, sein Herrchen zu verraten. Falls der Elias denn überhaupt Rex’ Herrchen war. Mir fiel ein, dass der Elias ja der Freund der kürzlich unfreiwillig verstorbenen Laura war, und die Transporthandtasche war definitiv eine Damenhandtasche. Also lag die Schlussfolgerung nahe, dass nicht der Elias Rex’ Herrchen, sondern Laura sein Frauchen gewesen war. Sein Frauchen, das heute Morgen tot in unserem Hinterhof gelegen hatte, ohne ihren Hund. Wobei ich stark bezweifelte, dass dessen Anwesenheit eine Veränderung dieses Umstands herbeigeführt hätte. Ein Wach- oder Schutzhund war Rex trotz seines imposanten Namens sicherlich nicht.
Es gab nun verschiedene Möglichkeiten. Entweder hatte Laura den Hund in die Obhut ihres Freundes gegeben, bevor sie sich hatte entleben lassen, oder der Hund war dabei gewesen und erst später zu Elias gekommen. Oder der Hund und