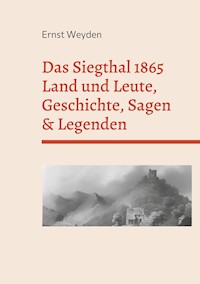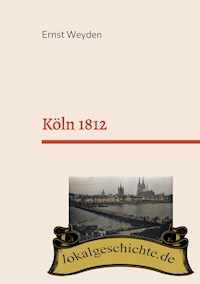
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ernst Weyden beschrieb im Jahre 1862 Köln, wie er es aus seiner Kindheit im Jahre 1812 in Erinnerung hatte. Wo ihm seine eigene Erinnerung nicht weiterhalf, zog er dritte zu Rate. Herausgekommen ist ein unvergleichliches Zeitzeugnis der großen Stadt am Rhein. Beschrieben wird nicht nur die Stadt selber, sondern auch ihre Bewohner, sowie deren Sitten und Gebräuche. Rückblicke auf die weiter zurückliegende Geschichte sind ebenfalls enthalten. Hier vorliegend finden Leserin und Leser den kompletten ungekürzten Text Weydens in aktueller Schrift. Fußnoten und Anlagen wurden in den Text eingearbeitet, was die Lesbarkeit verbessert, ohne dass der Inhalt selber geändert wurde. Tauchen Sie ein in die Geschichte der unvergleichlichen Stadt Köln am Rhein ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Ein paar Worte aus dem Jahr 2022
Wikipedia zu Ernst Weyden:
Köln am Rhein vor fünfzig Jahren
Vorwort
Einleitung
I. Das Aeußere der Stadt
Die Thore oder Burgen der Landseite
Mauern und Stadtgraben
Spielplätze
Bayenthurm
Huppet-Huhhot.
Das Werthchen
Rheinhalfen
Leistapel
Schürger
Hexemächer
Krahnen
Fliegende Brücke / Markmannsgasse
Schmuggler
Freihafen
Stapel
Speditionshandel
Zur Geschichte der Protestanten in Köln
Handelsfirmen
Zur Geschichte der Israeliten in Köln
Frankenthurm
Rechtspflege der freien Reichsstadt Köln
Holländische Beurtschiffe
Rhingroller
Kohlenhandel
Weckschnapp
Junkere Kirchhof
Köln, das thurmreiche
Domainen-Verkäufe
Münz / Mummis'-Gut
II. Das Innere der Stadt
Die Thore
Weyerstraße
Wallgassen
Wingerte
Kappesbauern
Feldbach
Filzengraben
Römerstadt
Kirchen und Kirchhöfe
Dom.
Domhof
Umgebung
Altermarkt
Heumarkt und Neumarkt
Straßen im Innern
Umgebung des von Zuydtwich'schen Hauses
Napoleon I. in Köln
Charakter der Häuser
Umbauten
III. Straßen-Leben
Straßen-Phosiognomie
Pflaster
Equipagen
Das alte Dom-Capitel
Bettler
Straßen-Reinigung
Hahnenkämpfe
Läuffersche
Aepfelweiber
Schürger
Usstievel
Ladengeschäfte
Marktleben
Ausrufen in den Straßen
Straßen-Unterhaltungen
Stadt-Originale
Kinderspiele in den Straßen
Spitzenklöppeln in den Wirkschulen
IV. Das Innere der Häuser
Bevölkerung
Millionär
Werth des Grundeigenthums
Zo Döhr/Innere Disposition der Häuser
Heilige Lampe
Vorhaus
Ausstattung der Zimmer
Möbel der Staats-Gemächer
Reinlichkeit
Freier
Rumpelkammer
Leinwandschrank
Küche
Beschreibung
Der Saal.
Haus-Conditorei/Festgelage
Kölsche Pefferlecker
Wohnstuben der Handwerker
Singvögel
Pützvögelchen
Eichhörnchen
Wachtel oder Böckteröck!
Kinderzucht
Prügelexecutionen
Gärten
Höfe
V. Kinder-Zeit
Geburt
Spenden des Ankömmlings
Gevatter
Taufe
Krohmkoche
Kinder Stillen
Weckelditzche
Bejofung
Hexen
Butzekop
Kinder-Leiche
Gebetchen
Kinder-Kleider
Die erste Hose
Schulbesuch
Schulstrafen
Täfelchen und Fibel
Unterhaltungen in der Schule
Schulbücher
Schulfeste
Studien
Firmbengel
Namenstage
Spazirgänge
Sanct Nikolas
Bescheerung
Krippchen in den Kirchen
Fahrt der Glocken nach Rom
Elementar-Studien der Mädchen
Zeichenstahl und Stoppstahl
Kölnische Sprache
VI. Kinder-Spiele
Kindheit
Sonst und jetzt
Volkslied
Mairegen
Maikäfer
Oemmer
Verschiedene Oemmerspiele
Die Litsch am Kaufhaus (Gürzenich)
Alle Juchte
Höppe Mötzchen
Springspiele
Stuppe, stuppe Steinche
Verstecke Steinche
Stom Handwerk
Plumpsack
Piepiep!
Altarspiel
Blinje Mömmesche
Isermännchen
Zählreime
Puppen
Pekele
Pel oder Pohl öm en Nohl
Avhevven
Plätsch un Roß
Krünchen oder Letterche
Conscription
Ballspiele: Ecken, Verjagen, stippe Fötje
Huche Parum / Kette Parum Baum / Käntche, Käntche!
Gepatte Vüjel
Döpp
Ringelreihen
Schneebälle
Schlittbahnen
Müsche fangen
Vögel- und Taubenhandel
Taubenkönige
Schifen-Brüdje
Klävleder / Schlippschlapp / Castagnetten
VII. Die Kleidung
Hauskleidung
Kurze Hosen
Der Zopf
Knotenperrücken
Puder
Mopshunde
Halsbinden
Jabot
Taschenuhren und Brelocken
Frackröcke
Roquleaure / Schanzläufer
Muffe
Runde Hüte
Bratenröcke
Pariser Herrenmoden
Frauenmäntel
Falje / Huik
Spitzen
Brautkleider
Serretétes
Marchands de modes
Nebels- und Kragkappe
Halbhandschuhe
Ohrgehänge und Brustkreuze
Loderähnsdöscher
Treckmützchen
Regen- und Sonnenschirme: Rähnparaso und Sonnenparaplüe.
VIII. Lebens-Weise
Lebens-Ordnung.
Frühstück
Kaffee
Kirchengang
Mittagsessen
Visiten
Kaffee-Verbot für das Herzogthum Westphalen
Drei-Fettmännches-Bier
Weißbrod
Geldsorten
Küchenzettel
Bestimmte Gerichte für bestimmte Zeiten
Arbeitszeit
Blauer Montag
Dienstleute
Spinnräder
Zu Bier und zu Wein
Bierhäuser
Regie-Tabak
Brandmarken
Oeffentlichkeit
Journale
Abendglocke
Sonntagsfeier / Dröpchen
Nachmittags-Vergnügen
Draußen und zu Hause
Gesellschaftlicher Ton
Bankspiele
Heirathen
Hochzeit
Krankheiten
Begräbniß
Reu-Essen
Stuten
Aberglauben
IX. Feste
Neujahrstag / Bälle / Jlöksillig Neujohr!
Fastnacht
Bellejeck
Mötzebestot oder Weiberfastnacht
Vorbereitung
Muze
Bände
Fastnacht-Begraben
Die Feier im Jahre 1812
Fest zur Feier der Geburt des Königs von Rom
Osterfest / Poschdag
Judas-Verbrennen
Ostereier
Gottestrag
Pfingsten
Kirmessen
Beiern
Straßenschmuck
Fänndrich un Föhrer
Processionen
Stadt-Musicanten
Pauken und Trompeten
Straßenleben
Opfer
Kirmeß auf dem Bayen-Graben
Christfest
Wursten
Christnacht
X. Vergnügen. - Reisen
Theater auf dem Klocker-Wäldchen, in der Schmierstraße
De Noël's Schilderung
Preise
Repertoire
Straßenbeleuchtung
Fackelträger und Leuchtenmänner
Straßensperre
De Krep oder Hänneschen
Mainacht
Blumenmarkt
Maitrank
Makai und Erdbeeren-Kalteschale
Johannisfest / Johannissegen
Ausflüge
Wallfahrten
Mülheimer Gottestrag
Kirmeß in Deutz und am Nippes
Martinsfest
Reisen nach Paris
Postreisen
Reise nach Frankfurt a. M. per Wasser-Diligence
XI. Wissenschaft und Kunst
Geistiger Zustand Kölns unter Napoleon
Wallraf's Bemühungen
Die olympische Gesellschaft
Die Werkstätte des Buchbinders Aug. Jansen
Haus-Lectüre
Volksbücher
Leihbibliothek
Vicarius Hardy
Gebr. Boisserie / Kölner Maler und Bildhauer
Musik und Musikfreunde.
Marcus DuMont
Dom-Kirchen-Musik
Der Flöten-Virtuose Franz Joseph Langen
XII. Der Wallraf's-Platz
Das Südende der Fettenhennen-Straße
Der Siegburger-Hof
Aegidius-Capelle
Das Innere des Siegburger-Hofes
Wehrwölfe und Gespenste
Gewaltrichter
Die Domprobstei
Der letzte Minstrel
Professor Ferdinand Wallraf
Das Innere seiner Wohnung
Goethe's Urtheil über Wallraf
Minoriten-Kloster
Frau Du Mont-Schauberg
Wallraf's Reise nach Paris
Sein Jubelfest Seine Todtenfeier
Wallraf's-Platz
Anhang: Contractionen und Corrumpirungen aus anderen Sprachen
Ein paar Worte aus dem Jahr 2022
Ernst Weyden machte sich im Jahr 1862 daran seine Kindheitserinnerungen aus Köln zu Papier zu bringen. Entstanden ist ein wertvolles Zeitzeugnis welches unter dem Titel „Köln am Rhein vor 50 Jahren“ als Buch erschienen ist.
Auch heute ist dieses Buch noch hochinteressant, gibt es doch Einblicke in die Welt unserer Vorfahren, wie sie sonst kaum zu erfahren sind.
So habe ich das mir vorliegende Buch aus Frakturschrift in die uns geläufige Schrift übertragen. Die Schreibweise, einschließlich vorhandener Druckfehler habe ich unverändert gelassen.
Dies ist ein historischer Text, welcher nicht geändert wurde, um seine Authentizität nicht zu gefährden. Darüber hinaus gibt der Text die Sprache seiner Zeit wieder, unabhängig davon, ob diese heute als politisch oder inhaltlich korrekt eingestuft würde. Ich gebe die Texte unverändert wieder. Das bedeutet jedoch nicht, dass die darin erklärten Aussagen oder Ausdrucksweisen von mir inhaltlich geteilt werden.
Frank Kemper
Wikipedia zu Ernst Weyden:
Ernst Weyden (* 18. Mai 1805 in Köln; † 11. Oktober 1869 in Altona) war ein Kölner Schriftsteller.
Er unterrichtete in der 1828 errichteten Höheren Bürgerschule. In seinem Werk Cölns Vorzeit erschien 1826 die Geschichte von den Heinzelmännchen zu Cöln erstmals in Schriftform.
In Köln-Poll wurde die Ernst-Weyden-Straße nach ihm benannt.
KÖLN AM RHEIN VOR FÜNFZIG JAHREN.
Sitten-Bilder nebst historischen Andeutungen und sprachlichen Erklärungen.
Von Ernst Weyden.
Die Originalvorlage dieses Buches erschien in Köln, 1862 beim Verlag der M. Du Mont-Schauberg'schen Buchhandlung. Der Druck erfolge damals durch Druck von M. DuMont · Schauberg.
Ihrer Majestät Königin Augusta von Preußen in tiefster Ehrfurcht
der Verfasser
VORWORT
Die mehr als freundliche Aufnahme, welche meine Skizzen: "Köln vor fünfzig Jahren" als Feuilleton der Kölnischen Zeitung in Köln selbst und anderwärts gefunden haben, war die nächste Veranlassung, die mich bewog, den von vielen Seiten an mich ergangenen Aufforderungen nachzukommen, diese Skizzen weiter auszuführen. So sind aus den Skizzen Sittenbilder entstanden, in welchen ich es versucht habe, Köln am Rhein nach der Natur zu schildern, wie es vor fünfzig Jahren in den Hauptbeziehungen seines äußeren und inneren Wesens und Treibens, aller seiner socialen Verhältnisse in die Erscheinung trat.
Nothwendig mußte ich mich bei diesen Bildern auf Umrisse beschränken, durfte nicht zu sehr ausmalen, nicht zu weit in die Details gehen und durchaus nicht künstlerisch ausschmücken, mußte vor Allem der Wahrheit treu bleiben. Und treu bin ich der Wahrheit geblieben, mag auch Manchem, der zwischen dem jetzigen Köln und dem geschilderten eine Parallele zieht, vielleicht das Eine oder das Andere übertrieben erscheinen. Ich darf aber die Versicherung geben, daß ich, als geborner Kölner, nach bestem Wissen und Können versucht habe, ein möglichst lebenstreues Bild meiner Vaterstadt und ihres Bürgerlebens vor fünfzig Jahren zu entwerfen. In wie weit mir dies gelungen, das zu beurtheilen, überlasse ich Anderen.
Meinen Zweck habe ich vollkommen erreicht, findet der Stammkölner in meinen Sittenbildern ein treues Gemälde seiner Vaterstadt, wie er sie vor fünfzig Jahren gekannt, frischen dieselben seine Erinnerungen auf, und rufen sie den Nichtkölnern ähnliche Zustände der Städte ihrer Heimat in die Erinnerung, da wir in den meisten Städten Deutschlands vor fünfzig Jahren in ähnlichen Ursachen ähnliche Wirkungen finden, wie ich dieselben aus Köln zu schildern versucht habe.
Bei meinen geschichtlichen Andeutungen, die sicher nicht unwillkommen sein werden, habe ich einen mehr allgemeinen Leserkreis vor Augen gehabt, weßhalb dieselben, fußen sie auch auf Quellen-Studium, keineswegs Ansprüche machen, für streng wissenschaftliche Abhandlungen gelten zu wollen. Man nehme dieselben für das, was sie sind, für allgemein gehaltene Andeutungen, namentlich zur Geschichte der Protestanten und Israeliten in Köln, welche Aufschlüsse geben sollen über zwei in der inneren Geschichte der Stadt so höchst wichtige Momente.
In meinen sprachlichen Erklärungen habe ich ebenfalls weniger den eigentlichen Sprachforscher, als einen allgemeineren Leserkreis berücksichtigt, dem sie das Verständniß des kölnischen Dialektes erleichtern sollen.
Ein kölnisches Sprüchwort sagt:
"Wae jitt, watt hae haett, es waeth, datt hae lèv!"
Köln, im Mai 1860.
E. W.
EINLEITUNG
Köln ist nicht mehr Köln! - Jeder geborne Kölner wird sich dieser Redensart als einer stehenden Lieblings-Phrase in dem Munde seiner Großeltern, oder gar seiner Eltern erinnern. Ja, Köln ist nicht mehr Köln, wie es noch der Anfang dieses Jahrhunderts gesehen, wie es noch vor fünfzig Jahren war, ein düsteres, trauriges Denkmal seiner bedeutungsvollen, großen Vergangenheit, deren Monumente in ihrem Verfalle vielberedte Leichensteine. Der lebensfrische Hauch einer neuen Zeit hat den Grabesmoder verweht. Die Stadt hat in ihren Chroniken den Beginn einer neuen Aera verzeichnet; eine neue vielverheißende Lebensperiode hat ihr begonnen.
In ihrer ganzen äußeren Erscheinung, in allen ihren commerciellen und industriellen, und daher in allen ihren socialen Verhältnissen ist die Stadt eine völlig andere geworden. Die Umgestaltung ist aber eine so gewaltig große, eine in allen ihren Elementen so völlige und durchgreifende, daß man kaum begreifen kann, wie dieselbe das Werk von noch nicht fünfzig Jahren.
Bedingt in den Zeitverhältnissen, steht die Zukunft der Stadt Köln fest. Sind jene keiner Umwälzung unterworfen, braucht man eben kein Weissager zu sein, um der Stadt die glänzendste Zukunft vorherzusagen, ein stätiges, noch rascheres und fruchtbareres Entfalten, als das der Glanzepochen, deren sich ihre Geschichte rühmt. Köln lebt in der Uebergangs-Periode, unter Deutschlands Städten wieder eine der ersten Großstädte zu werden. Daß Köln eine Großstadt wird, werden muß, bedeutender, als es in seiner mittelalterlichen Blüthezeit gewesen, ist unter den bestehenden Verhältnissen eine Nothwendigleit. Hoffen wir, voll treuer Zuversicht, daß dieselbe möglichst unerschütterlich, denn Köln kann bei jeder denkbar politischen Umwälzung nur verlieren.
Wir freuen uns einer lebensthätigen, hoffnungreichen Gegenwart, genießen in der Erwartung einer noch reicheren Zukunft die Früchte des Werdens, und mitwirkend in der allgemeinen Umgestaltung der Dinge und Verhältnisse, haben wir selbst nicht wahrgenommen, mit welchen Riesenschritten sich dieselben um uns her neu gestaltet haben.
Vielleicht, mein geneigter Leser - wenn ich Dich so nennen darf -, ist Deine Phantasie aber noch im Stande, sich ein lebendiges Bild der Stadt Köln zu entwerfen, wie dieselbe vor etwa fünfzig Jahren in ihrem Aeußeren und Inneren, im Wesen und Treiben ihrer Einwohner in die Erscheinung trat.
Ist dies nicht der Fall, reicht Deine Erinnerung nicht so weit, so findest Du doch wohl Gefallen, mit mir einen Rundgang um und durch das damalige Köln zu machen, mitunter einen verstohlenen Blick in das innere Familienleben seiner damaligen Bürger zu thun, sie in ihren traulichen Kreisen, in ihren Freuden und Leiden zu belauschen, Dich mit mir um etwa ein halbes Jahrhundert in die Uebergangs-Periode aus der guten alten Zeit, wie unsere Großeltern die Tage ihrer Jugend nannten, zurückzuversetzen.
I. DAS AEUßERE DER STADT.
Die Thore oder Burgen der Landseite - Mauern und Stadtgraben - Spielplätze - Bayenthurm - Huppet-Huhhot - das Werthchen - Rheinhalfen - Leistapel - Schürger - Hexemächer - Krahnen - Fliegende Brücke - Markmannsgasse - Schmuggler - Freihafen - Stapel - Speditionshandel - Handelsfirmen - Frankenthurm - Holländische Beurtschiffer - Rhingroller - Kohlenhandel - Weckschnapp - Junkere Kirchhof - Köln, das thurmreiche - Domainen-Verkäufe - Münz – Mummis'-Gut.
Die Thore oder Burgen der Landseite
Von welcher Seite wir uns der Stadt nähern, Schmutz und Koth, altherkömmliche Unwegsamkeit der Wege nicht scheuend, ihren fast zwei Stunden weiten Bering umwandern: ernst, Achtung gebietend ist ihr Anblick. Von ihrer einstigen Macht, von der hohen Bedeutung ihrer Vergangenheit unter Deutschlands Großstädten geben Kunde die stattlichen, Burgvesten ähnlichen Thurmwarten, nicht umsonst "Burgen" genannt, welche die Hauptthore der ganzen Landseite und einige Thore der Rheinseite schützen; dieses Ansehen bekundet die weite und mächtige Ringmauer, mit ihren seit 1497 überdachten Wehrgängen, zwischen den Thoren von vierundsechszig Halbthürmen oder Wichhäusern überragt, seit der zweiten Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts von sechsundzwanzig festen Bastionen oder Bollwerken geschirmt.
Mauern und Stadtgraben
Und welchen romantisch malerischen Charakter hat die Zeit, die unvergleichlichste Bildnerin und Malerin, der ganzen Außenseite der Stadt verliehen! Seit Jahrhunderten haben ihre Gehülfen, Sturm und Wetter, Frost und Regen, von Menschenhand durchaus nicht gestört, an den Außenwerken gemeinschaftlich mit ihr gewirthschaftet, an Mauerwerk und Thürmen gebildnert, Zinnen und Schießscharten phantastisch umgemodelt, und dem Ganzen eine Färbung gegeben, welche in dem mannigfaltigen Reichthume ihrer Töne und Uebergänge nicht zu schildern ist. Die meisten der Wichhäuser erinnern sich nicht mehr der Thurmkappen, die sie einst schützten, streckenweise hat der Wehrgang auch seine Bedachung eingebüßt. Statt der drohenden Stadtbüchsen drängen sich Schlingpflanzen und Strauchwerk aus den Schießscharten der Bastionen und Rondelle, deren Zinnen die Zeit in fröhlich grünende Gärten umgeschaffen hat, in welchen weißer und spanischer Hollunder, wilde Kirschen- und Apfelbäume lustig grünen und blühen.
Als die Franzosen 1794 Köln in Besitz nahmen, befanden sich im Stadtzeughause 144 Kanonen verschiedenen Calibers, 12 Falconette, 4 Haubitzen, 11 Mörser, 2 eiserne Steinböller, 160 Böller, 107 Lafetten, 4000 Kanonenkugeln, 120 Granaten, 1111 Bomben, 1000 Musketen, 900 Doppelhaken, 1213 eiserne Gewehre, 79 messingene, 104 Pistolen, 533 Säbel, 120 Trommeln, 22,000 Centner bleierne Kugeln, dann eine Menge kleinerer Armaturstücke, welches, im Ganzen zu einem Werthe von 211,545 Reichsthaler 60 Stüber veranschlagt, von den Franzosen weggeschleppt wurde. Die mittelalterlichen Waffenstücke, Rüstungen, Schilde u. s. w. kamen in die Sammlung des Baron von Hüpisch und nach dessen Tod in die Wallraf'sche. Eine dreizehn Fuß lange alterthümliche Feldschlange, fast ganz aus Silber gegossen, und zwei vergoldete, reich verzierte kupferne Kanonen, Musterarbeiten der Kunstgießerei, schleppte man auch fort. Die Oesterreicher hatten die so genannten zwölf Apostel weggenommen. Auch bewahrte das Zeughaus einen Streitwagen, Caroceio, auf dem, der Sage nach, die Kölner der Stadt Banner und Schlüssel in die Schlacht bei Worringen hinausführten. Der jedenfalls sehr alte Streitwagen ruhte auf zwei Achsen mit schweren runden Rädern, an deren Naben Sensen angebracht, wie Spieße an der Deichsel. Der aus schweren eichenen Bohlen gefertigte Aufsatz, stark mit Eisen beschlagen und mit der Stadt Wappen verziert, hatte Schutzzinnen, hinter welche sich die Streiter bergen konnten. Nachdem man das Eisen verkauft, wurde das Holzwerk verbrannt.
Der üppigste Epheu hat seinen, wer weiß, wie viele Geschlechter alten Mantel um die meisten der Thürme geworfen, mit seinem frischen Saftgrün die grauen Mauern bis über ihre zerbröckelten Zinnen im reichsten Sommerschmuck ausgeschlagen, den gelbgrauen Localton des Mauerwerks in eigenthümlichster Weise hebend. Waldfrisch lugen um den weiten Kranz der Landseite die laubmächtigen Kronen der kräftigsten Ulmen neugierig über die Mauerzinnen in die Stadt, und über ihnen sausen die Flügel der Windmühlen, die auf ehemaligen Thorthürmen des Mauerringes erbaut sind.
Spielplätze
Massenhaft wuchert Unkraut, grünt Baum- und Strauchwerk in dem eigentlichen Stadtgraben, dem so genannten "tiefen Graben". In früheren Jahrhunderten des ehrsamen Rathes Wildbahn, jetzt für die Knaben ein Ort der Sehnsucht, denn mit Lebensgefahr, die bröckelnden Basaltmauern hinabkletternd, holten wir uns dort das Hollunderholz zu den oft Neid erregenden "Knabbüssen" oder Knallbüchsen, deren Munition gewöhnlich die gekauten Schulschreibhefte und auch wohl die Schulbücher selbst.
Der 46. Artikel des 1513 errichteten "Transfix auff den Verbundsbrieff" sagt ausdrücklich: In der Stattgraben kein Wild zu halten verboten.
"Auch ist beschlossen, wann eine zeit her unser Stattgraben an bawm und zäune, und sonst durch das Wild, so darinnen gesetzt und gezogen worden ist, jömerlich - verdestruirt und verderblich - gemacht seynd, daß nach dieser zeit kein Jagd auff noch in unser Stattgraben von niemands, er sey groß oder klein mehr geschehen soll, auch kein Wild, als Hirschen, Hinden, Hasen oder Knine, auff noch in den Graben gesetzt noch gezogen werden sollen, und ob jemands darwider thete, denselben sall man also darumb ansehen, daß andere daran ein Exempel nemen."
Zwischen dem Haupt- und dem Vorgraben laden schattenreiche Baumreihen uns zum Lustwandeln auf den nicht gesperrten Wallgräben, der Bürger Sonntags-Spazirgänge, welche die Stadt dem Bürgermeister Balthasar von Mülheim († 1775) verdankte. Konnte es für das Kind eine fröhlichere Botschaft geben, als: "Do jeiss met op der Pöze-Graven"?
Horch! Lauter Jugendjubel schallt aus den Außengräben. Die muntere Knabenwelt tummelt sich hier an ihren Spieltagen herum. Das Jubelgeschrei wird zum Kriegsruf. Heiß entbrannt ist der Kampf. Wahrscheinlich hat sich eine Schule auf das Grabengebiet der anderen gewagt; denn die Knaben jeder Schule, jedes Stadtviertels haben ihre bestimmten Gräben, deren Besitz sie männlich zu behaupten wissen, um welchen mitunter die hartnäckigsten Schlachten geliefert und die Kämpfer nicht selten mit blutigen Köpfen heimgeschickt werden. Razzias aus den Gräben nach den nahliegenden Rüben- und Möhrenfeldern wurden auch wohl zuweilen von Einzelnen unternommen, die es auf eine Tracht Prügel von der eben nicht sanften Hand eines Kappesbauern hin wagten.
Wie majestätisch bauen sich die riesigen Thorwarten mit ihren weiten, den Hauptgraben durchschneidenden festen Zwingern und Brücken! Basalt, Tuffsteine, Trachyt-Werksteine und Ziegel, das Material, aus denen sie gebaut, mit welchem sie ausgeflickt sind, haben die Zeit wesentlich in ihrer Staffirung unterstützt, den Burgvesten, deren Thorwärter in vorfranzösischer Zeit auch "Burggräven" hießen, in ihrer Färbung eine unbeschreiblich malerische Wirkung verliehen. Jede Thorburg ein Bild. Auf jedem Thore hing ein riesiges Hängeschloß, dessen Schlüssel der Burggraf bewahrte. Die Rentmeister der Stadt, welche in vorfranzösischer Zeit die Aufsicht über die Thore und Thürme führten, mußten alle vierzehn Tage oder höchstens alle Monate in eigener Person die Klauster oder Vorhangschlösser der Thore wechseln.
Bayenthurm
Längs der verwahrlos'ten Schlehdorn-Hecke, welche den sein sollenden Weg um den Vorgraben vom Felde scheidet, gelangen wir zu dem mächtigen Zwingerbaue des Bayenthurmes, einem düstern Gewölbe, das sich an die Nordseite der stattlichen Bastion, die 1603 begonnen und 1650 ganz vollendet war, schließt.
Huppet-Huhhot
Die im Jahre 1553 fertig gewordenen südlichen Werftbauten sind verschüttet, versandet; halsgefährlich ist für Fuhrwerk das, was man Weg zu nennen beliebt. Nur wenige Häuser mit ihren Spitzdächern, ihren düstern zerfallenen Treppengiebeln schauen über die Mauer. Auf derselben erhebt sich der Vorbau des "Zum Pützchen Hofes", der Sitz des "Huppet-Huhhot", eines Alt und Jung neckenden Kobolds, von dem man uns die erbaulichsten Schwänke erzählte, wie er die Mägde quälte, ihnen Pferdestaub in die Betten streute, Erbsen auf die Treppen, daß sie fielen, das Vieh im Stall losmachte, die Kühe ausmelkte, aber sich auch oft ganz gemüthlich an den Winterabenden mit seinem stolpernden Gange: hobedehop! hobedehop! seinem spitzen und langen Flachsbart und Spitzhut in ihrer Mitte am Heerde niederließ.
Einzelne aus Tuffstein in romanischem Style des 13. Jahrhunderts erbaute malerische Giebel überragen weiter nach Norden die Mauer, welche seit 1497 aus den Strafgeldern von Zinswuchern bis zum Filzengraben erhöht worden, oder verstecken sich hinter den hier längs der Stadtmauer aufgethürmten Holzstößen, den so genannten "Erken". Mit der Abnahme des Verkehrs hatte man die Mehrzahl der Thore dieser Mauer verschüttet oder vermauert.
Während der Zeit des dreißigjährigen Krieges arbeitete man emsigst an der Befestigung der Stadt. Ein Ingenieur aus Lüttich, Johann Galls, hatte 1682 nach eigenem Plane die Arbeiten begonnen, und waren demselben dafür, daß er jährlich, oder wenn es sonst nothig, zur Beaussichtigung heruberkam, 2500 Reichsthaler zuerkannt. Galls's Plan wurde für Köln nicht ganz ausgeführt, wohl aber in Deutz, das 1632 von den Kölnern in Gemeinschaft mit dem Kurfürsten durch vier ganze, und zwei halbe Bastionen befestigt wurde. Mit dem Bau des Bollwerls am Bayen riß man die so genannte "Art", den mit einem Wichhaus versehenen Bogen am Bayenthurme, nieder. Von 1631 bis 1692 verbrauchte man zu dem Bastionsbaue am Bayen 1,144,000 Stück Ziegel. Die Verzeichnisse der vor dem Severinsthore und am Bayen gebrannten Ziegel sind im Stadt-Archive aufbewahrt, mit genauer Angabe, wo dieselben verbraucht wurden.
Das Werthchen
Einer Düne gleich, an einzelnen Stellen von mageren Grasplätzen unterbrochen, die Bleichstätte des ganzen Stadtviertels, zieht sich die Insel, das so genannte "Werthchen" hin. Mephitische Dünste steigen im Sommer aus dem verschlammten Rheinarme der Stadtseite. Ein paar Schiffs-Oberdecke sind zu Residenzen der Bleichwärterinnen umgewandelt.
Rheinhalfen
Monoton klingt in seinem stets einförmigen Tacte der weitschallende Hammerschlag einiger Schiffbauern, die sich das Werthchen zum Werft erkoren, und in ihr Gehämmer mischt sich das langgezogene Ju! Ju! Ho! Ho! Hoho! der Rheinhalfen, mit diesem Rufe, derben Flüchen und noch derbern Peitschenhieben ein Rudel magerer, abgehetzter Pferde vor einem zu Berg schleichenden Schiffe auf dem Leinpfade antreibend.
An der Rheingasse ändert sich die Scene des Werftes. Der Schiffsverkehr gewinnt einige Rührigkeit. Hier liegen, wie es die Jahreszeit bringt, die hoch über Deck mit Stroh und Heu oder mit Lohe, den ein französischer Commissär in seinem Bericht für Zimmet ansah, beladenen kleinen Fahrzeuge, auf welche die schmalen, zwei- und dreistöckigen Häuser düster und trostlos herabsehen, vielleicht besserer Zeiten eingedenk. Aeußerst bescheiden, eine schlichte Bürgerwohnung mit ihren Spitzdächern, ihren einfachen grünen Jalousieladen und blendend weißen Gardinen, schaut der "heilige Geist", eines der ersten Gasthäuser der Stadt, das Absteige-Quartier der höchsten Herrschaften, aus seinen spiegelblanken, kleinen Scheiben hinüber nach dem öden, von der Rheinseite dorfähnlichen, traurig verfallenen Deutz.
Leistapel
Vom Rheinthor bis zur Hafengasse sind längs den Häusern Kohlenlager, Gerießhütten gebaut, mit den hier lagernden "Leien", woher der Name "Leistapel", oder Schieferplatten die größte Breite des Werftes einnehmend.
Schürger
Gruppen von Schürgern und Packträgern, welche den Facchini Italiens im dolce far niente und in der unverschämtesten Zudringlichkeit nichts nachgeben, dieselben in der Unverschämtheit ihrer Forderungen selbst überbieten, lungern, der Werfte Staffage, gewöhnlich am Leistapel umher. Sie haben sich jetzt zum Ufer gedrängt, denn eben treibt in voller Majestät ein schwimmendes Dorf, ein schönes, stolzes Rheinfloß, mit einigen Hundert Ruderern bemannt, vorbei; die Steuerleute winken von ihren erhabenen Steuerstühlen den vom Ufer Grüßenden mit Hutschwenken zu.
Eine Gesellschaft Männer, wenn auch an einem Werkeltag, in Floere Catunge (Manchester) Jacken und Hosen, schwere silberne Schnallen auf den Schuhen, aus stark mit Silber beschlagenen Ulmer-Köpfen dampfend, spielt ,Galöse hje".
Galöse hje: Ein mittelalterliches französisches Studentenspiel, nach dem Namen der Studenten der pariser Universität, die nicht in den Collegien der Universität, sondern in der Stadt wohnten, sie hießen "Galoches", wie man auch die Damen der Königin nannte, die nicht im Louvre ihre Wohnung hatten. - Das in französischer Zeit allbeliebte Spiel, brachten italienische und franzosische Regimenter nach Köln, und daher möchte ich den Namen von dem Italienischen "Galloceia", der Keil, herleiten.
Sie werfen mit einem Kronenthaler nach einem, in gewisser Entfernung aufgestellten Korkstöpsel, auf welchem so viele Fünffrankenthaler liegen, als die Gesellschaft Köpfe zählt. Der Werfende gewinnt das Geldstück, bei dem der Kronenthaler liegt, mit dem er geworfen hat. Derbe Witze, Flüche, und eben nicht feingewählte Glossen über die ab- und zugehenden Douaniers oder "Commis", wie der Kölner die Zollbeamten nannte, beleben das Spiel, reizen die Lachmusleln der Schürger und Fuhrleute, welche um die Spielenden einen Kreis gebildet haben.
Hexemächer
Wer sind die Spieler? "Hexemächer", so heißt die mit jedem Tage wachsende Zunft der Schmuggler. Das Schmuggeln wird systematisch betrieben, denn nicht unzugänglich der Bestechung sind die ersten, wie die geringsten Zollbeamten. Welcher Kaufmann schmuggelt nicht? Schmuggelhandel war das einträglichste Geschäft. Es bestehen sogar Schmuggel-Assecuranzen. In Deutz, Mülheim, Hittorf haben die kölner Kaufleute ihre Niederlagen der zollpflichtigen Waaren, und von dort werden die "Hexen" gemacht. Oft im Einverständnisse mit den Douaniers, die mit verstärkten Wachtposten einen Punct des Ufers besetzt halten, während die Hexemächer am entgegengesetzten über den Rhein gehen, oder, wenn vereinzelte Posten, lassen sich die Douaniers knebeln, als wenn sie der Uebermacht erlegen. Nicht selten ist das einträgliche Hexemächer-Handwerk aber auch gefährlich, wird eine Pascherei, die man auf eigene Faust machen will, verrathen, und die Posten mit fremden Zollbeamten besetzt. Dann geht es auf Leben und Tod; was der List nicht gelingt, sucht man durch Gewalt zu erreichen. Häufig finden Scharmützel zwischen Zollbeamten und Paschern bis in die Stadt hinein Statt, müssen Kellerlöcher, Gartenzäune und Vorhäuser die Ladungen der verfolgten Hexemächer aufnehmen.
Ein paar "Nihführer", so heißen die Rhein-Fuhrleute, zanken sich mit lautem Geschrei, weil einer dem andern eine Ladung weggeschnappt. Sonst knuppern aus Langweile die Rosinanten der hier aufgestellten Rihkarren oder Lastfuhren an dem in aller Gemüthlichkeit zwischen den mächtigen Basaltblöcken des Pflasters wuchernden Grase, oder machen die Brosamen ihrer Futtersäcke ganzen Flügen der unverschämtesten Spatzen, oder den hier ungestört ruckenden und girrenden Tauben streitig.
Krahnen
Durch den engen Durchgang an dem Bollwerke der Hafengasse gelangen wir aus dem Leistapel in den 1804 neuangelegten Freihafen. Zwei runde thurmähnlich massiv aus Stein aufgeführte Krahnen, der Hasengasser und der Mühlengasser, mit beweglichen Dächern, unterbrechen bis zur Mühlengassen-Bastion die Linie des neuen Werftes. Unbeholfen strecken sie ihre riesigen Schnäbel in die Luft; langsam dreht sich knarrend und stöhnend das große Gangrad, von Menschen, den so genannten "Eichhörnchen" getreten; laut schallt der Commandoruf der Kettenmänner, dazwischen die Gewicht- und Zeichen-Angaben der Wagenknechte: "Ae Kloverblatt N. 11, Ae Krutzge N. 12, en einfaeh Beerseheldehe, en duppel Beerscheldehe, e Ruttge met em Statzjen dran u.s.w. u.s.w.", damit die Wagenmeister das gelöschte Gut buchen können. Gibt es der Güter viele, ist auch noch ein kolossaler schwimmender Krahnen thätig, in seinem einfachen Mechanismus den steinernen gleich construirt, sind noch einige "Wippen" in Betrieb.
Fliegende Brücke / Markmannsgasse
Eben landet die fliegende Brücke an der Markmannsgasse, jetzt Friedrich-Wilhelm-Straße.
Im Jahre 1821, bei Anwesenheit Sr. Maj. unseres Königs Friedrich Wilhelm III. am 30. Juni, wo demselben auf der Börse auf dem Heumarkte der Ehrenwein credenzt wurde, gab man der bei dieser Gelegenheit auch an ihrem Eingange mit allegorischen Figuren versteckten Markmannsgasse den Namen: "Friedrich-Wilhelm-Straße". Man hatte 1824 ihre Erweiterung vollendet, die erste in der Stadt, die Thorveste abgebrochen und durch eine neue Pforte: "Friedrich-Wilhelm-Thor", ersetzt. - Die erste fliegende Bruͤ cke erhielt Köln 1674, während der Kriege mit Ludwig XIV., von Bonn, zum Uebersetzen der Truppen. Mit dem k. k. General-Feldzeugmeister, dem Prinzen Ludwig von Baden, traf die Stadt, ihrer Sicherheit wegen, das Uebereinkommen, daß die Brücke auf dem Rheine von kaiserlichen, am Ufer aber von Stadtsoldaten zu bewachen sei. Abends wurde die Brücke festgeschlossen, und die Schlüssel in der Stadt aufbewahrt. Die Brücke wurde 1678 wegen Kriegsgefahr abgetragen, aber 1680 wieder aufgefahren, und den Brückenbeerbten ihr Privilegium bestätigt, aber unter der Bedingung, daß in Zeiten der Gefahr die Fahrten wieder eingestellt werden mußten. Die Fahrten wurden 1710 wegen Aeccis-Streitigkeiten auf einige Zeit unterbrochen. Da die Brückenbeerbten sich 1791 eines Ungehorsams gegen die Stadt schuldig gemacht hatten, sah sich diese veranlaßt, das Privilegium von 1680 aufzubeben, das aber wieder genehmigt ward, als der Kurfürst drohte, die Brücke nach dem poller Kopfe zu verlegen, und dort eine neue Straße zu bauen.
Die Österreicher führten 1794, nach der Besitznahme der Stadt durch die Franzosen, die Brücke nach Deutz, wo das Eis sie fortriß. Die Volks-Repräsentanten ließen eine neue Brücke bauen zum Uebersetzen der Truppen, und diese wurde 1803 von der Stadt reclamirt. Der Kronprinz von Schweden ließ 1813 eine zweite, für den Marsch der alliirten Truppen aufgefahrene fliegende Brücke nach Düsseldorf führen. Im Jahre 1822 wurde die stehende Schiffbrücke gebaut.
Schmuggler
Mit Argus-Augen harren die Zoll-Aufseher an der Landbrücke, und, ihrer Argus-Augen zum Trotz, werden doch der verbotenen Früchte viele, besonders Kaffee und Zucker, für den Hausbedarf eingeschmuggelt, denn auch dem frömmsten, dem gewissenhaftesten Kölner ist Schmuggeln keine Sünde, und einen Kronenthaler, einen Thaler 16 Sgr. - ein Capital - kostet ein Pfund Kaffee oder Zucker. Fast bei jeder Fahrt, deren die Brücke täglich fünfzehn bis achtzehn von einem Ufer zum anderen schlelcht, bietet sich den Lungern und Gaffern, den Brücken-Passagieren das Schauspiel, die Zollbeamten einen Schmuggler aufgabeln zu sehen. Besonders fahnden sie auf die Frauenzimmer, die sich in das Zollhäuschen neben dem Thor bequemen müssen, wo Frauen zu ihrer Visitation angestellt sind.
Die raffinirteste Schmugglerklugheit, die selbst den Ulysses in der Schlauheit der Erfindung ihrer Mittel überbietet, und scheinbarer Diensteifer stehen hier stets in offenem Kampfe. Ein paar Schmuggler sind glücklich an der Cerberus-Höhle vorbei, rasch drängen sie sich durch das enge Markmannsgassen-Thor, auch eine gewaltige Thorveste, und eilen die vielleicht zehn Fuß breite, von vier- bis fünfstöckigen, rußigen Giebeln umdüsterte Markmannsgasse hinauf. So enge ist die Markmannsgasse, deren Hauptbewohner Gerber, daß ein, etwas über die Achse geladener Karren, nicht selten die an den Thüren aufgehängten Sohlleder-Häute, selbst die hölzernen Blenden der Fenster mitnimmt, Ursachen der erbaulichsten Schimpf-Intermezzi. So schauerlich düster ist diese Straße, daß im Winter in den meisten Häusern die Lampe nie ausgeht.
Unter dem lautesten Jubel der Umstehenden, die stets Partei für die Schmuggler nehmen, machen ein paar Douaniers Jagd auf einen Zollfrevler, der sein Heil in der Schnelligkeit seiner Füße sucht und gewöhnlich in dem Labyrinthe der Winkel und Gaßchen dieses Stadttheils glücklich entkommt.
Freihafen
Regeres Treiben herrscht im eigentlichen Freihafen, denn die Stadt hat noch das Stapelrecht, jetzt Umladerecht, aus der politischen Umwälzung gerettet, das sie seit den ältesten Zeiten beanspruchte, ihr aber erst Erzbischof Conrad von Hochstaden, der Gründer des Domes, 1269 urkundlich bestätigte.
Stapel
Köln hatte schon seit undenklichen Zeiten das "Stapelrecht" behauptet. Die mit ihren Waaren zu Berg und zu Thal kommenden Kaufleute mußten hier ausladen und sechs Wochen ihre Güter zum Verkauf ausbieten, durften aber nicht im Detail verkaufen. Daher die einzelnen Lager- oder Kaufhäuser: Eisenkaufhaus, Fischkaufhaus, Flachskaufhaus u.s.w. Urkundlich bestätigte Erzbischof Konrad von Hochstaden 1269 der Stadt das Stapelrecht. In der Urkunde heißt es, daß kein Schiff zu Thal weiter bis Riel am Thürmchen fahren dürfe, zu Berg nur bis Rodenkirchen. Jeder kölnische Bürger war berechtigt, den Uebertreter dieser Bestimmung zu fangen, ihn mit binsenen Stricen zu hansen (binden) und das Schiff nebst Gut als Prise zu behalten. Karl's IV. goldene Bulle bestätigte 1363 das Stapelrecht, Friedrich III. 1476 und Maximilian J. am 18. September 1605 wegen Verlustes des Rheinzolles. Das in Umladerecht umgestaltete Stapelrecht wurde 1830 aufgehoben, und die Stadt erhielt 1831 am 14. Juni dafür auf die ersten zwei Jahre einen Ersatz von 50,000 Thalern vom Staate zugesichert.
Speditionshandel
Speditionshandel, jetzt vom Schmuggelhandel en gros thätigst unterstützt, ist daher noch immer die Haupt-Nahrungsquelle der kölnischen Kaufleute. Mit wenigen Ausnahmen finden wir den eigentlichen Properhandel in den Händen der Protestanten, da diese vor der französischen Zeit keinen Speditionshandel treiben durften.
Zur Geschichte der Protestanten in Köln
Köln erfreute sich im fünfzehnten Jahrhundert des vollsten Genusses der Früchte seiner Blüthezeit. Angesehen, reich unter Deutschlands Städten, überstrahlte es dieselben alle durch seine fürstliche Baupracht, durch seinen äußeren Glanz. Schon damals hieß es: "Qui non vidit Coloniam, non vidit Germaniam!" und keine Uebertreibung war damals der Spruch: "Cöllen eyn Croyn, boven allen Steden schoyn!" Gaben die früheren Jahrhunderte der Stadt ihren kirchlichen Bauschmuck, wie ihn keine andere deutsche Stadt aufzuweisen hat, so ließ das fünfzehnte Jahrhundert es sich emsigst angelegen sein, auch öffentliche bürgerliche Bauten zu Nutz und Frommen, zur Freude und Ehre der Stadt und ihrer Bürger aufzuführen. In den Kirchenbauten that sich, neben dem werkthätigen Frommsinn, das geistliche Ansehen, die geistliche Macht kund, in den weltlichen Gebäuden der auf den Besitz gegrundete Bürgerstolz. Für den Kölner gab es keinen mächtigeren, stolzeren Titel, als der: "Bürger von Köln."
Schon im Jahre 1407 ließ die Stadt den bauherrlichen Bergfried, den Stadt-Wachtthurm oder Rathhausthurm erbauen. Ein mächtiger, stolzer Quaderbau, mit reichem Bildwerk, mit Standbildern und verzierten Kragsteinen geschmückt, an denen die heitere Laune der Steinmetzen die Schwänke des allbeliebten Till Eulenspiegel zum Ergötzen von Jung und Alt kunstfertig ausmeißelte. Mit einem Kostenaufwande von 60,000 Gulden wurde der stattliche Bau 1414 in seiner ganzen Pracht vollendet, wozu der Senat das Vermögen der wegen der Verschwörung Hilgers von der Stessen gegen die Freiheiten der Stadt, 1398 ihrer Aemter entsetzten Scheffen und der der Stadt verwiesenen Bürger benutzte. Nach der Vertreibung der Juden wurde die dem Stadthaus gegenüber liegende Synagoge in die Rathscapelle umgewandelt, mit ihrem zierlichen Dachreiter versehen, und in dieselbe das höchste Kleinod altdeutscher Malerkunst, das so genannte "Dombild" gestiftet. Im Jahre 1441 baute die Stadt dem "Brulofs-Haus" gegenüber, wo die Hochzeiten der reichen Bürger, eine Art Pickenick, bei dem jeder geladene Gast seine Schüssel zu stellen hatte, gefeiert wurden, das Tanzhaus "Gürzenich", auch der "Herren Haus" genannt, und verwandte zu diesem Baue nicht weniger, als 80,000 Gulden. Auf dem Tanzhaus feierte die Stadt ihre Feste, bewirthete sie Kaiser und Fürsten. Das Kornhaus, zugleich der Stadt Zeughaus, wurde auch 1441 aufgeführt. Die kostspieligen Uferbauten von Deutz bis Poll fallen in die Jahre 1479 und 1496, und die zeitweiligen Befestigungen von Deutz gehören auch diesem Jahrhunderte (1405, 1418 und 1474) an, wurden aber stets, sobald die Kriegsfahrniß vorüber, von den Kölnern selbst wieder zerstört, auf daß sie ihrer eigenen Freiheit nicht gefährlich wurden.
Fröhlich blühten, nicht bloße Dienerinnen der Baulunst, die schmückten nicht allein die Kirchen, sondern auch die Hallen der Stadt, die Wohnungen der Patricier und reicher Kaufherren. Auch im Aeußern gab man der allgemeinen Wohlhäbigkeit Ausdruck, trug den Reichthum in der Kunstpracht, der Bequemlichkeit der Häuser zur Schau, liebte das kostbare Schaugepränge der Werke der Kleinkünste. Jedes reichen Bürgers Sitz war, wie auch in den welschen Landen, mit Kunstwerken jeder Gattung ausgestattet, und man war stolz darauf, hierin selbst Fürsten und Herren zu überbieten.
Eifersüchtig auf ihre Unabhängigkeit, ihre Reichsunmittelbarkeit, sich stützend auf ihre Geldmacht, hatten die Kölner bisheran mit bewaffneter Hand ihre Rechte gegen jeden Feind zu wahren gewußt. Selbst ein Karl der Kühne war zu Schanden geworden an ihrem Muthe. Daß die Gemeinden mit eben so großer Eifersucht ihre innere Freiheit aufrecht zu halten suchten, den Bürgermeistern und dem Rathe scharf auf die Finger sahen, war natürlich. Es standen zu allen Zeiten die demokratischen Elemente in offenem Kampfe mit den aristokratischen, besonders in einer Gemeinde-Verfassung wie die Kölns.
Seit 1396 hatte sich die Gemeinde ihre demokratische Verfassung, ihre Magna Charta, den "Verbundbrief", errungen.
Die ganze Bürgerschaft war in 22 Zünfte oder Gaffeln getheilt. Jeder, welcher das Bürgerrecht beanspruchte, mußte sich bei einer Gaffel einschreiben lassen, d. h. Mitglied einer Zunft sein. Die Bürger wählten aus ihrer Mitte 36 ehrbare Männer als Rath oder Senat, und zu dessen Ergänzung, ohne Rücksichtsnahme auf die Zünfte, noch 18 Gebrechsherren. Der Rath oder Senat bestand demnach aus einem Collegium von 49 Mitgliedern. Es wurden gewählt
1) von dem Wollenamt, als Arsburg und Kriegmarkt, mit den Aemtern der Tuchscherer, Weißgerber und Tirteyer 4 Rathsherren;
2) von dem Isermarkt 2;
3) von dem Schwarzenhaus 2;
4) von den Goldschmieden und Goldschlägern 2;
5) von der Windecken 2;
6) von den Buntwärtern 2;
7) von dem Himmelreich 2;
8) von den Schilderern, mit den Aemtern der Wappensticker,
Sattelmacher und Glaswärter 2;
10) von den Steinmetzen, mit den Aemtern der Zimmerleute, Holzschneider, Kistenmacher, Leiendecker und Schleifer 1;
11) von den Schmie den 2;
12) von den Bäckern 1;
13) von den Brauern 2;
14) von den Gürtelmachern, sammt den Aemtern der Ledercoreider, Nadelmacher, Drechsler, Beutelmacher und Handschuhmacher 2;
15) von dem Fleischamt 1;
16) von dem Fischamt 2;
17) von den Schrödern 1;
18) von den Schuhmachern, mit den Aemtern der Lörer und Holschenmacher 1;
19) von den Sarwarteren, mit den Aemtern der Teschenmacher, Schwertfeger und Bartscherer 1;
20) von den Kannengießern, mit den Aemtern der Hamacher 1;
21) von den Faßbändern mit dem Weinamte 1;
22) von den Ziechenwebern, mit den Aemtern der Decklachweber und Leinenweber 1 Rathsherr.
Halbjaährig wurde die Hälfte des Senats neugewählt, so daß jeder Senator ein Jahr Sitz und Stimme hatte, doch konnte er erst nach zwei Jahren nach seinem Austritt wieder gewählt werden.
Der Senat wählte jedes Jahr zwei Bürgermeister oder Consulen, welche drei Jahre im Amte blieben, so daß stets sechs Bürgermeister im Amte waren. Zwei derselben hatten ein Jahr den Vorsitz im Senate, waren die Regierenden, deren Amtszeichen der Stab, welcher ihnen nachgetragen wurde, zwei standen ein Jahr der Freitags-Rentkammer vor, und zwei auf ein Jahr der Mittwochs-Rentkammer.
Ohne die Gaffel-Aempter oder Zünfte konnte der Magistrat keinen Beschluß von Wichtigleit fassen, und mußte denselben auch jährlich Rechnung ablegen. Jedes Ampt besaß einen Schlüssel zum Stadtsiegel.
Dem Senat oder ordentlichen Rath gegenüber bestand noch ein Aufsichtsrath desselben, die so genannten zweiundzwanzig "Bannerherren", welche als Mitvorsteher der Zünfte von diesen gewählt, dieselben dem Rathe gegenüber vertraten, Vermittler zwischen diesem und der Bürgerschaft waren, und den Namen "Bannerherren" daher führten, weil ihnen die Banner oder Wimpel der Zünfte anvertraut, und sie auch das Stadtbanner unter ihrer Aufsicht hatten, das nur bei feierlicher Gelegenheit ausgehängt wurde, und wenn man die gesammte Bürgerschaft unter die Waffen rief.
Was natürlicher, als daß bei einer solchen Verfassung, wo jeder Bürger die von ihm gewählte Obrigkeit glaubte beaufsichtigen zu müssen, es nie an Ursachen zur Unzufriedenheit fehlte, es nur eines Führers bedurfte, eines Mannes des Wortes auf einer der mächtigsten Zünfte, um diese Unzufriedenheit, den Argwohn zur Meuterei und Emporung werden zu lassen.
Der Argwohn der demokratischen Partei brach so 1481 in hellem Aufruhr aus. Wegen Herabsetzung des Münzwerthes, welchen der Senat für nothwendig erachtet, und weil dieser, als ihn die Zünfte zur Rechenschaft gesordert, nachgegeben, bildet sich in den Gaffeln ein neuer Rath. Die Rechnungen der Rentkammern werden geprüft, in Ordnung befunden, doch fehlen die Beläge. Mit der steigenden Unzufriedenheit steigern sich auch die Anforderungen der Unzufriedenen. Vergebens legt sich Erzbischof Hermann von Hessen, der Friedfertige (1480 - 1508), ins Mittel, er vermag den Streit nicht zu schlichten.
Mit bewaffneter Hand erzwingt sich die Masse im folgenden Jahre den Eintritt ins Rathhaus und nöthigt den Rath, einen Bürgermeister, einen Rentmeister und mehrere Mitglieder des Rathes ihrer Würden zu entsetzen und zu Thurm zu bringen, d. h. gefangen nehmen zu lassen. Man wählt einen neuen Bürgermeister und bietet Alles auf, die Empörer zufrieden zu stellen. Umsonst, sie gehen immer weiter in ihren Forderungen. Da fassen die Bürger, welche eine Umgestaltung der Verfassung befürchteten, allzu groses Uebergewicht der demokratischen Partei, den Entschluß, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, befreien mit Waffengewalt die zu Thurm gebrachten Rathsglieder und setzen sie wieder in ihre Aemter ein. Die Anführer der Unzufriedenen werden zur Haft gebracht, zum Schwerte verurtheilt, und vierzehn derselben auf dem Heumarkte hingerichtet. Unter ihnen wird ein Junkherr Werner von Lyskirchen genannt, ein Beweis, daß auch Manner aus den edlen Geschlechtern Kölns sich an dem Aufruhr betheiligten, daß derselbe nicht allein vom Pöbel ausging.
Mit Blut hatte man die demokratischen Regungen gegen die durch den Besitz der Gewalt immer aristokratischer auftretenden Gewalthaber zum Schweigen gebracht, aber den glimmenden Funken der Unzufriedenheit nicht erstickt.
Es bedurfte nur der geringsten Veranlassung, denselben zu hellen Flammen anzufachen. Und diese fand sich schon 1613, als die Steinmetzen am 21. December wegen der Wahl eines Amtsmeisters ihrer Zunft unter sich in Streit geriethen, ihre Oberen beim Rath verklagten, und dieser seine Befugniß in so weit überschritt, daß er in der Nacht vom 26. auf den 27. einige der Wortführer der Steinmetzzunft in ihren Häusern aufheben und zu Thurm bringen ließ. Sämmtliche Steinmetzen, ein ähnliches Geschick fürchtend, suchten jetzt Schutz in der Immunität, d. h. der Freistätte von St.-Marien auf dem Capitol, wo ihre Weiber und Kinder sie mit Speise und Trank und zugleich mit Waffen versorgten.
Der Rath sandte Abends 9 Uhr die Gewaltrichter, d. h. die mit der Handhabung der Policei beauftragten Beamten, mit einem Haufen Stadtsöldner in Begleitung einiger Rathsmitglieder nach der Immunität, um die Steinmetzen zu verjagen und, wo moglich, aufzuheben. Es kam zum Kampf, Bürgerblut floß. Lange vertheidigten die Steinmetzen hartnackig ihre Stellung, schlugen mehrere Angriffe zuruck, wobei dem Rathsherrn Diedrich Spitz ein Bein zerschmettert und einem anderen Rathsherrn Nase und Augen weggeschossen wurden. Endlich mußten die Steinmetzen den wiederholten Angriffen der Söldner weichen. Sie suchten ihr Heil in der Flucht, bargen sich, wo und wie sie nur konnten. Zwei Steinmetzen waren verwundet und gefangen, entkamen aber in der Verwirrung.
Als am folgenden Tage die Stadtthore geöffnet worden, verließen viele der Steinmetzen die Stadt. Fünf wurden vom Rathe gefänglich eingezogen. An demselben Tage belegte die Aebtissin des adeligen Fräulein-Stiftes in St.Marien auf dem Capitol die Immunität mit dem Kirchen-Interdicte. Diese Kunde erbitterte die Freunde und Anhänger der Steinmetzen aufs äußerste; Zimmerleute, Dachdecker und Studenten rotteten sich mit den in Köln gebliebenen Steinmetzen zusammen, um die Gefangenen zu befreien und die Geflohenen wieder in die Stadt zu führen.
Der Rath blieb standhaft. Er suchte die Gemeinde dahin zu bringen, ihre Zustimmung zur Hinrichtung der Gefangenen zu geben, um so durch dies blutige Beispiel die Aufrührer zu schrecken. Die Zünfte sind unentschlossen. Als der Rath am 30. December das Maler- und Goldschmiedamt zusammen beruft, erklären diese jedoch entschieden, sie würden sich streng am "Verbundbrief" halten. Am folgenden Tage forderte das Wollenamt den Rath auf, Rechnung abzulegen und sich vor der Bürgerschaft wegen Verletzung der persönlichen Freiheit mehrerer Bürger zu rechtfertigen. Der Rath läßt sich nicht einschüchtern, vielmehr auf den 3. Januar 1514 eine Versammlung aller Zünfte ansagen. Die Rathsboten werden aber bei allen Gaffeln abgewiesen, auf dem Wollenamte verhöhnt und mit dem Bemerken heimgeschickt, der Rath möge sich erst selbst verantworten.
Die Bürger sind auf ihren Zunfthäusern versammelt, allenthalben lautes Murren und Verlangen, die Gefangenen befreit und die Verfolgten wieder in die Stadt aufgenommen zu sehen. Da der Rath auf das ausdrückliche Begehr des Wollenamtes keinen Bescheid gibt, tritt dasselbe mit der Faßbinderzunft zusammen, vertreibt alle, die je im Rath gewesen, oder noch in demselben saßen, von ihren Zunfthäusern, und versprechen einander eidlich, fest zusammen zu halten, im Leben und Tode, bis der Senat ihrem Willen und Begehr Genüge gethan. Bewaffnet ziehen sie bei einbrechender Nacht durch die Stadt, verwüsten das Haus des Rathsherrn Diedrich Spitz und seinen Weingarten, dessen Holz auf beiden Zunfthäusern verbrannt wird.
Jetzt machten alle Zünfte mit genannten Aemtern gemeinschaftliche Sache.
Sie besetzen und schließen die Thore, pluündern das Zeughaus, stellen Schmiede und Studenten zur Bedienuug der Geschütze und ziehen mit denselben vor das Rathhaus, nachdem sie die beiden Burggräven der Thore von St. Severin und von St. Cunibert noch gezwungen, ihnen diese auch zu öffnen und zu übergeben.
Der in so drohender Stellung die Freilassung der Gefangenen verlangenden Menge konnte der Rath nicht länger Widerstand leisten. Die Gefangenen wurden frei gegeben, im Triumphe nach den Stadtthoren geführt. Die Geflohenen durften heimkehren; der Rath verspricht jede gewünschte Genugthuung.
Am 6. Januar bildet sich auf dem Quattermarkt ein neuer Rath, zu dem jede Zunft sechs oder acht Mitglieder sandte, nachdem das Wollenamt die übrigen aufgefordert hatte, zu erklären, ob sie für die Freiheiten der Stadt einstehen wollten, und alle erklärt, mit Gut und Blut die Freiheiten der Gemeinde zu vertheidigen.
Der auf dem Quattermarkt von den Bürgern gebildete neue Rath sendet Abgeordnete an den alten Rath, um denselben von den Beschlüssen der Bürgerschaft in Kenntniß zu setzen. Während dessen ziehen bewaffnete Scharen der Bürger heran, besehen den Paradeplatz, so hieß der Rathhausplatz, den Altenmarkt, Heumarkkt, Oben-Mauern und den Domhof. Aller Orten dieselbe Aufregung gegen den Rath, aller Orten ertönt der Rache Ruf, blutige Sühne verlangend. Wuthentbrannt stürmt die bewaffnete Menge gegen das Rathhaus, wiederholt donnern die Schläge der Morgensterne und Kolben gegen die Thüren, sie widerstehen, doch reizt ihr Widerstand die Wüthenden nur immer mehr.
Da erschallt das Rathhausglöcklein, die Trommeln wirbeln durch die von den Bürgern besetzten Straßen. Die Zunftherren erscheinen auf der Galerie des Stadthauses am Altenmarkt mit der Erklärung, der Rath willige unbedingt in die Wünsche und Forderungen der Gemeinden. Mit unsaglichem Jubel wird diese Erklärung aufgenommen, wildes Freudengeschrei und Waffengeklirr tönt vom Markte nach dem Rathhausplatze, und da zufällig in einer Kirche Sturm geläutet wird, glauben die hier aufgestellten Bürger sich verrathen. Sie senden Haufen nach allen Richtungen. Der blinde Schreck die Verwirrung verbreitet sich durch die das Rathhaus umgränzenden Straßen, steigt aufs höchste, als es auf einmal von mehreren Kirchen stürmt.
Mit verdoppelter Anstrengung werden die Angriffe gegen das Rathhaus wiederholt, wilder wird das Rachegebrüll. Man überhört lange die Mahnungen der Zunftherren, die von der Laube des Rathhauses die tobende Menge zu beschwichtigen suchen. Endlich gelingt es ihnen, die Wüthenden zu beruhigen, aufzuklären, und der Racheruf verwandelt sich bald in Jubelgeschrei. Die Bürger wurden aufgefordert, sich auf ihren Zunfthäusern zu versammeln, und ziehen froh des erlangten Zugeständnisses mit klingendem Spiele ab.