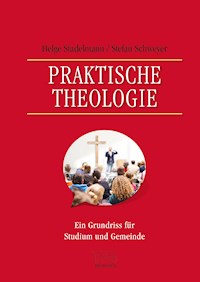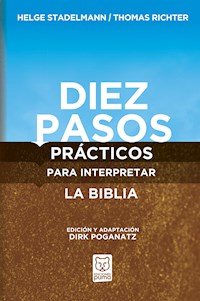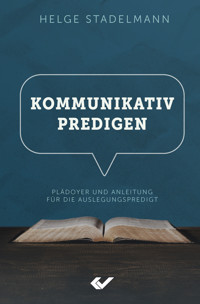
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Christliche Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Kommunikativ predigen erscheint seit 2013 unter diesem Titel und ist der erweiterte Nachfolgeband der Klassiker Schriftgemäß predigen und Evangelikale Predigtlehre. Die jeweils in mehreren Auflagen erschienenen Bände haben im deutschsprachigen Raum eine Form der Auslegungspredigt bekannt gemacht, die zugleich text- und hörernah ist. In einem von Medien geprägten Zeitalter muss Predigen kommunikativ sein, ohne zu bloßer Unterhaltung zu verkommen. Predigt hat den Anspruch und die Verheißung, Verkündigung des Wortes Gottes zu sein. Diesem Anspruch wird sie dann gerecht, wenn sie nah am biblischen Text bleibt und die Schätze der Bibel für postmoderne Menschen hebt. Integrative Gottesdienste, in denen so gepredigt wird, haben Anziehungskraft. Denn Gott baut seine Gemeinde durch sein Wort.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HELGE STADELMANN
KOMMUNIKATIV PREDIGEN
PLÄDOYER UND ANLEITUNG FÜR DIE AUSLEGUNGSPREDIGT
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Helge Stadelmann
Kommunikativ predigen
Plädoyer und Anleitung für die Auslegungspredigt
Best.-Nr. 275502 (E-Book)
ISBN 978-3-98963-502-9 (E-Book)
Es wurde folgende Bibelübersetzung verwendet:
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 by SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH Witten/Holzgerlingen.
Außerdem wurde verwendet:
Lutherbibel Standardausgabe © 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1. Auflage (E-Book)
© 2025 Christliche Verlagsgesellschaft mbH
Am Güterbahnhof 26 | 35683 Dillenburg
Satz und Umschlaggestaltung: Christliche Verlagsgesellschaft mbH
Umschlagmotiv: © freepik.com/benzoix; © freepik.com/daniel-007
Wenn Sie Rechtschreib- oder Zeichensetzungsfehler entdeckt haben, können Sie uns gern kontaktieren: [email protected]
Aber die summa soll sein, daß gewiß alles geschehe, damit das Wort recht in Übung kommt und nicht wieder ein Plärren und Lärmen daraus werde, wie es bisher gewesen ist. Es ist alles besser unterlassen als das Wort, und es ist nichts besser getrieben als das Wort.
Martin Luther
Der ernste Beruf des Predigers fordert alles und das Allerbeste, was ein Mensch geben kann.
Charles Haddon Spurgeon
Wer heute, gegen den Strom, jenen Ort aufsucht, da man das alte Buch aufschlägt, dem darf man etwas zumuten. Der Kirchgänger ist anspruchsvoll. Er erwartet […] „lebensnahe“, das heißt dem Osterleben nahe Auslegungspredigt mit klarem, christlichem Lehrgehalt.
Walter Lüthi
Den Pastoren,die nie aufhören, ihr Predigen zu verbessern.Den Theologiestudenten, Seminaristen und Bibelschülern, die unermüdlich ihr Talent entfalten, um gute Prediger zu werden. Den Laien, die treu Gottes Wort verkündigen.
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
1.WAS DIE AUSLEGUNGSPREDIGT IST – UND WAS SIE NICHT IST
1.1Herausforderungen für eine evangelikale Predigtlehre
1.1.1Probleme und Chancen der Predigt heute
1.1.2Tendenzen der neueren Predigtlehre
1.2Biblische Grundlagen für den Predigtdienst
1.2.1Der biblische Predigtauftrag
1.2.2Die Berufung des Predigers
1.2.3Die Begabung des Predigers
1.3Wesen und Formen der Auslegungspredigt
1.3.1Predigt als Entfaltung einer biblischen Aussage
1.3.2Predigt als Ergebnis genauer Textauslegung
1.3.3Predigt als Herausforderung von Prediger und Gemeinde
1.3.4Möglichkeiten der Auslegungspredigt
1.3.5Besondere Formen der Verkündigung
2.DIE ERARBEITUNG DER PREDIGT ZWISCHEN TEXT UND HÖRER
2.1Hermeneutische Grundentscheidungen
2.1.1Die Entwicklung weg vom Bibeltext als Verstehensnorm
2.1.2Thesen zu einer evangelikalen Hermeneutik
2.1.3Die Notwendigkeit gründlicher Bibelauslegung
2.2Die Wahl des Predigttextes
2.2.1Der „ganze Ratschluss Gottes“
2.2.2Die Predigtplanung
2.2.3Die Abgrenzung von Predigttexten
2.3Texterarbeitung und Textfokussierung
2.3.1Die Texterarbeitung
2.3.2Die Textfokussierung
2.4Die Predigtmeditation
2.4.1Vorüberlegungen
2.4.2Die Reflexion
2.4.3Die Konzeption
2.4.4Ein Modell: Die „Predigtwoche“
3.DIE PRAXIS DER AUSLEGUNGSPREDIGT
3.1Die Bausteine der Predigt
3.1.1Die „Predigtkrawatte“
3.1.2Die Einleitung
3.1.3Die Erklärung des Textsinnes
3.1.4Die Veranschaulichungen
3.1.5Die Anwendungen
3.1.6Die Übergänge
3.1.7Der Schluss
3.2Die Gestaltung des Predigtkonzepts
3.2.1Das Predigtmanuskript
3.2.2Das Stichwortkonzept
3.2.3Die Visualisierung des Predigtentwurfs
3.3Die Kunst der Rede (Rhetorik)
3.3.1Der Streit um die Rhetorik
3.3.2Elemente der Kommunikation
3.3.3Des Redners Angst und Emotionen
3.3.4Rednerpult und Kanzel
3.3.5Sprechtechnik (hör-orientierte Rhetorik)
3.3.6Körpersprache (seh-orientierte Rhetorik)
4.PREDIGT UND GOTTESDIENSTGESTALTUNG
4.1Predigt und Gottesdienst – Aspekte einer Problemgeschichte
4.1.1Streiflichter aus der Liturgiegeschichte
4.1.2Anmerkungen zur evangelikalen Situation
4.2Predigt und Gottesdienst – Hinweise zur Gestaltung
4.2.1Maßstäbe zur Gottesdienstgestaltung
4.2.2Planung eines Gottesdienstentwurfs
5.AKTUELLE ENTWICKLUNGEN ALS HERAUSFORDERUNG FÜR DIE KOMMUNIKATIVE AUSLEGUNGSPREDIGT
5.1Herausforderungen durch die Entkirchlichung der Gesellschaft
5.1.1Kirchenmitgliedschaft und distanziertes Teilnahmeverhalten
5.1.2Selbstsäkularisierung der Kirche als Problembeschleunigung
5.1.3Gastfreundliche Gottesdienste und Kommunikation des biblischen Wortes
5.2Herausforderungen durch die Mediengesellschaft
5.2.1Die Vielfalt der Medien und das Evangelium
5.2.2Dramaturgie auf Kosten des Schriftbezugs der Predigt?
5.2.3Lernen für kommunikatives Predigen
ANHÄNGE:BEISPIELE FÜR GOTTESDIENSTORDNUNGEN
Anh. 1Der Wort-Gottesdienst (Muster)
Anh. 2Der Abendmahls-Gottesdienst (Muster)
Anh. 3Der landeskirchliche Gottesdienst (Evang. Gottesdienstbesuch)
Anh. 4Der freikirchliche Gottesdienst (Nösser/Reglin)
Anh. 5Der Gottesdienst einer landeskirchlichen Gemeinschaft (Meiß)
Anh. 6Die gemeindliche Trauung (Muster)
Anh. 7Die Trauerfeier und Beerdigung (Muster)
Personen- und Autorenregister
Bibelstellenregister
VORWORT
Dieses Buch will zur kommunikativen Auslegungspredigt aufrufen und anleiten. Auslegungspredigt setzt im Dienst der Verkündigung die erhebliche Hochachtung praktisch um, die Evangelikale der Bibel als Gottes Wort entgegenbringen. Bibeltreue und Liebe zur Schrift dürfen nicht nur schöne Theorie bleiben. Als kommunikative Auslegungspredigt gibt sie sich zugleich erhebliche Liebesmühe für die Hörer. Solche Predigt, die aus dem Wort Gottes schöpft, baut die Gemeinde auf. Die Mühe dafür lohnt sich. Denn Predigt ist das Herzstück ausdrucksstark gestalteter Gottesdienste. Und durch sein Wort schenkt Gott Glauben und baut seine Gemeinde.
Dieses Buch, das zu einer Predigtpraxis anleiten will, die nah bei der Bibel und nah bei den Menschen bleibt, ist inzwischen ein Klassiker. 1990 erstmals erschienen, ist es seither in zehn Auflagen sukzessive aktualisiert und erweitert worden. In der vorliegenden Neuauflage erscheint das Buch nun in Hardcover-Version bei der Christlichen Verlagsgesellschaft.
Auch für die Neuauflage wünsche ich mir eine breite Leserschaft. Ein früher Rezensent (Heinz Schäfer) hat die beabsichtigte Leserschaft zutreffend beschrieben: „Das ist für alle, die in der Wortverkündigung stehen, ein wichtiges Buch: für Anfänger ein hilfreiches Kompendium, das Predigen zu lernen, soweit es überhaupt lernbar ist; für Leute, die mit dem Kanzelholz schon vertraut sind, eine ausgezeichnete Checkliste, die eigene Verkündigung wieder einmal unter die Lupe zu nehmen …“. Dieses Buch richtet sich nicht nur an Theologen, sondern an jeden, der das Wort Gottes gründlich, verständlich und motivierend predigen will.
Das Buch bemüht sich um eine einfache Sprache. Innerhalb des Buches sind Abschnitte, die eher den Charakter von Fachdiskussionen tragen, in Kleindruck mit anderer Schriftart gesetzt. Der Leser, der sich für diese Abschnitte nicht interessiert, kann sie überspringen, ohne dass ihm dadurch der Zusammenhang verloren geht. Zur Schreibweise: Das „ss“ wird entsprechend der neuen Rechtschreibung auch in Zitaten verwendet.
Möge dieses Buch dazu beitragen, dass eine wachsende Zahl von Gemeinden das erhält, was allein ihnen festen Grund und gesundes Wachstum geben kann: das Wort Gottes. Weniger wird der Gemeinde nicht das geben, was sie braucht.
Pohlheim, im Sommer 2024
Helge Stadelmann
1.WAS DIE AUSLEGUNGSPREDIGT IST – UND WAS SIE NICHT IST
1.1Herausforderungen für eine evangelikale Predigtlehre
1.1.1Probleme und Chancen der Predigt heute
Martyn Lloyd-Jones, einer der größten Prediger des 20. Jahrhunderts, schrieb vor einigen Jahren: „Für mich ist die Arbeit des Predigens die höchste und größte und herrlichste Berufung, zu der jemand überhaupt berufen werden kann!“1 Aus solchen Worten spricht Predigtfreude und Predigtüberzeugung. Und diese Freude muss ansteckend gewirkt haben. Als ich vor einigen Jahren die Predigtstätte von Lloyd-Jones, die Westminster Chapel in London, besuchte, fand ich dort begeisterte Predigthörer vor, für die die Predigten des Wochenendes das Zentralereignis der Woche waren. Und das, obwohl Lloyd-Jones (gestorben 1981), der von seiner Ausbildung her Arzt und nicht Theologe war, vor seinen 1000 bis 2000 Zuhörern jeweils runde 45 Minuten sprach und drei Predigten pro Woche hielt: freitags eine gründliche lehrmäßige Bibelarbeit, sonntagmorgens eine praktisch-erbauliche Predigt und sonntagabends eine evangelistische Ansprache.2
1.1.1.1Die Predigtnot heute
Für die Predigtsituation in unserem Land dürften Nachrichten dieser Art allerdings kaum typisch sein. Auch wenn nach wie vor jeden Sonntag mehr als eine Million Menschen an einem evangelischen Gottesdienst teilnehmen, ist doch zu sehen, dass der Gottesdienstbesuch an den Zählsonntagen – einschließlich Kindergottesdienste – tatsächlich nur zwischen durchschnittlich 3,9 Prozent (Sonntag Invokavit) und 8,0 Prozent (Erntedankfest) der Kirchenmitglieder liegt. Durch Massenmedien wie das Fernsehen, das mit hoch entwickelten Kommunikationstechniken arbeitet, hat die Predigt in ihrer jahrhundertealten Monologform Konkurrenz bekommen. Manche meinen, in einer von Bildern und abwechslungsreichen Kurzprogrammen geprägten Zeit habe sich die Predigt als Mittel der Verkündigung überlebt.
In der Tat ist die Art der Predigten, die man zu hören bekommt, oft nicht dazu angetan, solche Bedenken zu zerstreuen. U. Parzany berichtet: „In einer Kirche schrieb vor einiger Zeit ein Gottesdienstbesucher mit Kugelschreiber an die Wand: ‚Hier starb ich vor Langeweile.‘ Der Küster muss wohl Mitgefühl gehabt haben. Er ließ diese Feststellung eines kirchlichen Todesfalles zwei Wochen lang an der Wand stehen.“3 Und in einem Gemeindeblatt4 wird gar folgende Statistik eines Predigtmisserfolgs dokumentiert: Laut Umfrage konnten von 100 Kirchenbesuchern nach Schluss des Gottesdienstes nur vier inhaltlich präzise wiedergeben, was in der Predigt gesagt worden war; 28 hatten das Gesagte noch oberflächlich im Gedächtnis, 32 hatten die Ausführungen falsch verstanden und 36 wussten gar nichts zu sagen. Welcher Prediger könnte sich mit solchen, vielleicht nicht einmal so ungewöhnlichen Resultaten zufriedengeben?
Wenn Predigten nicht gelingen und keine Wirkung erzielen, kann das an der Predigt liegen, am Prediger oder am Predigthörer. Predigten können nach Form und Inhalt missraten. Es ist wichtig, dass die Predigt in Aufbau, Darbietung und Länge aus Liebe zum Hörer so gestaltet wird, dass dieser gut und gern folgen kann. Gerade in einem Zeitalter effektiver Massenkommunikation sollten Predigten nicht ausgerechnet durch lieblos langweilende Darbietungsformen auffallen. Und doch scheint mir, dass die eigentliche Predigtnot heute nicht im Formalen begründet liegt. Würde überall in Predigten das Wort Gottes „unter Beweisung des Geistes und der Kraft“ (1Kor 2,4) ausgelegt und prophetisch auf das Leben der Hörer bezogen, würden gewiss manche Mängel in der Form verziehen. Die Apostel – Fischer von Beruf – hatten keinen Kurs in griechischer Rhetorik besucht, aber sie sagten das Wort Gottes „mit freimütiger Gewissheit“ und „mit großer Kraft“ (Apg 4,31.33).
Eine Ursache für die Predigtnot unserer Tage ist zweifellos, dass viele Prediger aufgrund ihrer theologischen Ausbildung geistlich verarmt und verunsichert sind. Auf diesen Zusammenhang hat K. H. Michel zu Recht hingewiesen:
Die Predigtnot unserer Tage resultiert, so möchte ich behaupten, auch aus einer theologischen Not: aus einer theologischen Verarmung. Die Konkretheit, Lebensnähe und Fülle biblischen Redens ist der Theologie in erschreckendem Maß verloren gegangen.5
Schon in den 1960er-Jahren hatte Rudolf Bohren, Professor für Praktische Theologie, diese Krisenwirkung einer kritischen Theologie auf die Praxis der Predigt festgestellt. Er schrieb:
Gegenüber dem Pathos, mit dem die historisch-kritische Methode geübt und die Theologie als Hermeneutik betrieben wird, erschüttert die Lahmheit angesichts der Predigt: war man kühn im Aufstellen exegetischer Hypothesen, so gibt man sich jetzt wohltemperiert kirchlich, bleibt merkwürdig fern aller Modernität, verharrt ängstlich in müder Richtigkeit und kultiviert einen säuerlichen Hang zur Gesetzlichkeit. Damit stellt sich die Frage, woher es komme, dass die junge Generation zwar eine Leidenschaft hat für exegetische Fragen, dass aber diese Leidenschaft nicht bis zur Predigt durchhält. Vielfach ist es gerade der intelligente Student, der im Seminar als Neurotiker ankommt.6
Und dann stellt Bohren die Diagnose für jene von der Theologie Rudolf Bultmanns geprägte Zeit:
Das Unglück sehe ich nun darin, dass die historisch-kritische Methode den Prediger mit dem Text ungut allein lässt und von ihm im Grunde ein Mirakel verlangt. Nachdem er den Text historischkritisch beerdigt hat, soll er ihn existenzial wieder auferwecken. Kein Wunder, wenn der Prediger hier verzweifelt und in vielen Fällen entweder das Predigen oder die Methode lässt.7
Was Rudolf Bohren als Theologieprofessor für den Bereich der Universität bemerkt, wird von Pfarrer Parzany für die kirchliche Praxis bestätigt:
Ich meine, die Predigtnot hat eine […] Wurzel in dem gebrochenen Verhältnis vieler Prediger zur Bibel. Die Bibelkritik, die jeder Theologe in seinem Studium gelernt hat, verunsichert. Da muss er nun mit Legenden und mit angeblichen Worten Jesu zurechtkommen, von denen er gehört hat, dass sie gar nicht historisch echt, sondern Bildungen der Gemeinde sind. Da liest er in den Kommentaren zur Bibel die gegensätzlichsten Theorien über Quellen, aus denen der Bibeltext entstanden ist. Wer will sich da noch hinstellen und sagen: „So spricht der Herr“?8
Nun wäre es allerdings falsch, in der modernen Theologie die alleinige Ursache für alle Predigtnöte zu suchen. Denn Predigtkrisen gibt es schließlich auch in evangelikalen Kreisen. Es lässt sich beobachten, dass durchaus „orthodoxe“ Prediger in konservativen Gemeinden formvollendete Kanzelreden halten – die dennoch ohne Wirkung bleiben. Warum? Die Ursachen der Not sehe ich im Predigtansatz, in der Person des Predigers, in der geistlichen Situation der Gemeinde oder in einer Kombination dieser Faktoren.
Zum Predigtansatz: Man bekennt sich theoretisch zwar zur Bibel, tatsächlich aber benutzt man das Bibelwort nur als „Aufhänger“ für seine Ausführungen und bringt in der Predigt statt der Auslegung des Wortes Gottes geistreiche und erbauliche eigene Gedanken. Andere bieten tiefschürfende Texterklärungen, geben sich aber nicht die Liebesmühe, das biblische Wort anschaulich, dynamisch und lebensnah zu kommunizieren. Wir werden auf diese Problematiken noch ausführlicher eingehen (Abschnitte 1.3.1 bis 1.3.3).
Aber auch Probleme in der Person des Predigers wiegen schwer. So kann die Predigtkrise einer Gemeinde darin begründet liegen, dass der Prediger – weil nicht von Gott zu diesem Dienst berufen – schlichtweg die nötige Begabung zum Predigen vermissen lässt (vgl. Abschnitte 1.2.2 und 1.2.3). Ebenso könnte es sein, dass der Prediger sich zwar mit den Lippen zu biblischer Rechtgläubigkeit bekennt – und dies vielleicht sogar in sehr beredter Weise –, dass er aber mit dem Leben dem widerspricht, was er sagt. Vollmachtlose Predigt ist das Resultat. Denn das lebendige Reden Gottes zu den Hörern ist dem Prediger nicht verfügbar, auch wenn er das Wort Gottes formal richtig auslegt. Gott kann ihm sozusagen „das Wort“ entziehen. Wer das verkündigte Wort nicht zuerst für sich selbst gelten lässt, macht sich und seine Botschaft unglaubwürdig und riskiert als Gericht das Schweigen Gottes.
Die Forderung nach einem der biblischen Verkündigung entsprechenden Lebenswandel des Verkündigers hat nichts mit billiger Werkgerechtigkeit zu tun. Sie ergibt sich vielmehr aus dem biblischpaulinischen Anliegen, „nicht anderen zu predigen und selbst verwerflich zu werden“ (1Kor 9,27). Wenn heute gelegentlich im Namen einer „reformatorischen Gesinnung“ gefordert wird, dass Lebensführung und Predigtamt des Pfarrers getrennt zu betrachten seien, erhebt sich die Gefahr, dass aus dem teuren ein billiges Evangelium gemacht wird. Übersehen wird dann, dass schon Jesus nicht den Worten, sondern den „Früchten“ der Propheten entscheidende Bedeutung zugemessen hat (Mt 7,15-20), dass es für Paulus einen untrennbaren Zusammenhang von Rechtfertigung und Heiligung gibt (Röm 3–8) und dass der Zusammenhang von Glauben und Werken (Jak 2,14ff.) – auch für evangelische Christen! – nicht ohne Schaden aus dem Neuen Testament wegdiskutiert werden kann.
Der moderne Praktische Theologe Dietrich Stollberg sieht das allerdings anders. Er beschäftigt sich mit dem Fall eines evangelischen Pfarrers, der wegen wiederholten Ehebruchs mit verschiedenen Frauen seiner Gemeinde von der Disziplinarkammer seiner Kirchenleitung vom Dienst beurlaubt wurde, weil seine ehebrecherischen Verhältnisse im Widerspruch zu seinem Verkündigungsauftrag stünden. Dieses Urteil ist in den Augen Stollbergs „massive theologische Irrlehre“9, und er stellt die Gegenthese auf:
1. ist es der Normalfall, dass der Pfarrer predigt, was er selbst durch seine Existenz nur bruchstückhaft abzudecken vermag, 2. kommt das daher, dass er nicht das Gesetz, sondern das Evangelium zu predigen hat, welches eben die Unfähigkeit aller Glieder der Gemeinde voraussetzt, dem Gesetz zu entsprechen, 3. predigt deshalb der Pfarrer stets auch sich selbst. Eine Kirche, die meint, das Gesetz predigen zu müssen und dieser Predigt auch noch durch ein den Geboten entsprechendes Leben der Heiligung ihrer Glieder Glaubwürdigkeit verschaffen will, frönt der Grundsünde der Werkgerechtigkeit.10
Hier ist das Evangelium zur billigen Gnade und zur Rechtfertigung der Sünde (statt des Sünders) verflacht. Unbußfertigkeit provoziert im Neuen Testament Gemeindezucht, nicht aber den zudeckenden Trost eines psychologisierten Evangeliumsverschnitts. Nicht die Unvollkommenheit, wohl aber die Unbußfertigkeit und ein vorsätzliches und fortgesetztes In-der-Sünde-Leben, das dokumentiert, dass der Prediger die Autorität des Wortes Gottes für sich selbst nicht ernst nimmt, raubt dem Verkündiger die Vollmacht. Sein Leben redet dann so laut, dass die Gemeinde nicht mehr hört, was er von der Bibel her sagt. So gilt immer noch das paulinische „achte auf dich selbst und auf die Lehre!“ (1Tim 4,16).
Diese Wahrheit von der Notwendigkeit eines gehorsamen Lebens des Verkündigers gilt genauso wie die andere Wahrheit, dass das biblische Wort auch abgesehen vom Verkündiger Gottes Wort ist und bleibt, durch das Gott nach seinem Wohlgefallen wirkt. Insofern hat Luther recht, wenn er schreibt:
Wer dem Wort glaubt, der achtet nicht auf die Person, die das Wort sagt, und ehret auch nicht das Wort um der Person willen; sondern das Gegenteil, die Person ehret er um des Wortes willen, stellt die Person immer unter das Wort. Und ob die Person unterginge oder gleich vom Glauben abfiele und anders predigte, so lässt er eher die Person als das Wort fahren, bleibt bei dem, was er gehört hat. Es sei die Person, es komme die Person, es gehe die Person, wie und wann es mag und will.11
Beide genannten Wahrheiten ergänzen sich dialektisch und keine darf um der anderen willen aufgegeben werden.
Predigtkrisen können aber nicht nur im Prediger und seinem Predigtansatz begründet liegen, sondern auch in der Hörerschaft. Es kann geschehen, dass der Prediger als treuer Bote Gottes die Schrift auslegt – und trotzdem Predigt um Predigt scheinbar wie eine Seifenblase zerplatzt. Die beste Predigt verpufft im Raum, wenn sie auf taube Ohren stößt. Wo der Verkündiger vor einer Gemeinde steht, deren Ohren und Gewissen gegen geistliche Wahrheiten bereits abgehärtet sind, die aus Gewohnheit zum Gottesdienst kommt und die Predigt mehr oder weniger teilnahmslos über sich ergehen lässt, kann schon der Eindruck entstehen, er predige gegen eine Wand. Wo unbereinigte Sünde – etwa Uneinigkeit in der Gemeinde – das Hören auf Gottes Wort verhindert, wo man gehetzt zum Gottesdienst kommt und in Gedanken bereits bei anderen Aktivitäten ist, wird die Predigt kaum fruchten. Auch in diesen Fällen haben wir es mit einer Predigtnot zu tun. Der Predigt fehlt die Resonanz im Hörer. Sie verhallt ungehört und wird in ihrem Ungehörtsein zum Gerichtswort.
1.1.1.2Chancen der Predigt heute
Und doch liegen in der schriftgemäßen Predigt so viele Chancen! Chancen, die es lohnend erscheinen lassen, an der Überwindung aller Predigthindernisse zu arbeiten.12 Gott will durch sein verkündigtes Wort Glauben wecken, Neugeburt schenken, zur Umkehr rufen, Maßstäbe setzen, Weisung geben für das Leben und die Fülle seiner geoffenbarten Gedanken entfalten. Kaum je entstand eine Erweckung ohne vollmächtige Predigt. Und dauerhaftes gesundes Gemeindewachstum ist ohne schriftgemäße Verkündigung nicht denkbar.
Eine Gemeinde in New Jersey/USA, die innerhalb von zehn Jahren von 300 auf 1200 Gemeindeglieder gewachsen war, entwarf zur sorgfältigen Planung künftiger Gemeindeprioritäten einen Fragebogen. Dabei ging es um zwei Fragen.13
Erstens: „Was waren die beiden Hauptfaktoren, die Sie veranlassten, erstmals in diese Gemeinde zu kommen?“ 900 Gemeindeglieder beantworteten diese Frage, und zwar mit folgendem Ergebnis (in der Reihenfolge der Häufigkeit der Antworten):
1.Die persönliche Einladung durch einen Freund oder Nachbarn.
2.Das Mitgenommenwerden durch Eltern oder Verwandte.
3.Ein mehr zufälliges Kennenlernen der Gemeinde.
4.Kontakt zur Gemeinde durch die eigenen Kinder.
Es zeigt sich, dass die persönliche Einladung noch immer die beste Werbung für eine Gemeinde ist – und nicht etwa die Anzeige in der Tageszeitung oder der Ruhm des Predigers.
Zweitens wurde gefragt: „Was hat Sie veranlasst, nach Ihrem ersten Besuch weiterhin regelmäßig in unsere Gemeinde zu kommen?“ Auf dem Fragebogen wurden nun eine Reihe von Faktoren und Programmpunkten aufgezählt, die zum Gemeindeleben gehören; und die Gemeindeglieder hatten die Gelegenheit, diese auf einer Fünf-Punkte-Skala nach der jeweiligen persönlichen Bedeutung zu werten. Die Antworten, von denen wir im Folgenden die wichtigsten nennen, ergeben ein Bild, das die Chancen guter Predigt deutlich werden lässt. Denn zu dem Entschluss, regelmäßig die Gemeinde zu besuchen, trugen bei:
1.Die Predigten
4,0 Punkte
2.Die freundliche Atmosphäre
3,2 Punkte
3.Chorgesang und Gemeindemusik
2,7 Punkte
4.Bekannte und Freunde dort
2,6 Punkte
5.Die Gemeindebibelschulgruppe14
2,4 Punkte
6.Gemeinschaftsaktivitäten
2,1 Punkte
7.Besuch durch Gemeindemitarbeiter
1,5 Punkte
Eines wird hier ganz deutlich: Gute Predigt trägt wie kaum etwas anderes dazu bei, dass Menschen gern in eine Gemeinde kommen. Dass es sich in dem vorliegenden Fall um schriftgemäße Predigt handelt, geht im Übrigen aus dem Bericht über jene Gemeinde in New Jersey hervor. Der Prediger bekennt sich zur Autorität der Bibel und vertritt die Grundsätze gründlicher Auslegungspredigt (expository preaching). Persönlicher evangelistischer Einladedienst und eine lebendige biblische Verkündigung gehen Hand in Hand, wenn es um gesundes Gemeindewachstum geht.15
Für den Erfolg der Verkündigung hängt (menschlich gesehen) viel vom Prediger und vom rechten Predigtverständnis ab. Die Tendenz der neueren Predigtlehre führt aber eher vom biblischen Wort weg, statt es zu betonen. Hierin liegt eine Herausforderung für die evangelikale Predigtlehre.
1.1.2Tendenzen der neueren Predigtlehre
Dass Predigt etwas mit der Verkündigung des Wortes Gottes und folglich mit der Auslegung biblischer Texte zu tun hat, dürfte – so allgemein gesprochen – die Zustimmung der allermeisten finden. Und doch hat es der anthropozentrische (d. h. den Menschen ins Zentrum rückende) Megatrend der Moderne und Postmoderne mit sich gebracht, dass Gott und sein Wort nicht im Mittelpunkt des Predigtgeschehens blieben. Evangelischerseits hatte die Reformation Gott und sein Wort, seine Ehre sowie sein Heilshandeln durch das Evangelium ins Zentrum gestellt. Im neuzeitlichen aufgeklärten Denken rückte seit dem 18. Jahrhundert jedoch der Mensch in die Mitte. Der aufgeklärte Protestantismus blieb von diesem Trend nicht unbeeinflusst: Der Mensch, seine Vernunft, seine Bedürfnisse und seine subjektive Meinung rückten zunehmend ins Rampenlicht und begannen, einen zweiten Fokuspunkt neben dem eigentlichen theologischen Fokus zu bilden.
Nun ist der Mensch in der Predigt bzw. Predigtlehre logischerweise immer im Blickfeld gewesen. Auch da, wo die Predigt als Verkündigung des göttlichen Wortes Gott im Mittelpunkt hatte, war sie doch zugleich Anrede an den Menschen. Dabei blieb aber der unendliche qualitative Unterschied zwischen dem autoritativ redenden Gott und dem hörenden, glaubenden und gehorchenden Menschen gewahrt. Diese Haltung entsprach der weisen Mahnung des alttestamentlichen Predigerbuches: „Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst, und komm, um zu hören! … Sei nicht vorschnell mit deinem Mund, und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen; denn Gott ist im Himmel – und du bist auf der Erde!“ (Pred 4,17–5,1). Anders heute: Der moderne und postmoderne Mensch will nicht in erster Linie Adressat des Redens Gottes sein. Mit seinen Bedürfnissen gibt er die Themen vor, zu denen Gott reden kann. Mit seiner Vernunft setzt er den Maßstab für das, was in der Bibel als wahr oder unwahr, wirklich oder mythisch, akzeptabel oder veraltet gelten kann. Und gerade in der Postmoderne hört er – wenn er denn auf die Bibel hört! – prinzipiell subjektiv: Was sie ihm in einer gegebenen Situation und Zeit sagt, wird für ihn (und nur für ihn) so, wie es ihm zur Anrede wird, existenziell bedeutsam. Objektiven, allgemein gültigen Sinn gibt es nicht. Für den nächsten Hörer wird, wenn überhaupt, der Text wieder in anderer Weise bedeutsam. Die Bibel und ihre Bedeutung wird zur Variablen; der Mensch als Beurteiler und Bedeutungssetzer ist die Konstante. Die Bedeutung biblischer Aussagen gilt nicht mehr als durch den Text gesetzt, sondern wird in der Begegnung des Lesers oder Hörers mit dem Text immer neu produziert. Setzten die Reformatoren ihr Motto „Allein die Schrift!“ der altkirchlichen Normenkombination von „Schrift und kirchliche Tradition“ entgegen, gilt nun weithin die neuzeitlich-protestantische Doppelgröße „Schrift und subjektives Urteil“.
In dem Themenheft „Homiletik auf neuen Wegen“ der Zeitschrift Praktische Theologie fassen die Herausgeber David Plüss und Uta Pohl-Patalong den neuesten Trend so zusammen:
Eine wesentliche Diskussionslinie ist dabei eine zunehmende Relativierung des klassischen Schemas „Vom Text zur Predigt“, das auf der Grundlage von Exegese, theologischen Überlegungen und homiletischen Erwägungen einen über den Bibeltext reflektierenden Predigttext entwirft. Der Bibeltext und seine Aktualisierung für das Leben von Menschen heute bzw. besonders für die vielen unterschiedlichen Leben und Lebenserfahrungen tritt stärker ins Blickfeld.16
Wie ist es dazu gekommen? Nach dem Ersten Weltkrieg hatte die neoorthodoxe „Theologie des Wortes Gottes“ von Karl Barth und seinen Weggenossen die Verkündigung des Wortes Gottes als Auslegung des biblischen Textes und der ihm eigenen Sache wieder betont in den Mittelpunkt gerückt und damit mehr als vier Jahrzehnte lang die Szene bestimmt. Barth ging davon aus, dass dem Prediger aufgetragen ist, das Wort Gottes zu sagen. Weil er nur ein Mensch und nicht Gott ist, liegt es nicht in seiner Macht, diesen Auftrag zu erfüllen. Ihm bleibt nur die Möglichkeit, die Heilige Schrift getreu und in der Hoffnung auszulegen, dass Gott unter solcher Schriftauslegung selbst das Wort ergreift und das Bibelwort dem Einzelnen zur göttlichen Anrede werden lässt.17
In den 1960er-Jahren hielt Dietrich Rössler dem entgegen, dass in Wirklichkeit in den Predigten doch tatsächlich gar nicht nur oder in erster Linie der Predigttext ausgelegt werde, sondern im Gespräch mit dem Text von den Bedürfnissen der Zuhörer oder von Ereignissen her, die sie zur Besorgnis veranlassen, jeweils eine Predigtidee entwickelt und entfaltet werde. Diese Realität solle eine Predigtlehre künftig doch bitte ehrlich zur Kenntnis nehmen und in ihrer Theorie berücksichtigen.18 Damit war die sogenannte „empirische Wende“ in der Predigtlehre eingeläutet, die vor allem von Ernst Lange geprägt wurde. Lange vertrat, dass neben die „Was-Frage“ (d. h., was in der Predigt als Textauslegung zu sagen sei) nun betont die „Wem-Frage“ (wem zu predigen ist), die „Wo- und Wann-Frage“ (also die Berücksichtigung der Situation), die „Wie-Frage“ (das Beachten rhetorischer und kommunikativer Aspekte) sowie die „Wozu-Frage“ (das Herausarbeiten des jeweils aktuellen Zwecks der Predigt) zu treten habe.19 An sich sind dies durchaus wesentliche Fragen. Die Folge war aber, dass in der Predigtlehre die je aktuelle „Situation“ immer mehr Interesse auf sich zog – und die biblische „Tradition“ vergleichsweise ins Hintertreffen geriet. Predigt war nun nicht mehr in erster Linie Schriftauslegung, sondern – wie Ernst Lange das formuliert – „Rede mit dem Hörer über sein Leben im Licht der Verheißung“.20 Martin Nicol fasst das heute so: „Predigen bedeutet nicht, über einen Text zu reden, sondern Leben zu deuten.“21
Die neuere Predigtlehre entfernt sich aber nicht nur dadurch vom biblischen Wort, dass sie ihr Interesse stärker dem Hörer und seiner Situation zuwendet – was ja nicht schon an sich von der Schrift wegführen müsste! Nur wenn der Mensch zum eigenen maßgeblichen Thema neben der Schrift bzw. gar anstelle des Wortes Gottes wird, beginnt die Bewegung weg vom Wort der Schrift. – Hinzu kommt, dass die neuere Predigtlehre nicht mehr von einer Hermeneutik ausgeht, für die die ursprüngliche Bedeutung des Bibeltextes maßgebend ist. Vielmehr werden Tür und Tor geöffnet für eine doppelte Absetzbewegung vom Literalsinn des Textes, wie ihn der biblische Autor beabsichtigt hatte: 1. Dem emanzipierten Prediger wird die subjektive Deutungshoheit eingeräumt über das, was der Predigttext (ihm) bedeutet.22 2. Und zusätzlich wird dem emanzipierten Predigthörer die subjektive Deutungshoheit über das, wie er die Predigt verstehen will, gegeben. Letzteres bedarf einer kurzen Erläuterung: Früher hatte man es als Problem gesehen, dass die Hörer das, was der Prediger sagte, oft anders verstanden, als dieser es gemeint hatte. Aus dieser Not hat man heute eine Tugend gemacht. Moderne Predigttheoretiker verstehen die Predigt als ein „offenes Kunstwerk“23. Wie ein Kunstwerk – zum Beispiel ein Bild – jedem Betrachter etwas anderes sagt, so soll das nun auch für die Predigt gelten. Maßgeblich für ihr Verständnis ist nicht mehr, was der Prediger (gar in Treue zur Aussageabsicht des biblischen Autors) mit dem meint, was er in seiner Predigt sagt. Vielmehr gilt es als völlig akzeptabel, dass die Predigt jeden Hörer anders anspricht und jeder Hörer sie folglich anders hört. Und so ist es in den evangelischen Kirchen, die sich ursprünglich ja als die „Kirche des Wortes (Gottes)“ verstanden haben, seit der empirischen Wende mancherorts zu einem Predigtverständnis und einer Predigtpraxis gekommen, bei der die Bibel und ihr eigentlicher Sinn hinter den Hörer, seine Situation, seine Bedürfnisse und seine subjektive Sinndeutung zurücktreten muss.
Gegen die Auswüchse dieses Trends hat es seit den 1980er-Jahren auch gewisse Gegenentwürfe gegeben. So veröffentlichte Horst Hirschler 1988 eine umfangreiche Predigtlehre mit dem bezeichnenden Titel biblisch predigen24. Prediger sollen lernen, Bibeltexte so auszulegen, dass man etwas davon hat (S. 15). Der Normalfall ist für ihn Predigt als lebensnahe Auslegung eines Bibeltextes. Allerdings bindet sich der Existenzialtheologe Hirschler aufgrund seiner historisch-kritischen Überzeugungen nur bedingt an das biblische Wort. Der vorliegende Bibeltext ist für ihn nicht Gottes Wort, sondern Umschlagplatz von Glaubenserlebnissen der Vergangenheit (S. 18); er kann dem Leser aber im Kontext gegenwärtiger Gotteserfahrung zum Gotteswort werden (S. 37). Keinesfalls solle sich der Prediger dem Bibeltext einfach ausliefern, sondern nur „mithilfe des Textes in eigener theologischer Verantwortung predigen“ (S. 294) – was für Hirschler gelegentlich auch heißt, gegen den Text zu predigen (S. 41). Und doch empfiehlt er für den Normalfall eine „möglichst eindrückliche Bibelauslegung“ als Kernstück der Predigt (S. 381f.).
Auch der gegenwärtig einflussreichste Predigttheoretiker, Wilfried Engemann, spricht sich nachdrücklich gegen den „Texttod“ in der Predigt aus.25 Das Problem bleibt Engemanns Hermeneutik, die auf dem Weg von der Bibel zum Hörer von beständigen kreativen Sinnveränderungsprozessen ausgeht: So habe der biblische Autor ein (Offenbarungs-)Ereignis interpretiert und daraus den Bibeltext produziert; der Prediger habe in der Vorbereitung den Bibeltext interpretiert und ein Predigtmanuskript produziert; dann habe er auf der Kanzel sein Predigtmanuskript interpretiert und den Predigtvortrag produziert; und schließlich habe der Hörer den Predigtvortrag interpretiert und sein Hörprodukt (das „Auredit“, wie Engemann das nennt) produziert.26 Die Gefahr sei dabei, dass Letzteres mit Ersterem nur noch entfernt zu tun hat.
Vor diesem Hintergrund wird es die Aufgabe einer evangelikalen Predigtlehre sein, zweierlei zu leisten: erstens ein Predigtverständnis zu entwickeln, das darauf zielt, dass wirklich der biblische Text als Wort Gottes gepredigt wird. Und zweitens das berechtigte Anliegen aufzugreifen, dass konkret, lebensnah, situations- und hörerbezogen in anschaulicher sowie nachvollziehbarer Weise gepredigt wird. Das Predigtmodell, das beides miteinander verbindet, ist die kommunikative Auslegungspredigt. Dieses Modell soll im Folgenden entfaltet werden.
1.2Biblische Grundlagen für den Predigtdienst
Im Blick auf die biblischen Grundlagen für den Predigtdienst befassen wir uns mit den folgenden drei Themen: 1) Der biblische Predigtauftrag; 2) Die Berufung des Verkündigers; und 3) Die Begabung des Verkündigers.
1.2.1Der biblische Predigtauftrag
Seit der Reformation bildet die Predigt das Kernstück des Gottesdienstes. Für ein evangelisches Verständnis gemeindlichen Handelns ist die Predigt daher zentral.
Martin Luther vertrat in seiner Schrift Von der Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde von 1523 vehement:
Aber die summa soll sein, daß gewiß alles geschehe, damit das Wort recht in Übung kommt und nicht wieder ein Plärren und Lärmen daraus werde, wie es bisher gewesen ist. Es ist alles besser unterlassen als das Wort, und es ist nichts besser getrieben als das Wort. Denn daß dieses unter den Christen in rechter Übung sein sollte, zeigt die ganze Schrift an, und Christus sagt auch selber Luk. 10: „Eins ist vonnöten“, nämlich daß Maria zu Christi Füßen sitze und höre sein Wort täglich […]27
Umso wichtiger ist es, dass wir uns als evangelische Christen Gedanken machen über ein biblisch verantwortetes Predigtverständnis.
1.2.1.1Die Vielfalt der biblischen Predigtbegriffe
Unser Wort „predigen“ kommt von dem lateinischen Begriff praedicare, was „öffentlich bekannt machen, laut ankündigen, preisen“ heißt. Erst im Lauf der Zeit, vor allem durch Luthers Bibelübersetzung, wurde es zum Fachwort für die kirchliche Verkündigung. Dieses allgemeine Wort „predigen“ kann allein aber kaum einen Eindruck von der ganzen Fülle dessen vermitteln, was in den vielfältigen biblischen Begriffen für die Verkündigung der biblischen Botschaft mitschwingt. Heiko Krimmer stellt fest: „Im NT wird das öffentliche Zeugnis des Evangeliums mit mehr als 30 griechischen Begriffen ausgedrückt.“28
Wir können hier nur einige beispielhaft nennen. Eine ganz ähnliche Bedeutung wie das lateinische praedicare (s. o.) hat das griechische Wort kerysso. Es bedeutet „durch einen Herold bekannt machen (‚herolden‘), laut beziehungsweise öffentlich verkündigen“. So werden die großen Taten Gottes, aber auch sein offenbarter Wille im Namen und in der Autorität Gottes öffentlich bekannt gemacht.
Ein anderes Wort ist euangelizo, „die gute Nachricht (vom Sieg) ansagen, frohe Botschaft verkündigen, evangelisieren“. Die Nachricht von der Erlösung in Christus weiterzusagen, sein Heil, seinen Sieg – aber auch das Gericht – anzusagen, gehört zum neutestamentlichen Evangelisationsauftrag.
Wichtig ist auch das schlichte Wort martyreo, „bezeugen, Zeugnis ablegen“. Es macht einen unverzichtbaren Aspekt biblischer Verkündigung deutlich, nämlich dass der Prediger für seine Botschaft aufgrund von deren Zuverlässigkeit als wahr und zugleich als persönlich erfahrbar und erprobt eintreten kann.
Fast einhundert Mal kommt das Wort didasko, „lehren“, vor. Es zeigt, dass die neutestamentliche Predigt wesentlich auch Vermittlung von Erkenntnis ist. Sie will Verständnis bewirken und dem Hörer Einblick in den geoffenbarten Ratschluss Gottes geben. Die Predigt zielt damit auf die Erkenntnis – und durch Änderung der Erkenntnis auf ein verändertes Leben.
Ein sehr wesentlicher Aspekt der apostolischen Predigt war das seelsorgerliche „Ermahnen“ und „Ermuntern“, griechisch parakaleo, das von seinem biblisch-hebräischen Hintergrund her die Aspekte des Erbarmens, der Zuwendung, des Aufatmen-Lassens enthält (hebr. nacham). Die neutestamentlichen Briefe, die im Grunde ein Extrakt der apostolischen Verkündigung darstellen, sind voll von „Paraklese“, das heißt dem seelsorgerlichen Mühen um den Einzelnen und um die Gemeinde angesichts von konkreten Problemen. Seelsorgerliche Verkündigung ist, neutestamentlich gesehen, nie nur Mahnwort oder nur Zuspruch. Sie ist beides. Und dieses seelsorgerliche Element in der Predigt, das tröstet, aufrichtet, ausrichtet und den Einzelnen in seinen Problemen anspricht und abholt, ist unverzichtbar. Parakletische Predigt, die nicht moralischer Appell bleibt, hilft und baut auf. Lloyd-Jones war sogar der Überzeugung, dass Gemeindeseelsorge weithin durch die Predigt geschehen kann.29
Es ließen sich noch manch andere Begriffe anführen. Doch wird eines bereits deutlich: Schriftgemäße Predigt hat vielfältige Akzente, auch wenn ihr immer das Wesensmerkmal zu eigen ist, dass sie Gottes Wort auslegt und allein in diesem Wort gründet. Schriftgemäße Predigt kann Lehrpredigt oder Evangelisation sein, sie kann Freuden- und Gerichtsbotschaft vermitteln, sie bezeugt, kündigt an, spricht autoritativ im Namen Gottes, belehrt, tröstet und weist zurecht. Die Predigt in ihren Ausdrucksformen muss der Fülle des Inhalts der Bibel entsprechen.
1.2.1.2Der Ausgangspunkt der Predigt heute
Die Ausgangssituation all unseres Predigens, hinter die wir nicht zurückkönnen und die wir nicht verleugnen dürfen, ist diese: „Gott hat vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise durch die Propheten zu den Vätern geredet, zuletzt aber hat er zu uns geredet durch seinen Sohn“ (Hebr 1,1). Gott hat geredet – und zwar vielfältig und endgültig! An diesem ein für alle Mal ergangenen Reden Gottes muss unser Predigtverständnis ansetzen – und nirgends sonst. Nicht an dem, was der Prediger persönlich gern sagen möchte; auch nicht an dem, was der Hörer gern hört und scheinbar braucht. Diese Dinge werden in der Predigtvorbereitung an ihrem Ort zwar eingehend mit bedacht werden müssen, aber sie sind nicht die Basis.
Unsere Verkündigung setzt immer das geschehene Wort Gottes voraus und setzt bei diesem Wort ein. Sie hat nichts anderes und nichts Neues zu sagen. Sie kennt keine andere Autorität und keine andere Offenbarung als die, die ein für alle Mal geschehen ist und uns im Wort der Bibel vorliegt.
Schon die Propheten des Alten Bundes waren Prediger. Und ihre Bücher, die wir im Alten Testament finden, sind zum Teil niedergeschriebene „Predigten“. Aber ihre Predigt unterscheidet sich wesenhaft von der unseren. Unmittelbar von Gott angesprochen, verkündigten sie Offenbarung direkt von Gott her.30 Ähnlich verkündigten Jesus und – in geistgewirkter Deutung seiner Sendung – die Apostel Gottes Wort als unmittelbare Offenbarung (vgl. 1Thes 2,13; 1Kor 2,6-13).31 Dieses Offenbarungsreden geschah ein für alle Mal und ist grundlegend für jede künftige Predigt. In Christus ist uns die unüberbietbare, nicht mehr ergänzungsbedürftige und damit letztgültige Offenbarung Gottes gegeben, die uns durch die erwählten Boten der apostolischen Generation übermittelt und erschlossen wurde (Hebr 1,1ff.; 2,2-4; vgl. Joh 15,26f.; 16,13). Seit der apostolischen Generation kann kein weiteres authentisches Christuszeugnis beigebracht werden. Im Neuen Testament ist uns die neue, für die gesamte Gemeindezeit gültige Offenbarung abschließend gegeben. Alle künftigen Generationen in der Kirchengeschichte bauen auf diesem Fundament, das durch die neutestamentlichen Apostel und Propheten ein für alle Mal gelegt ist und wobei Christus der die Richtung bestimmende „Eckstein“ ist (Eph 2,20; vgl. Röm 16,25f.).
Unsere Verkündigung heute ist also nicht mehr unmittelbares Offenbarungsgeschehen. Sie setzt vielmehr das bereits geschehene Offenbarungswort voraus und setzt dieses in unsere Zeit hinein. Vom alttestamentlichen Vergleich her gesprochen entspricht unsere Predigt weniger der Tätigkeit der inspirierten Propheten – wobei wir allerdings noch auf einen gewissen „prophetischen“ Aspekt in unserem Predigen zu sprechen kommen werden – als vielmehr dem Lehr- und Verkündigungsauftrag der Priester und priesterlichen Schriftgelehrten32, die die Schrift auszulegen hatten (5Mo 33,9b-10; Mal 2,7; 2Chr 17,7-9; Neh 8,1ff.). Und vom Neuen Testament her gilt: Während die Apostel inspirierte Zeugen des fleischgewordenen Wortes waren, sind die Lehrer und die Prediger der Gemeinde Jesu seither Ausleger und bevollmächtigte Verkündiger des geschriebenen Wortes.
Wer daher heute in seiner Predigt, ohne von der Bibel her zu sprechen, unter Berufung auf den Heiligen Geist direkte Offenbarungsrede für sich beansprucht oder unter dem Vorwand geistgeleiteter Einsicht Dinge aus der Schrift herausliest, die dem klaren Wortsinn nicht entsprechen, setzt sich dem Vorwurf der Schwärmerei aus. Der Geist bindet sich an das Wort, das er selbst eingegeben hat. In diesem Zusammenhang hat bereits Luther zu Recht darauf bestanden,
dass Gott niemand seinen Geist oder Gnade gibt, ohne durch oder mit dem vorhergehenden äußerlichen Wort. Damit wir uns bewahren vor den Enthusiasten, das ist, Geistern, so sich rühmen ohne und vor dem Wort den Geist zu haben, und dadurch die Schrift […] richten, deuten und dehnen nach ihrem Gefallen; […] die zwischen dem Geist und Buchstaben scharfe Richter sein wollen, und wissen nicht, was sie sagen oder setzen.33
Die Basis und der Ausgangspunkt schriftgemäßer Predigt ist das biblische Wort – und sonst nichts. In diesem Sinne müssen wir jeder schwärmerischen Unabhängigkeit von der Schrift im Predigtverständnis wehren.
Zugleich muss aber auch jeder säkular bestimmten Unabhängigkeit von der Schrift gewehrt werden. Gemeint ist damit ein Verständnis von Predigt, das nicht mehr fest im Wort der Bibel wurzelt.
Ein Beispiel für solch eine säkular bestimmte Unabhängigkeit von der Schrift ist die rhetorische Homiletik Gert Ottos. Sein Predigtverständnis geht von der Problematik aus, dass zwar noch erstaunlich viele Menschen Sonntag für Sonntag zur Predigt gehen, die Predigt aber in Verruf gekommen ist, weil sie teils nicht begriffen wird, teils zu wenig überzeugend wirkt und als blutarmes Geschwätz empfunden wird. Diese Beobachtungen sind für G. Otto grundlegend: „Ihr Gewicht liegt allen steilen theologischen, dogmatischen Aussagen, was eine Predigt sei und was sie nicht sein dürfe, weit voraus. Diese anspruchsvolle wie verpflichtende Ausgangssituation ist so ernst zu nehmen, dass sie die beliebte Frage, wodurch sich eine Predigt von einer weltlichen Rede unterscheide, eindeutig an die zweite Stelle verweisen muss.“34 Otto zieht daraus die Konsequenz, dass man die Predigt – im Interesse der Predigt! – von der Rhetorik her verstehen und entwickeln müsse. „Rhetorik“ ist für ihn dabei nicht nur Redetechnik, sondern vielmehr der Versuch, in einer gegebenen Situation zu erkennen, was Wahrheit ist, sowie die Mitteilung dieser Wahrheit an die Zeitgenossen in geeigneter Weise. Für die Homiletik bedeutet das, dass der Predigt die Wahrheit nicht schon vorgegeben ist im Wort der Heiligen Schrift, sondern dass die zu verkündigende „Wahrheit“ erst im Dialog mit der konkreten Situation gefunden werden muss beziehungsweise in diesem Dialog entsteht.35 Und gerade das wird als Teil des neuen rhetorischen Bemühens um die Predigt verstanden. Es ist klar, dass von daher auch die Bedeutung der biblischen Basis und der theologisch-exegetischen Vorarbeit für die Predigt relativiert werden muss.36 Sie tritt in der Predigtvorbereitung nur noch als ein Gesprächspartner neben anderen bei der Wahrheitsfindung und -verteidigung auf: neben den gleichgewichtigen Fragen nach der angemessenen Form des Weitersagens heute, nach den sozialen Umständen, die zeigen, wie das damals Gesagte in konkreten Situationen jetzt zu sehen und zu sagen ist, sowie neben weiteren psychologischen und profanhistorisch-politischen Erwägungen. Fazit:
Was Theologie jeweils zu bedenken hat, was der Glaube jeweils sagen kann, als sein Wort in der Zeit, das ergibt sich nicht allein aus der Konzentration auf innertheologische Überlieferung und ihre möglichst wortgetreue Wiederholung, sondern genau umgekehrt ist es: Was heute notwendige Theologie oder die notwendige Aussage des Glaubens ist, das ergibt sich immer erst, wenn ich mich mit der Überlieferung auf die Situation der Zeit einlasse. Oder noch konkreter, und darin streng rhetorisch gedacht: Was ich zu sagen habe, etwa als Prediger, wird allererst vernehmbar in der Hinwendung zum redenden und hörenden Menschen in seiner, meiner jeweiligen konkreten Situation. Theologie, die sich auf Rhetorik einlässt, kennt also den Glauben nicht als fertige, situationslose Substanz, sondern erfährt ihn in vielfältigen Dialogen, die über die Mauern der Theologie hinausführen.37
Der konkrete Umgang mit dem Bibeltext im Blick auf die Predigt sieht dann so aus:
•Ich entnehme dem Text einen (komplexen) Begriff, der mir geeignet erscheint, außerhalb des Textes, in der Situation meiner Hörer weiterverfolgt zu werden.
•Oder: Der Text bietet mir […] ein Bild, das mich inspiriert.
•Oder: Ein Wort, vielleicht ein nebensächliches, oder ein Gedanke, vielleicht ein am Rande liegender, weckt Assoziationen, denen ich folge.
•Oder: Zu einer aus der Situation vorgegebenen Thematik fällt mir ein Gedanke, ein Bild, eine sprachliche Wendung aus einem biblischen Text ein, die ich aufnehme und weiterverwende.
•Oder auch: Ich exegesiere einen Text und entwerfe vom Skopus, vom Textwillen her unter notwendiger Verwendung weiterer Materialien eine Predigt.38
Was Gert Otto hier schreibt, ist in der Tat das Gegenteil dessen, was in diesem gesamten Buch vertreten wird. Es ist im Grunde die Absage an eine evangelische Theologie, die in der Reformation einmal angetreten war, um gegründet auf das Wort allein (sola scriptura) den Traditionen der Menschen und den Fantasien der Schwärmer den Abschied zu geben und vollmächtig zu sagen, was Gott selbst geoffenbart hat. Vermutlich wären Thomas Müntzer und seine Mitstreiter in der Reformationszeit mit einem Ansatz dieser Art besser klargekommen als mit dem Wittenberger Reformator. Hinter Gert Ottos moderner Predigtkonzeption steht eine historisch-kritische Hermeneutik, die das Vertrauen in die Bibel als Gottes Wort längst verloren hat (siehe dazu die Ausführungen unter Abschnitt 2.1). Man möchte sich angesichts dessen an die Klage Gottes durch den Mund des Propheten Jeremia erinnern: „Mein Volk tut eine zwiefache Sünde: mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben“ (Jer 2,13).
1.2.1.3Der Auftrag zur biblischen Predigt
In 2Tim 3,16–4,3 findet sich eine geradezu klassische Stelle für den biblischen Predigtauftrag. Angesichts drohender Irrlehren in der Gemeinde sowie gesellschaftlicher Auflösungserscheinungen erhält Timotheus folgende apostolische Weisung:
Die ganze (Heilige) Schrift ist von Gott gehaucht und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Neuausrichtung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit ein Gottesmensch zubereitet werde, zu jedem guten Werk voll ausgerüstet. Ich beschwöre dich vor Gott […]: Predige das Wort! Stehe dazu zur Zeit und zur Unzeit. Überführe, tadele, gib Zuspruch – mit aller Ausdauer und Lehre!
In einer brenzligen Situation wird Timotheus an die Heilige Schrift (Altes Testament) als seinen Verkündigungstext gewiesen. Diese Schrift stammt in ihrer Ganzheit von Gott (ist also „inspiriert“, griech. theópneustos) und vermag daher allein die notwendige Belehrung, Veränderung und geistliche Zurüstung zu geben.39 Dieses biblische Wort erschließt die Gedanken Gottes, indem es lehrt (griech. didaskalía). Es deckt die Situation des Menschen vor Gott auf, indem es überführt (griech. elegmós). Es „renkt“ den Schaden des Menschen wieder „ein“ (griech. epanórthosis). Und es erzieht den Menschen in dem, was recht ist vor Gott (griech. paideía). Nur von diesem Wort her ist Hilfe zu erwarten. Umso wichtiger ist es, dass nichts anderes und nichts weniger als ebendiese geistliche Quelle von lebensverändernder Lehre in Anspruch genommen wird: „Ich beschwöre dich […]: Predige das Wort!“ (4,1f.). Darin liegt ein Appell zur Konzentration auf das Eine, das nottut. Das Wort, das ganze Wort und nichts als das Wort ist die Botschaft, die dem Verkündiger aufgetragen ist. Schriftgemäße Predigt hat Auslegung des Wortes Gottes zu sein, wie es uns in der Bibel dargeboten ist. An diesem Maßstab wird sich die Qualität einer jeden Predigt messen lassen müssen, ob sie wirklich „das Wort“ verkündigt – so, wie Gott es eingegeben hat in seinem ursprünglichen und allein maßgeblichen Sinn.
Und dieses gepredigte Wort will (4,2) erstens „überführen“ (griech. elenchéo), das heißt, es will Sünde aufdecken und den Menschen in das Licht Gottes stellen. Vollmächtige Wortverkündigung ist geistliche Röntgendurchleuchtung im Dienst der inneren Gesundheit. Zweitens wird das Wort „tadeln“ (griech. epitimáo), das heißt, es wird – wo es durchleuchtet hat – auch konkret deutlich machen, wo sich etwas ändern muss. Drittens will das Wort dann seelsorgerlich weiterhelfen (griech. parakaléo, was den ermahnenden wie auch den ermunternden Zuspruch meint). Gott stellt nicht nur die Diagnose im Vollzug biblischer Predigt, sondern wirkt auch die geistliche Therapie. Die biblische Botschaft, recht verkündigt, wirkt zutiefst seelsorgerlich.
Die Früchte der Predigt zeigen sich allerdings nicht immer sofort; und manchmal stößt die Auslegung des Wortes Gottes auf Widerstand. Da gilt es, „mit Ausdauer“ – zur Zeit und zur Unzeit – das Wort unerschrocken zu lehren (4,2a). Es gibt kein geistliches Wundermittel, das schnellen Erfolg garantiert. Nein, die gesunde biblische „Lehre“ will in geduldigem Warten auf Gottes Erntezeit verkündigt sein. Erfolgshaschende Kanzelrede, die das bringt, „wonach den Leuten die Ohren jucken“ (V. 3), führt nicht zum Ziel.
„Predige das Wort!“ ist das Motto, um das es geht. „Predige das Wort!“ ist der göttliche Auftrag, der die Mühe um ein gründliches und genaues Erarbeiten des Bibeltextes rechtfertigt. „Predige das Wort!“ ist der Maßstab, an dem sich unser eigenes Predigen und alles, was sich als Predigt ausgibt, immer neu zu messen hat. Das geoffenbarte Wort des lebendigen Gottes gilt es zu verkündigen – nicht mehr und (möge Gott es schenken!) nicht weniger.
1.2.2Die Berufung des Predigers
Ob es zu vollmächtiger, schriftgemäßer Verkündigung kommt, entscheidet sich allerdings nicht erst in der konkreten Predigtvorbereitung und Predigtdarbietung, sondern auch schon an der Frage, ob der Verkündiger ein von Gott berufener und begabter Mann ist. O. S. von Bibra schreibt zu Recht:
Jurist, Techniker, Lehrer, Handwerker, Bauer kann man ohne Weiteres werden kraft des eigenen Entschlusses – „Theologe“ auch! Aber Diener am Wort im neutestamentlichen Sinn wird man nur durch göttliche Einsetzung; wo diese fehlt, lässt sie sich auch durch die Ordination nicht ersetzen.40
Im Alten wie im Neuen Testament konnten Menschen nur dann im Namen Gottes sprechen, wenn sie von ihm gesandt waren. „Wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind?“, fragt Paulus (Röm 10,15). „Ich habe sie nicht gesandt, und doch sind sie so geschäftig. Ich habe ihnen keinen Auftrag gegeben, und doch reden sie in meinem Namen. Hätten sie wirklich in meinem Rat gestanden, so würden sie mein Volk […] von seinem bösen Wandel und seinem gottlosen Tun zur Umkehr bringen“, lautet die Gottesklage durch seinen Propheten (Jer 23,21ff.; vgl. 5Mo 18,20). Nach Eph 4,11 hat Christus „selbst die einen als Apostel, die anderen als Propheten, die nächsten als Evangelisten, als Hirten und Lehrer eingesetzt“ (vgl. Gal 1,1).
Diese Berufung geschah schon zu biblischen Zeiten ganz unterschiedlich. Mose und Jesaja erlebten Gott in einer außergewöhnlichen Weise (2Mo 3; Jes 6). Jeremia wurde durch ein Wort Gottes angesprochen (Jer 1,4ff.). Elisa und Timotheus wurden durch bevollmächtigte Gottesmänner in ihren Dienst geführt (1Kö 19,19ff.; Apg 16,1-3); ähnlich die Apostel durch Jesus (Mk 3,13ff.). Paulus und Barnabas erhielten die Weisung des Heiligen Geistes durch die sendende Gemeinde (Apg 13,1-3). Gewiss ließen sich noch andere Berufungsvorgänge nennen. Es kommt nicht so sehr darauf an, wie die göttliche Berufung im Einzelnen erfolgt, sondern dass sie erfolgt!
Wen Gott berufen hat, der weiß um diesen Ruf. Er wird ihm zu einer göttlichen Lebensbürde, zu einem „inneren Muss“. „Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben“, sagen die Apostel (Apg 4,20). Und Paulus bekennt: „Wenn ich evangelisiere, so bleibt für mich kein Ruhm, denn eine Notwendigkeit liegt auf mir. Wehe mir, wenn ich meine evangelistische Botschaft nicht ausrichten würde!“ (1Kor 9,16; vgl. Apg 26,15ff.). Er kann dies sagen, weil er sich als ein nach Gottes erwählendem Willen vom Mutterleib „ausgesonderter“ und zu einem bestimmten Dienst „berufener“ Diener Gottes versteht (Röm 1,1; Gal 1,1.15f.; 1Tim 1,1).
Diese göttliche Berufung ist nun nicht einfach identisch mit einer menschlichen „Ordination“ beziehungsweise der Berufung (Vokation) durch eine Gemeinde. Es könnte sein, dass ein von einer Kirche oder Gemeinde ordentlich Berufener (rite vocatus – ein Wort, das in der Reformationszeit Bedeutung erlangte) doch die allein entscheidende göttliche Berufung nicht hat. Erinnern wir uns: Christus ist es, der sich in seiner Gemeinde Apostel, Evangelisten, Seelsorger und Lehrer beruft und einsetzt (1Kor 12,28; Gal 1,1.15f.; Eph 4,11; Apg 13,1). Und diese Dienste sollen dann von den von Gott bestimmten Personen in geordneter Weise ausgeübt werden.
Was ist dabei die Aufgabe der Gemeinde, um der Gefahr selbst berufener Prediger zu begegnen? Das Neue Testament macht deutlich, dass die Gemeinde niemanden eigenmächtig zum Dienst wählen oder berufen darf. Ihre Aufgabe ist allein, 1. unter der Führung des Heiligen Geistes und unter Berücksichtigung notwendiger biblischer Eignungskriterien zu erkennen, wen Christus für einen bestimmten Dienst berufen und zubereitet hat, und 2. ihn dann im Gehorsam unter Handauflegung in den Dienst einzusetzen beziehungsweise zu senden.41
Wichtig für das Erkennen einer Berufung ist nicht zuletzt, dass Gott in seinem Wort gewisse Normen gesetzt hat, die als Voraussetzung für bestimmte Dienste gelten müssen. Und da Gott sich nicht widerspricht, ist mit göttlicher Berufung (noch) nicht zu rechnen, wo ein Mensch außerhalb jenes Normbereichs lebt.42 Beispielhaft wollen wir einige Maßstäbe dieser Art nennen.
Es ist wohl kaum damit zu rechnen, dass jemand zum Zeugen Jesu Christi und Botschafter des Evangeliums berufen ist, der Christus nicht im Glauben als seinen Herrn und Retter erfahren hat. Wer die Rechtfertigung aus Glauben nur als einen theologischen Lehrsatz kennt, kann kein berufener Zeuge des Evangeliums sein. Paulus kann es persönlich sagen: „Der Gott, der sagte: ‚Licht leuchte aus der Finsternis hervor!‘, der hat es in unseren Herzen aufleuchten lassen, damit durch uns Erleuchtung entstünde, die von der Kenntnis der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Christi kommt“ (2Kor 4,6). Der Verkündiger des Evangeliums spricht nicht vom Licht wie ein Blinder, sondern als einer, der durch Gottes neu schaffendes Handeln sehend geworden ist.
Weiter nennt die Bibel gewisse geistlich-ethische Maßstäbe für berufene Mitarbeiter in der Gemeinde. Schon Diakone mussten Menschen sein, die „einen guten Ruf haben, voll Heiligen Geistes und Weisheit sind“ (Apg 6,3; vgl. 1Tim 3,8ff.). Und für die Einsetzung in das gemeindliche Lehr- und Leitungsamt, das der Aufgabe eines Pastors heute entspricht, werden eine ganze Reihe ethischer, familiärer und begabungsbezogener Kriterien genannt, anhand derer die Gemeinde berufene und von Gott zubereitete Männer erkennen soll. Diese Hirten und Lehrer müssen einen guten Ruf haben; familiär gesehen sollten sie weder in ehelicher Untreue noch in der Vielehe noch in einer zweiten Ehe nach einer Scheidung leben, sie sollten ihrer Familie gut vorstehen, gehorsame Kinder haben und gastfreundlich sein; charakterlich sollen es nüchterne, besonnene, taktvolle, beherrschte Personen sein, die weder einer Sucht noch den Versuchungen des Geldes verfallen sind; geistlich sollten sie sich im Glauben bereits bewährt haben und die Begabung zum Lehren aufweisen (1Tim 3,1-7). Nur wo jemand diese Spiritualität und diese Kompetenzen erkennen lässt, kann die Gemeinde den Betreffenden in den Dienst einsetzen.43 Insgesamt ist wichtig, dass ein berufener Diener Gottes seiner Berufung gemäß lebt. Paulus wollte nicht „anderen predigen und selbst verwerflich werden“ (1Kor 9,27). In der Lehre wie im Leben soll sich ein Verkündiger des Evangeliums bewähren (1Tim 4,12-16). Dazu gehört auch die innere Freiheit des Predigers gegenüber dem Urteil der Menschen: „Wenn ich mich noch um das Wohlgefallen der Menschen bewürbe, wäre ich Christi Knecht nicht“ (Gal 1,10). „Diener am Wort“ sind Berufene des Christus, die ihrem Herrn in ihrem ganzen Leben und Dienst gefallen sollen.
Ein weiterer Maßstab für die Berufung zum Verkündigungsdienst ist heute interkonfessionell besonders umstritten. Das Neue Testament schließt das Lehr- und Leitungsamt der Frau in der Gemeinde ausdrücklich aus (1Tim 2,12; 1Kor 14,33-35). Bis in unser Jahrhundert hinein hat man sich in allen Kirchen – ob katholisch, evangelisch, landes- oder freikirchlich – auch an diese Willenssetzung Gottes für seine Gemeinde gehalten. In einer Zeit, die neben einer – biblisch auch voll berechtigten – Wiederherstellung der schöpfungsmäßigen Würde der Frau doch auch von feministischen Emanzipationsideologien bestimmt wurde und wird, kam es aber zu theologischen Umdeutungen, bibelkritischen Infragestellungen und pragmatischen Gegenargumentationen zu diesen Aussagen der Heiligen Schrift. Es sollte aber nicht vergessen werden, dass die Gemeinde Gottes Gemeinde ist, in der er seine mannigfache Weisheit demonstrieren will (Eph 3,10). Wer sind da wir, dass wir in eigener, dem Wechsel der Zeiten unterworfener Weisheit Gottes Ordnungen als überholt erklären? Ich meine daher, dass von der Bibel her mit einer göttlichen Berufung zum Frauenpastorat eindeutig nicht zu rechnen ist.44 Allerdings gibt es andere Bereiche, innerhalb derer Frauen die biblische Botschaft bezeugen sollen (Tit 2,3f.; Apg 18,26; 21,9; 1Kor 11,5; vgl. Röm 16,1-16).
Die Berufung zum Verkündigungsdienst ist nun nicht notwendigerweise gleichzusetzen mit der Berufung zur hauptberuflichen Ausübung des Predigtamtes. Berufung und Beruf müssen biblisch gesehen nicht verquickt sein. Das Neue Testament lässt offen, unter welchen Umständen und an welchem Ort eine Berufung zum Verkündigungsdienst auszuüben ist. Solche Aspekte haben weniger mit der Berufung an sich als vielmehr mit der persönlichen Führung des Berufenen durch Gottes Geist zu tun. Solche Führung mag auch zu unterschiedlichen Zeiten des Lebens unterschiedlich aussehen. In neutestamentlicher Zeit wird in der örtlichen Gemeinde der nebenberufliche Verkündigungsdienst die Regel gewesen sein. Entsprechend sollte dieses Element in lebendigen Gemeinden auch ganz selbstverständlich zum Predigtdienst gehören. Daneben finden wir im Neuen Testament Verkündiger, die ganz oder teilweise von der Gemeinde finanziert werden. In der Regel trifft das auf die Apostel mit ihren überörtlich-missionarischen, aber auch ihren örtlichen gemeindeleitenden Aufgaben zu (1Kor 9,4-14). Lediglich Paulus hat es für sich als richtig angesehen, diesen apostolischen Dienst neben einer handwerklichen Erwerbstätigkeit auszuüben (1Kor 9,6.15.17f.; Apg 18,1-3; 20,33f.). Je nach Bedarf werden auch die Hirten und Lehrer der örtlichen Gemeinden zumindest teilweise von den übrigen Gemeindegliedern „mitfinanziert“ worden sein (Gal 6,6; 1Tim 5,17f.; vgl. 2Tim 2,3-7). In einer Zeit, in der ein Handwerker sechs Tage in der Woche von früh bis spät arbeiten musste, um seine Familie zu ernähren, wäre ein Hirten- und Lehrdienst in der Gemeinde ohne diese Beihilfe gar nicht möglich gewesen.45 Und wo die Gemeinde es von ihrer Größe und Aufgabenfülle her verlangte (wie etwa die Jerusalemer Urgemeinde), konnte es geschehen, dass sogar mehrere Personen vollzeitlich im Verkündigungsdienst tätig waren (vgl. Apg 6,2ff.). Nie jedoch würde es der neutestamentlichen Gaben- und Dienstvielfalt entsprochen haben, den Dienst am Wort auf ein „Ein-Mann-System“ verkümmern zu lassen. Geistliche Ergänzung war gefragt.46
Wenn es also um den Verkündigungsdienst geht, ist das Entscheidende die Berufung. Ob diese dann in einem vollzeitlichen oder teilzeitlichen, örtlichen oder überörtlichen Dienst ausgeübt wird, ist eine Frage der persönlichen Platzanweisung durch Gott angesichts der jeweiligen Bedürfnisse und Möglichkeiten. Als evangelische Christen haben wir gerade an dieser Stelle noch manche Hypotheken eines unflexiblen Klerikaldenkens zu überwinden.
1.2.3Die Begabung des Predigers
Ein wichtiges Merkmal der Berufung ist die Begabung zum Dienst. Die Begabung ist Folgewirkung und wesentliches Kennzeichen einer Berufung. In der Begabung mit geistlichen Dienstgaben (Charismen) manifestiert sich der souveräne Erwählungswille Gottes zu bestimmten Aufgaben. Er gibt die Gaben, wie er will (1Kor 12,6.11.18.28). Und ohne diese nötige Zurüstung sendet Christus keinen Arbeiter in den Dienst (Mk 6,7; Joh 20,21ff.; Apg 1,8).
Es ist nun allerdings wichtig zu bemerken, dass Predigtbegabung nicht einfach mit Beredsamkeit verwechselt werden darf. Bevollmächtigte Verkündigung ist eine Gabe des Heiligen Geistes, die geistliche Wirkungen hervorruft, und nicht einfach rhetorische Brillanz, die Ohrenkitzel bewirkt. Wenn es nur um Rhetorik (Redekunst) ginge, wäre Paulus wohl ein schlechter Verkündiger gewesen. Und doch steckte hinter seiner Predigt eine lebensverändernde göttliche Kraft (1Kor 2,1-4).
Zur Predigtbegabung gehört immer ein Stück Charisma der Erkenntnis und Lehre; denn der Prediger hat seinen Hörern ja Gottes Wort aufzuschließen. Dazu kommt eine seelsorgerliche (parakletische) Gabe, das erkannte Wort ermunternd und ermahnend auf die Lebenssituation des einzelnen Hörers zu beziehen. Entsprechend der individuellen Ausprägung der Predigtgabe wird der „Lehrer“ der Gemeinde mehr die Gabe brauchen, biblische Zusammenhänge verständlich darzustellen und einen biblischen Text tiefgründig, aber lebendig zu erschließen, während der „Evangelist“ sehr ausgeprägt die Gabe braucht, das Evangelium geradezu elementarisierend wiederzugeben und in die Sprache und Vorstellungswelt des Außenstehenden zu übersetzen. Gewiss wird man bei jedem Prediger auch eine mehr oder weniger ausgeprägte Redebegabung erwarten dürfen sowie die geistige Fähigkeit, die Fragen sowie Denk- und Existenznöte der Zuhörer zu verstehen und von der Bibel her zu beantworten. Dies allein genügt jedoch nicht. Das nötige Charisma ist mehr.
Oftmals wird die Begabung nicht schon bei den ersten Predigtversuchen deutlich. Als Dozent für Homiletik (Predigtlehre) habe ich so manchen Schüler und Studenten erlebt, dessen erste Versuche recht kläglich klangen – und der sich im Lauf der Zeit doch als begabter Prediger erwies. Wichtig ist nur, dass es in Gemeinden die Möglichkeit zu kleinen Anfängen gibt: sei es in der Jugendstunde, in kleinen Beiträgen innerhalb der Bibelstunde oder im Rahmen einer Andacht. Für manchen war der allererste Schritt in den Verkündigungsdienst die Möglichkeit, im Gottesdienst die Schriftlesung zu übernehmen oder bei den Abkündigungen mitwirken zu dürfen. Wo sich im Kleinen Begabungen zeigen, kann man diese beobachten und gegebenenfalls fördern.
Predigtlehrgänge und Rhetorikkurse können die geistliche Begabung zur Verkündigung nicht produzieren. Sie muss von Gott gegeben sein. Wo solch ein geistliches Charisma aber vorliegt, kann und soll es gefördert und entfaltet werden. Man kann eine Begabung auch verkommen lassen und gottgegebene Talente vergraben! Paulus ermahnt seinen Schüler Timotheus: „Entfache die Gnadengabe, die in dir ist […], zu voller Flamme!“ (2Tim 1,6). Dazu kann eine entsprechende Ausbildung sehr hilfreich sein, wenngleich sie keinesfalls unabdingbar ist.
C. H. Spurgeon (1834–1892) war einer der größten Prediger der Christenheit. Und doch hat er nie eine theologische Schule besucht. Als er mit 18 Jahren ein Theologiestudium erwog, kam das geplante Vorstellungsgespräch nicht zustande. Spurgeon sah darin Gottes Führung und verzichtete auf die Ausbildung. Dafür lernte er im Selbststudium in kurzer Zeit Hebräisch und Griechisch und war in theologischer Literatur (besonders Calvin) bewandert. Er machte seine persönliche Lebensführung allerdings nicht zur Norm für andere. Im Gegenteil: Später gründete er ein Predigerseminar zur Ausbildung angehender Verkündiger.
Auch wenn Gott sich zu allen Zeiten Boten berufen hat, die für ihren Dienst nicht speziell geschult waren, gab es auch schon im alten Israel die Einrichtung der Schule und das Lehrer-Schüler-Verhältnis bei den Propheten.47 Die Apostel galten zwar als „ungelehrte Leute“ (Apg 4,13) in den Augen der langjährig ausgebildeten Schriftgelehrten; man sollte aber nicht vergessen, dass sie drei Jahre lang von Jesus wie die Schüler eines Rabbi ausgebildet worden waren. Auch Timotheus war ein Schüler des Paulus und erhielt seinerseits den Auftrag, andere zu schulen (2Tim 2,2). Kurzum: Innergemeindliche Schulungen oder eine theologische Ausbildung können der Weiterentwicklung vorhandener Begabungen dienen. Umgekehrt aber kann die beste Schulung – einschließlich Abitur und theologischer Diplome – eine fehlende geistliche Begabung nicht ersetzen.
Eine vorhandene Begabung darf allerdings kein Ruhekissen werden, auf dem man sich geistlich ausruht. Der begabte Prediger, der sich auf sein Talent verlässt und nicht mehr aus der geistlichen Dimension des Umgangs mit Gottes Wort und Gebet schöpft, vergräbt sein Talent. Manchem Prediger könnte es guttun, wieder neu das Prinzip der Kraft aus der Stille zu entdecken. Immer wieder hat Gott seine Diener in der Stille der Wüste, in der nur noch sein Reden zu hören war, und in der Anfechtung für den Dienst am Wort vorbereitet. Das war bei Mose so wie auch bei David oder Paulus. Jesus „kam in der Kraft des Geistes“ (Lk 4,14) aus der Stille und der Anfechtung der Wüste; und er suchte immer wieder die Wüste, um Kraft zu schöpfen aus der Stille des Gebets (Lk 5,16; Mk 1,35). Nur so kann das Charisma des Berufenen eine hell brennende Flamme bleiben.48
In der Tat ist ein Prediger ohne Begabung sich selbst und der Gemeinde eine Last. Gewiss, die Bibel warnt vor jenen angenehmen Predigern, die vollmachtlos – aber unterhaltsam! – predigen, wonach den Leuten „die Ohren jucken“ (2Tim 4,3). Das heißt aber nicht, dass sie jene befürwortet, die so reden, dass den Hörern die Augen zufallen, das Hören vergeht und ihre Herzen kalt und unbewegt bleiben. Wer ohne die nötige Begabung und Bevollmächtigung predigt, wird leicht an der Gemeinde schuldig. Durch sein unberufenes Reden raubt er die Freude am Wort. Von daher ist allen, die predigen wollen, dringend zur Prüfung zu raten: Liegt eine Berufung vor? Und zeigt sich diese Berufung auch an der Begabung zu vollmächtiger Predigt? Ist dies auf Dauer nicht zu erkennen, sollte man den Kelch des Predigermartyriums an sich und der Gemeinde vorübergehen lassen.